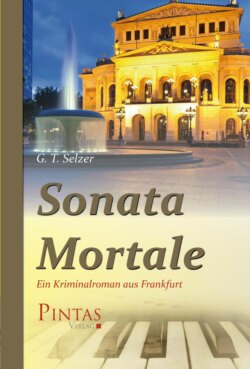Читать книгу Sonata Mortale - G. T. Selzer - Страница 3
Kapitel I
ОглавлениеG. T. Selzer
SONATA MORTALE
Ein Kriminalroman aus Frankfurt.
Vorbemerkung
In Frankfurt am Main wird man dieClara-Schumann-Akademie für Musik, Darstellenden Tanz und Gesang vergeblich suchen.
Allerdings resultiert die fiktionale Existenz einer solchen Einrichtung aus realen Gegebenheiten.
Trotzdem wären Ähnlichkeiten der handelnden mit wirklichen Personen der reine Zufall.
Kapitel 1
Leise verklangen die letzten Takte der Sturmsonate. Zwei, drei Sekunden – eine kleine Ewigkeit – herrschte absolute Stille im Großen Saal der Frankfurter Alten Oper. Dann brandete der Beifall auf. Fast unwillig hob der Pianist den Kopf, wandte ihn den Zuschauern zu und erhob sich langsam. Er verbeugte sich kurz und verschwand hinter den Kulissen. Nahezu zweieinhalb Tausend Menschen klatschten begeistert, die ersten waren bereits von ihren Sitzen aufgestanden, andere folgten, riefen Bravo, und bald war der ganze Saal außer Rand und Band. Alle Ränge des großen Auditoriums waren bis auf den letzten Platz besetzt, auch die Hubwand zum so genannten Olymp war zurückgefahren worden, um noch den letzten fünfhundert Zuhörern Platz zu bieten.
Leopold von Bethmann war nach Hause zurückgekehrt.
Nach über sechs Monaten Welttournee spielte er zum ersten Mal wieder in seiner Heimatstadt, die ihn begrüßte wie der biblische Vater seinen verlorenen Sohn.
„Du musst noch mal raus! Und ein Lächeln könnte nicht schaden!“ Jochen Eckhoff seufzte und schob den Künstler unerbittlich zum fünften Mal auf die Bühne zurück. Als dieser sich dem Klavierschemel näherte, wurde es von einer Sekunde zur anderen totenstill. Er spielte drei Zugaben, und sie wollten ihn immer noch nicht gehen lassen. Schließlich warf er sie mit einer außerordentlich rasanten Alla Turca hinaus. Bei der letzten Verbeugung spielte ein Lächeln auf seinem Gesicht; seine Hände waren leicht erhoben, die Handflächen nach außen, als wollte er die Menge endgültig aus dem Saal schieben.
„Er kriegt sie immer“, Eckhoff hinter den Kulissen schüttelte mehr amüsiert als verärgert den Kopf. „Da kann er unfreundlich sein bis zur Unhöflichkeit, die Leute lieben ihn trotzdem.“
„Er pflegt nur sein Image“, meinte Andreas Waldstein, von Anfang an Bethmanns Agent. Er war bekannt dafür, ein gutes Händchen für das Aufspüren von Talenten zu haben, doch mit Bethmann hatte er vor über zwanzig Jahren einen wahren Glücksgriff getan. Nie wieder danach hatte er einen Künstler von solchem Renommee unter seine Fittiche nehmen können.
Unrecht hatte er nicht mit seiner Bemerkung, schließlich war er zu einem nicht geringem Teil selbst Initiator des Images, das Bethmann überall auf der Welt nachhing. Mochten die gemeinsamen Initialen des Künstlers mit dem großen Beethoven noch Zufall sein, sein Auftritt, ja selbst sein Aussehen waren es nicht. Bethmann war mit den Jahren seinem Lieblingskomponisten immer ähnlicher geworden. Mittelgroß, stämmige Gestalt, Löwenmähne, die bereits mit etlichem Grau durchsetzt war, beim Spielen stets ein ernstes, unbewegtes, fast grimmiges Gesicht: So kannte man ihn, und die, die ihn nicht gut kannten, fürchteten ihn. Doch Affektiertheit konnte man ihm nicht vorwerfen; vieles von dem, was den Menschen griesgrämig und mürrisch erschien, ging auf eine alles in den Schatten stellende Gleichgültigkeit zurück, die Wirkung auf seine Umwelt betreffend; der Rest war pure Konzentration. Er trat immer in reinem Schwarz auf; Bestandteil des Marketingkonzepts, das Waldstein mit den Jahren perfektioniert hatte. Bethmann ließ es geschehen, für ihn zählte ohnehin nur die Musik. Und verdient hatten beide, der Künstler und sein Agent, sehr gut dabei.
Bethmann erschien wieder hinter den Kulissen, wischte sich mit einem weißen Tuch über die Stirn und murmelte: „Es reicht. Ich gehe jetzt nach Hause.“
Und weg war er in seiner Garderobe. Die beiden Männer, vertraut mit seinen unvermittelten Abgängen, waren nicht weiter erstaunt; der Kameramann und ein Fernsehtechniker jedoch - Teil eines Teams des Hessischen Rundfunks, das das Konzert live übertragen hatte, - schauten ihm verblüfft hinterher.
Jochen Eckhoff schloss vorsichtig die Tür zur großen Jugendstilvilla im Dichterviertel auf und ging leise die Seitentreppe hinauf, die zum oberen Trakt führte. Brigitte kam ihm müde aus dem Wohnzimmer entgegen.
„Ich dachte, du schläfst schon“, begrüßte er sie und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
„Nein, ich habe mir das Konzert angesehen.“
Zusammen gingen sie ins Wohnzimmer. Jochen holte sich einen Whisky vom Sideboard und trank ihn in kleinen Schlucken. Er lehnte den Kopf an die Rückenlehne und schloss die Augen.
„Schade, dass du nicht dabei sein konntest. Er war wieder großartig. Die Leute waren außer sich.“
„Hast du etwas anderes erwartetet?“, lächelte sie. „Es gibt viele Spitzenpianisten auf der Welt, aber nur einen, der in dieser Stadt zu Hause ist.“ Sie seufzte leicht. „Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass der Babysitter abgesagt hat und ich heute Abend zu Hause war. Leon war den ganzen Abend sehr unruhig, jetzt schläft er. Ich glaube, der Junge brütet eine Erkältung aus.“
Jochen öffnete die Augen. „Etwas Ernstes?“
„Nein, ich glaube nicht. Ich werde abwarten bis morgen; wahrscheinlich ist es da schon besser.“ Sie sah ihren Mann an. „Ich nehme an, er kommt heute nicht mehr nach Hause?“
„Was meinst du? Ach so, Leopold.“ Jochen stand auf und genehmigte sich noch einen kleinen Schluck. „Nein, ganz sicher nicht. Du kennst doch seine Verpflichtungen“, antwortete er süffisant, während er sich wieder setzte. „Und sein Zuhause ...“ Er zuckte die Schultern.
Brigitte beobachtete ihn. „Apropos Verpflichtungen ...“
Er winkte ab. „Nein, fang nicht wieder davon an. Nicht heute Abend. Es ist einfach zu spät dafür. Außerdem will ich mir diesen Abend nicht kaputt machen lassen.“
„Jochen, einer muss sich doch darum kümmern. Wenn du nur auch einmal einen Blick auf unsere Kontoauszüge werfen würdest ...“
Sein Gesicht verzog sich schmerzhaft; trotz ihres Ärgers lächelte sie in sich hinein. Künstler! Wie konnte man ihnen mit den Banalitäten des Alltags kommen! Leise fuhr sie fort:
„Ehrlich, es sieht nicht gut aus, Jochen. Ich habe heute wieder zwei Absagen im Briefkasten gehabt. Weißt du, wie viel Bewerbungen ich geschrieben habe in den letzten zwei Monaten? Und diese Wohnung hier, die können wir uns eigentlich gar nicht leisten.“
„Die Miete, die er uns dafür abnimmt, ist ein Witz! Hast du eine Ahnung, was man normalerweise in dieser Gegend bezahlen muss?“
„Ich habe nicht gesagt, dass sie zu teuer ist. Es ist nur immer noch zu viel für uns, solange ich keine Arbeit habe. Überlege mal, wie viele Stunden du in der Woche für ihn tätig bist. Stunden, für die du nie einen Cent siehst. Stunden, die dir an der Hochschule fehlen. Du hast selber gesagt, dass sie dir gerne mehr Wochenstunden geben wollen.“
„Er ist mein Vater!“
„Deshalb kann er dich doch für deine Arbeit bezahlen“, sagte sie sanft. „Am Geld kann's ja wohl nicht liegen. Und er ist auch nicht knauserig. Er macht sich einfach keine Gedanken darüber. Deshalb solltest du mit ihm reden.“
„Ach, was tue ich schon Großartiges. Gerade, dass ich ihm das Nötigste vom Leibe halte“, sagte Jochen mehr zu sich selbst. „Und bedenke doch nur einmal, welche musikalische Erziehung Leon bekommt!“
„Lieber Himmel, Jochen! Leon ist fünf! Muss man in diesem Alter unbedingt von einem Starpianisten unterrichtet werden? Außerdem ist es sein Enkel, das ist also nicht nur ein Gefallen, den er uns tut; seine Eitelkeit kommt das auch zugute, meinst du nicht? Und schließlich“, sie machte eine Pause, „ein bisschen klimpern kannst du doch auch, oder?“
Jochens Kopf schoss in die Höhe, er sah in ihr spitzbübisches Gesicht und lachte laut auf. Er erhob sich und fuhr seiner Frau zärtlich durch das Haar.
„Lassen wir das jetzt. Geh ins Bett, du siehst müde aus. Ich werde noch ein bisschen klimpern“, sagte er. „Ich gehe nach unten, damit Leon nicht aufwacht.“ An der Tür drehte er sich noch einmal um.
„Siehst du, noch ein Vorteil, den wir hier haben. Wo findest du schon ein Haus mit zwei Klavieren, wo ich mitten in der Nacht spielen kann?“
Brigitte schüttelte seufzend den Kopf. Als ob sie die Vorteile, hier zu wohnen, jemals in Frage gestellt hätte!
Wenig später erklang leise aus dem unteren Teil des Hauses, wo in Leopold von Bethmanns Salon der große Flügel stand, das Thema der Goldberg-Variationen herauf. Brigitte Eckhoff machte die Tür zum Treppenhaus auf, lauschte kurz zum Kinderzimmer hinund hörte ihrem Mann zu.
Das Taxi hielt in Unterliederbach in einer Siedlung aus den späten 1950er Jahren mit freistehenden, zweistöckigen, nahezu quadratischen Häusern, alle mit einem großzügigem Garten, Terrasse und schmückenden Erkerfenstern im unteren Stock. Es war ein angestammtes Viertel für Akademikerfamilien und höhere Beamte; in der Zeit seiner Erbauung galt es geradezu als vornehm, und mochte dieses Attribut auch heute nicht mehr zutreffen, so ließ es sich dort doch immer noch sehr gut leben.
Sonja Müller bezahlte. Langsam ging sie mit Jenny den kurzen Weg durch den kleinen Vorgarten auf die Haustür zu. Jenny wiederholte zum ungefähr zwanzigsten Mal. „Traumhaft, Mama! Es war einfach so wunderschön! Die Leute klatschen wahrscheinlich immer noch.“ Sie seufzte. „Glaubst du, er ...“
„Pst! - Pst!“
Das Mädchen und die Frau blieben für einen Moment erschrocken stehen, dann lachten sie.
„Ja, ich glaube, er kommt heute noch!“ sagte Sonja glücklich und blickte an der Hauswand entlang, von der sich jetzt ein Schatten löste und die Arme aufhielt.
„Papa!“ Jenny sprang vor und lief auf Leopold von Bethmann zu. „Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, dass du noch kommst!“
„Wie könnte ich nicht! Hallo meine Kleine – nein, entschuldige!“ Er hielt sie auf Armeslänge von sich weg und betrachtete sie im fahlen Licht der Straßenlaterne, das in den Vorgarten schien. „Lieber Himmel – du bist ja erwachsen geworden! Ich war doch nur ein paar Monate weg!“ Erschrocken ging sein Kopf zwischen Jenny und ihrer Mutter hin und her. „Kann man das glauben!?“ Er drückte sie an sich. „So eine große Tochter!“
„Sie ist fast fünfzehn, mein Lieber. Und du hast sie fast jeden Tag übers Internet gesehen.“
Sonja ging ihm entgegen, er umarmte sie fest und gemeinsam näherten sie sich der Haustür, hinter der jetzt ein lautes Winseln und Kratzen zu hören war. Kaum hatte Sonja aufgeschlossen, schoss ein schokoladenbrauner Labrador auf sie zu, ignorierte konsequent seine beiden Frauchen und sprang an Leopold hoch.
„Hallo Clara, wie geht’s denn meiner Besten, ja - ja, ist ja gut! Ich bin wieder da!“
„Skypen heißt das übrigens, Mama!“ tönte es vom Wohnzimmer, wo in Windeseile Handtäschchen, Abendbolero und Ballerinas zwischen Tür und Couch verteilt worden waren, während sich deren Besitzerin bereits wohlig auf einem Sessel räkelte.
Sonja hängte ihren Mantel auf. „Dich habe ich auch jeden Abend auf dem Bildschirm gesehen, aber was ist das schon?“, murmelte Leopold hinter ihr, während er sie an sich zog.
Sie drehte sich um und schlang die Arme um seinen Hals. „Ich habe dich doch besucht in London, Paris und Berlin.“
„Ach die paar Tage!“
„Bin ich froh, dass du wieder da bist!“
„Und ich erst!“
„Warum bist du denn nicht hineingegangen? Uns da draußen einfach aufzulauern!“
Er küsste sie. „Ich wollte euch nicht erschrecken.“
„Ach so, wolltest du nicht?“ Sie lachte und löste sich von ihm. „Es war wohl eher dein Sinn fürs Dramatische, gib's zu.“
Clara tollte neben ihnen her, als sie ins Wohnzimmer gingen, warf sich auf den Rücken, sprang wieder auf die Beine, klopfte mit dem Schwanz Löcher ins Parkett und stieß dabei mitleiderregende Laute aus, die sie abwechselnd als Wimmern, Schluchzen und sehnsuchtsvolles Fiepen inszenierte.
Leopold ließ sich auf die Couch fallen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Hündin sprang neben ihn und wurde durch Kraulen belohnt.
„Ihr wart im Konzert?“ Er zeigte auf die Accessoires der Abendgarderobe seiner Tochter und zwinkerte ihr zu. „Was gab's denn?“
„Och, nichts Besonderes“, zwinkerte Jenny zurück. „Nur der beste Pianist der Welt.“
„Übertreib nur weiter!“ Er lächelte sie liebevoll an. „Ich habe nur für euch gespielt!“
„Du, mein Lieber“, sagte Sonja, die jetzt mit einer Flasche Rotwein und einem Korkenzieher durch die Tür trat, „du spielst immer nur für dich selber! Jenny, hol mal bitte die Gläser!“
„Mist, wenn man so schnell zu durchschauen ist!“ antwortete Leopold zerknirscht und machte sich an der Flasche zu schaffen.
„Ach Papa, ich find' dich echt witzig“, kicherte seine Tochter und stellte die Weingläser auf den Tisch. „Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben!“
„Drei Gläser? Die Kleine auch schon?“ Fragend schaute Leopold zu Sonja hinüber.
„Papa! Einen Schluck – zur Feier des Tages. Und heute ist Freitag.“
Sonja nickte leicht mit dem Kopf.
„Dafür will ich jetzt noch mal das Adagio hören!“
„Es ist halb zwölf!“
„Macht nichts, das Haus ist schalldicht.“
Während Jenny leise die ersten Takte des zweiten Satzes von Beethovens Pathetique anschlug und sich Mühe gab, durchgehend – auch gegen den Willen des Komponisten - einigermaßen piano zu bleiben, saßen ihre Eltern samt Hund auf der Couch und hörten, der eine mehr, die andere weniger kritisch zu.
„Von mir hat sie das nicht“, flüsterte Sonja glücklich, während sie sich an Leopold kuschelte.
„Nur gut, dass sie das Talent von mir und das Aussehen von dir geerbt hat. Stell dir mal vor, es wäre umgekehrt!“, flüsterte Leopold zurück.
Wie immer, wenn Jenny vor ihrem Vater spielte, drehte sie sich danach augenblicklich und mit ängstlichen Augen zu ihm um und sah ihn erwartungsvoll an.
„Kind, denke daran, was deine Mutter eben gesagt hat: Du musst in erster Linie für dich selber spielen, schiele nicht immer aufs Publikum – und schon gar nicht auf die Kritiker!“, sagte Leopold.
„Okay. Ab heute höre ich nicht mehr auf dich“, lachte sie.
Leopold drohte ihr scherzhaft mit dem Zeigefinger. Dann sagte er ernst: „Das war sehr gut, Jenny, den nächtlichen Umständen entsprechend. Besser, als das, was du mir am Sonntag nach Mailand geschickt hast über … über Dings ...“
„Skype, Papa.“
„Wie geht es denn unserem Dr. Löwenthal?“, fragte Leopold, als sie die letzte Runde mit Clara durch die stillen Straße gingen, die aufs Feld hinausführte. In dessen Praxis, in der Sonja als Ärztin angestellt war, hatten sie sich vor sechzehn Jahren kennen gelernt. „Der muss doch inzwischen schon über siebzig sein. Ich hätte eigentlich gedacht, er würde dir die Praxis anbieten, wenn er in Ruhestand geht. Hättest du nicht Lust dazu?“
„Ja, jetzt ginge es, Jenny ist aus dem Gröbsten raus. Aber weißt du,“ sie lächelte verschmitzt. „So ein Angestelltendasein hat schon etwas für sich. Damals, als Jenny noch klein war, ging es ja nicht anders. Geregelte Arbeitszeiten, Stress in Grenzen, Feierabend um sechs, nur ab und zu Bereitschaftsdienst. Man kann sich daran gewöhnen!“
„Es wäre schon gegangen“, murmelte er leise.
„Du kennst meine Einstellung dazu“, sagte sie bestimmt.
„Hast du auch an Jenny dabei gedacht?“
„Du meinst, das große Haus, die tollen Leute, Presse, Dienstboten, Tourneen, die Tochter eines berühmtes Vaters ...“
„... ist sie jetzt auch!“
„Du weißt, was ich meine. Ich wollte nicht, dass sie in diesem Rummel aufwächst!“
„Und was ich meine, ist Familie, Zusammenleben, Nachhausekommen ...“ Er seufzte. „Sie ist allmählich alt genug. Lass sie selber entscheiden!“
„Ich habe ihr nie verboten, zu dir ins Dichterviertel zu gehen. Ich habe dich lediglich gebeten, sie mir nicht in deine Welt zu entführen.“
Nach ein paar Schritten sagte er unvermittelt: „Ich muss dir etwas sagen. Aber“, er drehte sie zu sich herum und sagte ernst: „Du darfst es niemandem erzählen, hörst du? Noch nicht! Nicht einmal Jenny! Das musst du mir versprechen!“
„Ja, natürlich, wenn du meinst“, sagte sie verwundert.
Hanna Jablonska rannte, so schnell es eben bei ihr ging, von der Küche in den Flur und erreichte das Telefon, als es gerade sein Klingeln eingestellt hatte. Schwer atmend, als ob sie einen Marathon gelaufen wäre, blieb sie stehen. Mist. Sie musste sich endlich eines dieser Mobilteile kaufen; ihr alter Apparat stammte buchstäblich aus dem letzten Jahrtausend. Doch jedes Mal, wenn sie versuchte, einen Neukauf in Angriff zu nehmen, gab sie schon nach wenigen Minuten auf: Ob im Geschäft oder beim Studieren von Prospekten – ihr brummte der Schädel, wenn sie die Beschreibungen las oder ihr ein flotter Typ im Telefonladen all die Funktionen eines neuen Wunderteils erklärte, von denen sie auch nicht annähernd verstand, was sie bedeuteten. Geschweige denn sich vorstellen konnte, sie jemals zu benutzen. Und so war sie bei ihrem alten Tastentelefon geblieben. Leopold würde ihr einmal mehr helfen müssen, beschloss sie, jetzt, wo sie in der Nähe wohnte und er wieder da war.
Sie wartete noch einige Sekunden vor dem schönen Biedermeiersekretär, der in der geräumigen Diele stand und auf dem das Telefon seinen Platz hatte. Doch es regte sich nicht mehr. Langsam ging sie in die gemütliche Wohnküche zurück. Ja, sie würde Leopold fragen. Er hatte ihr auch das Handy besorgt – das immerhin besaß sie. Sie benutzte es so gut wie nie, doch sie hatte es immer angeschaltet, greifbar und die Batterie aufgeladen, Dinge, die er ihr eingeschärft hatte. Ein ganz einfaches, ein Seniorenhandy, wie er scherzhaft gesagt hatte – oder war es am Ende gar kein Scherz? Man könne damit telefonieren, meinte er, und mehr nicht. Wobei sie nicht so recht verstanden hatte, was dieses „und mehr nicht“ zu bedeuten hatte.
Und genau dieses Handy begann jetzt zu klingeln. Es dröhnte laut die ersten Takte der fünften Beethovenschen Sinfonie durch den Raum, während seine Besitzerin sich hastig auf die Suche machte und versuchte, sich von dem lauten Bambambam-Baam nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Schließlich fand sie es in einer alten Jacke, die sie immer zur Gartenarbeit anhatte. Doch inzwischen war es auch verstummt.
Man konnte sehen, wer angerufen hat und dann zurückrufen, hatte Leopold gesagt. Und wie ging das noch mal? Langsam sank sie auf einen der Stühle, die um den großen Esstisch gruppiert waren, und seufzte. Sie hätte keine Probleme damit, aus dem Stand die Hammerklaviersonate zu spielen und sie konnte das komplette Wohltemperierte Klavier, erster und zweiter Teil, noch auswendig. Doch sie war nicht in der Lage, die Nummer des Anrufers zu ermitteln, weil das Mobiltelefon auf ihre Eingaben schlichtweg nicht reagierte. Leopold hat es dir doch erklärt, sagte sie sich. Aber er war zu schnell gewesen, wie das technisch versierte Menschen oft sind, wenn sie Laien Selbstverständlichkeiten erklären.
Nach einigen Versuchen gab sie es auf.
Andererseits – man könnte ja zur Abwechslung einmal den Verstand benutzen, dachte sie, schon im Aufstehen, und ging in den Flur zum Telefon zurück, wo sie Leopolds Nummer wählte und kurz darauf mit einem Lachen, das sie nur zu gut kannte, begrüßt wurde. Na bitte, geht doch.
„Hast du gelernt, wie man verpasste Anrufe zurückruft?“, fragte Leopold.
„Nein, aber außer dir kennt kaum einer meine Handynummer. Deduktion der einfacheren Art. Wie geht’s dir? Schön, dass du dich meldest und deine alte Lehrerin nicht vergessen hast.“
„Wie könnte ich das! Danke der Nachfrage, ich hoffe, dir geht es so gut wie uns.“
„Ich war am Freitag im Konzert. Hast du ganz nett gemacht, mein Junge, bis auf den winzigen Patzer, du weißt schon. Hat aber keiner gemerkt.“
„Patzer?“ Gespielte Empörung am anderen Ende der Leitung. „Na hör mal!“ Er lachte wieder. „Sag mal, hast du heute Nachmittag schon etwas vor? Ich würde gerne mal rauskommen und noch jemanden mitbringen.“
„Sonja und Jenny? Na, endlich! Ich freue mich ja so, sie endlich kennenzulernen! Ich erwarte euch gegen vier.“ Damit legte sie auf; ein Freund von unnötigen Worten war Hanna Jablonska noch nie gewesen.
Kopfschüttelnd steckte Leopold sein Handy in die Tasche. „Diese Frau! Wie oft habe ich ihr das erklärt! Sie kriegt es einfach nicht auf die Reihe.“
„Du hast doch gesagt, sie ist erst Anfang Siebzig“, meinte Sonja, die aus dem Flur hereinschaute, wo sie ihren Mantel übergezogen hatte.
„Aber nicht von dieser Welt. Weiß der Himmel, wo sie lebt. Wahrscheinlich im 18. Jahrhundert.“ Er stand auf. „Ist Jenny fertig? Dann fahren wir.“
Hanna Jablonska lebte seit knapp sieben Monaten im Rheingau, genauer gesagt in Eltville, wo sie sich nach ihrem Umzug aus Berlin für ihren selbst verordneten Ruhestand ein Haus gekauft hatte. Bei der Suche waren zwei Kriterien wichtig gewesen: ein großer Salon, in den ihr Flügel nicht nur hineinpasste, sondern in dem er auch seinen Klang voll entfalten konnte, und Nachbarn, die weit genug weg wohnten, um sich an ihrem häufig auch nächtlichen Klavierspiel zu stören. Dass das Haus nun auch noch in so traumhafter Lage am Rhein lag, war ein zusätzlicher Glücksfall gewesen.
Wer ihren Namen von Schallplatten- und CD-Einspielungen kannte, würde in der kleinen, dicken, äußerst unscheinbaren Frau sicher nicht die große Pianistin und Musikpädagogin vermuten, die sie war. Sie kleidete sich – auch zu offiziellen Anlässen - gerne leger, was einerseits daran lag, dass sie mehr Wert auf Bequemlichkeit als auf Eleganz legte, hauptsächlich aber, weil auch das schickste Kleid an ihr nicht sehr viel besser aussah als ein grob geschnittener Kartoffelsack.
Bis Anfang der Neunziger Jahre hatte sie selbst glanzvolle Konzerte gegeben, sich dann zurückgezogen – das Herz begann, ihr Probleme zu machen - und darauf beschränkt, einigen Auserwählten Unterricht zu geben. Leopold von Bethmann hatte schon früh dazu gehört; und anders als zu anderen Schülern, die kamen und gingen, hatte ihre Bekanntschaft die Zeiten überdauert und war zur Freundschaft geworden. Hanna kannte seine Familie aus zahlreichen Erzählungen, hatte Sonja und Jenny aber nie kennengelernt. Jetzt, da sie in der Nähe wohnte, würde sich das ändern, und sie freute sich darauf.
Jeder, der Hannas Wohnzimmer betrat, wurde magisch angezogen von der Reihe französischer Fenster, die der Tür gegenüber lagen und einen prächtigen Blick auf den Rhein frei gaben. Der Garten vor den Fenstern fiel zur Uferpromenade ab. Dahinter floss ruhig der große Strom. Eine Sitzecke war so platziert, dass sie den Blick auf dieses Panorama freigab; die rechte Wand wurde von Bücherregalen eingenommen, die bis zur Decke reichten.
Als Sonja, Leopold und Jenny, die Hündin Clara im Schlepptau, nun diesen Raum betraten – sie hatten in Wiesbaden in einem Lokal am Rhein zu Mittag gegessen und waren nun zur verabredeten Zeit in Eltville eingetroffen – blieben sie einen Moment überwältigt stehen. Es war ein herrlicher Herbstsonntag. Hell und luftig durchflutete die Oktobersonne das Zimmer, unten zog der Fluss als silbernes Band vorbei, und von der Königsklinger Aue, einer Insel mitten im Rhein, glitzerte das Laub der Bäume in allen denkbaren Gold- und Rottönen herüber. Leopold kannte die Wohnung, war aber nur ein Mal hier gewesen, bevor er zu seiner Tournee aufgebrochen war.
„Einen Glücksgriff hast du da getan, Hanna“, sagte er. „Man kann dir wirklich nur gratulieren!“
Recht ungeschickt versuchte Hanna, ihren Stolz zu verbergen, und sagte forsch: „Kaffee ist schon fertig. Setzt euch. Ich habe hier vor den Fenstern gedeckt.“
Sonja trat zum Bücherregal. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass es hauptsächlich mit Kriminalromanen jeglicher Provenienz und Epoche gefüllt war. Beginnend mit Poe, Wilkie Collins und Arthur Conan Doyle waren sie alle vertreten: die klassischen Engländerinnen, die harten Schweden, die rationalen Franzosen, die eigenwilligen Italiener, die vielseitigen Amerikaner, die Nachzügler aus Deutschland. Daneben standen etliche wissenschaftliche Abhandlungen über den Kriminalroman – Sonja hatte gar nicht gewusst, dass es so etwas überhaupt gab.
Sie hörte Hanna in der Küche hantieren und besann sich auf ihre gute Erziehung. „Kann ich Ihnen etwas helfen?“, fragte sie, als sie ihr folgte.
„Ich heiße Hanna, und wir duzen uns“, erwiderte Hanna bestimmt. „Ja, hier, nimm doch bitte das Kuchentablett.“
Sonja lächelte. Man sollte sich nicht von ihr täuschen lassen, dachte sie. Die kurze, aber scharfe Musterung, die Hanna ihr an der Tür hatte angedeihen lassen, war nicht unbemerkt geblieben und hatte Sonja gezeigt, dass sich hinter dem harmlosen, ja unbeholfenen Äußeren ein äußerst wacher Verstand verbarg. Doch offensichtlich war diese erste Begutachtung zu ihren Gunsten ausgefallen, was Sonja auch Leopolds unmerklichem Nicken entnahm, das sie auffing, als sie nach der Begrüßung zusammen ins Haus gingen. War er erleichtert gewesen? Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass zumindest sie diesem ersten Treffen einigermaßen nervös entgegen gesehen hatte – fast so, als würde sie seiner Mutter vorgestellt werden.
„Du musst die Tasten erst entsperren“, sagte Leopold, als sie zusammen am Tisch saßen und der erste Kuchenhunger gestillt war. Er nahm Hannas Mobiltelefon in die Hand. „Schau mal her: Es ist eine Tastensperre eingebaut. Die verhindert, dass ungewollt eine Nummer angewählt wird, zum Beispiel, wenn du das Handy in der Handtasche hast und irgendetwas darauf drückt. Die Sperre wird nach 30 Sekunden aktiv. Erst wenn du dann eine Kombination von zwei bestimmten Tasten drückst – siehst du, hier und hier – kannst du wieder telefonieren.“
Hanna schaute konzentriert zu, nickte und schwor, es jetzt endgültig verstanden zu haben und nicht wieder zu vergessen.
Es wurde ein in jeder Beziehung harmonischer Nachmittag. Jenny musste natürlich vorspielen, was sie trotz ihres offenkundigen Lampenfiebers bravourös meisterte, Hanna und Leopold spielten vierhändig, und Clara zeigte sich von ihrer allerbesten Seite.
Montags früh war es am schlimmsten. Es war, als hätten sich die Patienten mühsam über das Wochenende geschleppt, sämtliche Beschwerden und Wehwehchen der letzten drei Tage gesammelt, um dann montags pünktlich um acht Uhr in der Praxis zu erscheinen und die Last ihrer Symptome vor verständnisvollen ärztlichen Ohren abzuladen. Es waren hauptsächlich Klienten jenseits der Fünfundsiebzig, die viel Zeit mitbrachten. Geduldig saßen sie im Wartezimmer, trafen den einen oder anderen Bekannten und nutzten die Gelegenheit, Erfahrungen mit Krankheitsbildern, Medikamenten oder auch Fachärzten auszutauschen, zu denen sie eventuell überwiesen werden könnten.
„Nein, zu dem Dr. Kruse sollten Sie auf keinen Fall gehen! Die Freundin meiner Cousine war ja so unzufrieden mit ihrer Hüfte!“ - „Ach glaawese doch net alles, was die Leut so schwätze! Des stimmt doch gar net. Meine Schwester hat er ...“ - „Ich sach Ihne, die wolle all nur schnelles Geld, da sinnse all gleich. Das letzte Mal, wie ich hier war, warn's kaa drei Minute, wo ich widder draus war!“
Nichtsdestotrotz schilderten sie dann in der Sprechstunde weitläufig und in aller Ausführlichkeit ihre Beschwerden, die in der Regel denen ihres letzten Besuchs auf Haar glichen. Und jeder erwartete individuelle Aufmerksamkeit, geduldiges Verständnis und das Gefühl, sein Problem sei einzigartig auf dem gesamten Erdkreis. Dabei war die Diagnose letztendlich in fast allen Fällen so einfach wie frustrierend, weil unabänderlich: Es war das Alter. Verschleiß, Abnutzung, Verfall. Von Knochen, Gelenken, Organen, Gewebe. Mit vierzig hat der Körper seine beste Zeit hinter sich, pflegte Löwenthal zu sagen, danach geht’s bergab. Man kann es etwas abbremsen durch gesunde Lebensweise, aufhalten kann man es nicht.
Dr. Karl Löwenthal war genau der Typ Arzt, der seine Patienten – ohne dass er es wollte – in ihrem Verhalten bestärkte, ein geduldiger, erfahrener praktischer Arzt alter Schule aus einer Zeit, in der es noch nicht für jeden einzelnen Muskel im Körper einen hochqualifizierten Spezialisten gab, als Hausärzte auch in der Stadt noch ihren Namen verdienten, weil sie Hausbesuche machten, ein Arzt, der das Wort Ganzheitsmedizin praktizierte, bevor es in aller Munde war. Er war noch immer eine imposante Erscheinung für seine vierundsiebzig Jahre, mit vollem, weißem Haar, markanten Gesichtszügen und gütigen Augen, die in der Lage schienen, das Leid der ganzen Welt in sich aufzunehmen. Nicht ausgeschlossen, dass die Beschwerden einiger Damen bei dem Gedanken an ihn schlagartig zunahmen und weitere Besuche nötig machten. Nie hatte man von ihm ein abfällige Bemerkung über seine Patienten gehört, und seien es noch so belanglose Zipperlein, mit denen sie zu ihm kamen.
Als Sonja am Montag nach diesem schönen Wochenende beschwingt die Praxis betrat, konnte ihr auch das bereits volle Wartezimmer nicht viel anhaben. Löwenthals Patienten hielten ihm die Treue und waren mit ihm alt geworden. Und davon, dass er so ungemein beliebt war, profitierte sie schließlich auch: Eine zusätzliche angestellte Ärztin musste eine Praxis erst einmal verkraften können. Andererseits hatte sie etwas frischen Wind in die Räume gebracht, als sie vor fünfzehn Jahren hierher kam, hatte behutsame Renovierungen in den Zimmern, aus denen der Mief der siebziger Jahre atmete, vorgeschlagen und durchgesetzt, neue Geräte angeschafft und jüngere Leute angezogen. Einige Male hatte sie erlebt, dass ältere Patienten sie ablehnten und lieber zu dem „richtigen Doktor“ gehen wollten, doch das waren Ausnahmen. Sie war nicht promoviert, und der Name Sonja Müller auf dem weißen Schild an der Tür nahm sich vergleichsweise bescheiden aus unter dem altertümlich-imposanten Dr. med. Karl Löwenthal, Praktischer Arzt und Geburtshelfer. Doch vor fünf Jahren war ein neues Schild in Auftrag gegeben und unter ihren Namen Fachärztin für Allgemeinmedizin gesetzt worden.
„Guten Morgen, Frau Müller, gut, dass Sie da sind“, Waltraud Peters, die Sprechstundenhilfe, wedelte mit dem Telefonhörer in Richtung Eingangstür, die Sonja eben durchschritten hatte. „Der kleine Jens vom Freitag, Sie erinnern sich, hier seine Mutter.“ Damit drückte Frau Peters zwei Knöpfe und zeigte in Sonjas Behandlungsraum. „Ich hab's reingelegt.“
Und schon wieder mitten drin, dachte Sonja, zog hastig den Mantel aus und griff zum Hörer, stellte einige Fragen und beruhigte die aufgeregte Frau am anderen Ende der Leitung.
„Nein, nein, das ist normal, wenn es sich erst mal rot verfärbt; das sollte bis heute Abend vorbei sein. Wenn nicht, rufen Sie noch mal an.“ Sie legte auf und hängte summend ihren Mantel in den Garderobenschrank. Diese Hanna ist eine sehr nette Frau, dachte sie. Schade, dass wir uns nicht früher kennen lernen konnten. Sie lächelte vor sich hin und nahm sich vor, den Kontakt zu pflegen, wie sie es beim Abschied versprochen hatte, auch wenn Leopold nicht dabei war.
„Das ist schön, so gute Laune an einem verregneten Montagmorgen!“ Löwenthal hatte die Verbindungstür zwischen den beiden Behandlungsräumen aufgezogen, so gut dies mit den beiden Kaffeebechern in der Hand ging, die er jetzt vorsichtig auf ihrem Schreibtisch abstellte. Es war zum Ritual geworden, dass sie sich montags vor Arbeitsbeginn ein paar Minuten zusammensetzten, um das Nötigste zu besprechen. Wobei, schätzte Sonja, Löwenthal sicher bereits seit einer Stunde hier war. Seit dem Tode seiner Frau kam er früher und ging später.
„Ja, wir waren im Rheingau, hatten Glück mit dem Wetter und haben jemanden Nettes kennengelernt. Die ehemalige Klavierlehrerin von Leopold. Sie ist kürzlich erst von Berlin hierher gezogen. War schön“, sagte sie.
„Wie geht es ihm denn? Sie waren sicher im Konzert am Freitag?“
„Danke, es geht ihm gut. Er will mal wieder vorbei kommen. Und natürlich waren wir im Konzert!“ Sie lachte und nahm ihren Becher in beide Hände. Sie lacht gerne, dachte der alte Mann, das tut gut. Er hatte noch keine Stunde bedauert, sie eingestellt zu haben.
Sie gingen die wichtigsten Fälle durch; dem Alter der Klientel entsprechend waren es meist Befunde, die von Orthopäden, Urologen, in schlimmeren Fällen auch von Onkologen zurückkamen. Löwenthal kannte jeden Patienten persönlich und war gerne auf dem Laufenden. Anfangs hatte Sonja dies befremdet und war ihr als Bevormundung vorgekommen, doch er sprach seine wichtigen Fälle genauso mit ihr durch.
Zehn Minuten später gingen sie zusammen zur Theke nach draußen, um die ersten Patientenakten in Empfang zu nehmen.
Der Vormittag verging rasch, und als Sonja in eine verspätete, kurze Mittagspause aufbrach, klingelte ihr Handy.
„Ich bin's, Hanna“, meldete sich die Anruferin. „Ich störe dich nur kurz. Mir war danach, dir zu sagen, wie sehr ich mich über euren Besuch gestern gefreut habe.“
„Das ist aber nett von dir. Und du störst gerade gar nicht.“
„Lass uns das öfter machen, auch wenn Leopold nicht da ist. Ruf einfach an und komm vorbei.“
„Gedankenübertragung!“, lachte Sonja. „Ganz ähnlich habe ich heute auch schon gedacht. Aber das nächste Mal bei uns in Frankfurt.“
„Na, wunderbar! Dann arbeite mal schön weiter und mach die Leute gesund! Bis dann.“
Wie meistens bei Hanna endete das Gespräch abrupt, es war alles gesagt. Lächelnd steckte Sonja ihr Handy ein und verließ die Praxis, um sich einen Salat beim Italiener um die Ecke zu genehmigen. Unterwegs holte sie noch einmal das Telefon hervor, um kurz Leopold anzurufen, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Ihr war eingefallen, dass er heute und morgen Gespräche mit dem Vorstand der Musikakademie hatte.