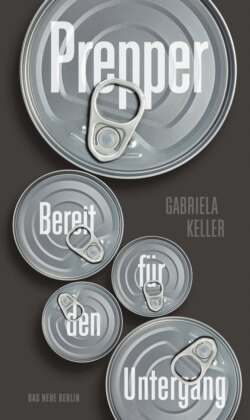Читать книгу Bereit für den Untergang: Prepper - Gabriela Keller - Страница 9
ОглавлениеI. Doomer, Retreater, Survivalisten: Prepper-Typen und welche Krisen sie kommen sehen
»Menschen leiden, Menschen sterben.
Und unsere Ökosysteme sind dabei zu kollabieren.
Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens.«
(Greta Thunberg)
Es ist Samstag, der 7. März 2020, in England landet Premierminister Boris Johnson mit Covid-19 auf der Intensivstation, die OECD ruft die Währungsunion zur Ausgabe von Coronabonds auf, die Stadt New York stellt sich auf Notbegräbnisse sein, in Berlin steigt die Zahl der Infizierten auf 3834, und irgendwo in Deutschland tippt ein Telegram-Nutzer eine Reihe von Aufforderungen in seinen Kanal namens »Prepper_Deutschland«: »Achtung!!!«, schreibt er: »Ändert die Spielregeln!!! Vernetzt Euch!!! Baut Alternativen zu unserem System auf!!!« In den Tagen danach folgen auf dem Kanal allerhand nützliche Hinweise für den Ernstfall: Ein PDF mit Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Links zu YouTube-Filmen über pflanzliche Heilmittel, Tipps für den Notfallvorrat zu Hause, Hinweise zum Verhalten auf Demonstrationen und ein Aussaatkalender. Zwischen Krisenkochtipps und einer Liste der schönsten Wanderwege sind Links zu Videoclips von rechtsextremistischen Bloggern gestreut, die ihre »Ratschläge für den Zusammenbruch« anbieten, dazu die Bitte, all das gerne weiterzuverbreiten, »um möglichst vielen Personen in dieser Corona-Krise (Pandemie) eine Hilfestellung zu geben«.
In atemlosen Sätzen diktiert der anonyme Kanalbetreiber seinen rund 3000 Abonnenten eine stichpunktartige Anleitung für die Zeiten der Covid-19-Pandemie auf die Handy-Displays. Der alarmistische Sound, die Abzweigungen zu Nazi-Kanälen und der latent staatsfeindliche Unterton der Posts sind in der Szene nicht selten. Sie charakterisieren auch nicht alle Prepper. Was aber alle von ihnen teilen, ist eine Annahme: Die Katastrophen kommen auf uns zu, aber wer die richtigen praktischen Vorkehrungen trifft, kann sie überstehen.
Prepper sehen viele Arten von Gefahren voraus: Naturkatastrophen, Finanzkollapse, Aufstände, Bürgerkriege, Sonnenstürme, Invasionen, Terroranschläge, Unfälle in Atomkraftwerken und Chemiewerken oder eben Pandemien. »Es gibt viele wunde Punkte in dieser Gesellschaft«, sagt einer, der sich ein Rückzugsgehöft in Brandenburg eingerichtet hat. »Anfangs waren diese Überlegungen bei mir angstbetont, aber Angst ist ein kraftvoller Motivator. Und wenn man sich mit der Materie beschäftigt, geht die Angst auch weg.«
Eine der häufigsten Fragen in Prepper-Chats ist: Auf welches Szenario bereitest du dich vor? Die Frage dient nicht nur zum Abgleich von Taktiken und Strategien, sie ist auch Startpunkt für den Austausch von Narrativen: Mit viel Gespür für Dramatik und Spannungsbögen erzählen Prepper einander Geschichten vom Verlauf hypothetischer Krisen und von ihren praktischen Lösungen. Manche proben ihre Szenarien allein oder mit Gleichgesinnten, und wenn sich die politische Situation verändert, werden die Geschichten angepasst oder umgeschrieben. Darin stehen staatliche Institutionen vor der Auflösung, während der Prepper selbst sich bereit macht, das Vakuum zu füllen: Wer sich vorbereitet hat, weiß, was zu tun ist. Die Geschichten kommender Katastrophen und passender Überlebenstaktiken stützen sich auf Medienberichte, Nachrichten, Endzeitfiktion, Verschwörungsnarrative und historische Ereignisse; oft greifen Fantasie und aktuelle Nachrichten ineinander. Das Storytelling ist ein zentraler Faktor beim Prepping, und zu dieser imaginären Komponente passt, dass oft nicht nur Sachbücher oder Medienberichte als Grundlage der Strategien dienen, sondern Katastrophenfilme und Endzeitthriller. Erstaunlich viele der Vorsorger beziehen sich zum Beispiel auf die Zombie-Apokalypse in der Serie »The Walking Dead«.
1. Ein Störfall, dann fallen die Dominosteine – Krisen-Inspiration in Fiktion und Wissenschaft
Eine der wichtigsten Inspirationsquelle für die Prepperszene ist ein fiktives Werk: der Thriller »Blackout« des österreichischen Schriftstellers Marc Elsberg. Das Buch, ein internationaler Bestseller, erzählt eindrücklich und detailliert von den verheerenden Folgen eines europaweiten Stromausfalls infolge eines Hackerangriffs und ist damit zu einer Art Prophezeiung der Prepperszene geworden. Der Untertitel lautet: »Morgen ist es zu spät«.
Radio und Fernseher bleiben stumm, Kühlschränke und Elektroherde gehen nicht mehr, Züge bleiben stehen, Menschen stecken in Aufzügen fest, dann geht es Schlag auf Schlag: Ansturm auf Banken, Ampelausfälle, Verkehrschaos, an den Tankstellen versiegt das Benzin, bald gibt es Treibstoff- und Lebensmittelengpässe, hinzu kommen Havarien in Kernkraftwerken und Industrieanlagen. Es dauert nur wenige Tage, bis die öffentliche Ordnung zusammenbricht und Kriminalität und Plünderungen um sich greifen.
Viele Prepper nennen den Roman, wenn man sie nach ihrer Motivation fragt. Elsbergs Buch, das gerade mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle als Serie verfilmt wird, zeigt auf, wie verletzlich die moderne Gesellschaft ist, und wie störungsanfällig die Infrastruktur. Ohne Strom funktioniert nichts. Ein Störfall, dann fällt ein Dominostein nach dem anderen.
Gewiss hat die Skepsis der Prepper in diesem Punkt auch mit der Komplexität der modernen Welt zu tun: Strom, Internet, globalisierte Finanzmärkte, internationale Politik – was so wenig überschaubar ist, kann ja anscheinend nicht auf Dauer gut gehen. Viele glauben, dass das Desaster jederzeit zuschlagen kann. Ersthelfer und das soziale Sicherungsnetz werden überwältigt, Versorgungsketten unterbrochen, Mangel, Panik, Kollaps sind die Folge, so dass die Behörden den Notstand ausrufen und Ausgehverbote verhängen.
Man muss aber auch sagen: Das alles ist weitaus weniger irre, als es klingt. Zeitgleich mit Elsbergs Recherchen für »Blackout« erarbeitete eine wissenschaftliche Einrichtung mit dem sperrigen Namen Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ihren Arbeitsbericht Nr. 141. Der Titel: »Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen Ausfalls der Stromversorgung«. Und dieses Papier kommt zu sehr ähnlichen Erkenntnissen wie der Thriller des österreichischen Schriftstellers. In dem Bericht heißt es: »In modernen, arbeitsteiligen und hochtechnisierten Gesellschaften erfolgt die Versorgung der Bevölkerung mit (lebens)notwendigen Gütern und Dienstleistungen durch ein hochentwickeltes, eng verflochtenes Netzwerk ›Kritischer Infrastrukturen‹«, dazu zählten Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Energieversorgung und Gesundheitswesen. Terroristische Anschläge, Naturkatastrophen oder schwere Unglücksfälle haben, so heißt es, aufgezeigt, welche weitreichenden Folgen eine Beeinträchtigung Kritischer Infrastrukturen für das gesellschaftliche System haben könnten, heißt es im Arbeitsbericht Nr. 141: »Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines langandauernden und großflächigen Stromausfalls zu einer Schadenslage von besonderer Qualität summieren. Betroffen wären alle Kritischen Infrastrukturen und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern.«4
Wer das liest, der ahnt: Die Prepper könnten in einigen Punkten recht haben. Dass sie trotzdem kollektiv als Aluhutträger und Paranoiker verspottet werden, nehmen viele von ihnen der nicht vorbereiteten Mehrheit übel. Wie Sebastian Hein in seinem Ratgeber »Prepper, Krisenvorsorge, Survival Guide« schreibt: »Es wird sich über diese Thematik lustig gemacht, und es kommen immer Pseudoargumente wie: ›Bei uns kann so etwas nicht passieren, wir leben in Zentraleuropa‹, ohne sich zu qualifizieren, kommt ein blöder Spruch nach dem anderen. Sämtliche Informationen zu diesem Thema kommen meist durch verunglimpfende Medienberichte, die Klischees erfüllen und belustigen sollen.«
2. »Die Verwundbarkeit der modernen Infrastruktur« – Soziale Verantwortung und radikaler Individualismus
Zum Teil hat die Corona-Krise etwas daran geändert, wie der Prepper in der Öffentlichkeit gesehen wird. Denn als das Virus auch in Deutschland um sich griff und die Behörden weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängten, waren es eben nicht die Prepper, die Hamsterkäufe tätigten und sich in den Supermarktgängen mit anderen Kunden um die letzte Packung Klopapier stritten. Deren Lager waren bereits voll.
In diesen Tagen zeigte sich, dass Vorsorge tatsächlich etwas mit Verantwortung zu tun hat. »Die Panikkäufe waren für mich ein Anzeichen dafür, dass viele Menschen sich nicht vorbereitet haben«, sagt der Berliner Prepper Benjamin Arlet. »Wenn man sich gedanklich schon einmal mit einer Situation befasst hat, dann überrascht sie einen nicht.«
Die Krisenszenarien der Prepper mögen auf die nicht-preppende Mehrheit überspannt wirken. Prepper dagegen halten es für blauäugig und sogar fahrlässig, sich nicht mit diesen Fragen zu befassen, und da ist etwas dran: Krisen sind Situationen, in denen es auf kollektive Solidarität ankommt, auch das hat die Corona-Krise deutlich gemacht. Aber ein gesellschaftliches Miteinander funktioniert in Notlagen nicht ohne individuelle Verantwortung: Wer schwächeren, älteren, Risikogruppen angehörenden Nachbarn helfen will, kann das nur tun, wenn er sich nicht mit den eigenen akuten Notlagen herumschlagen muss – oder gar selbst mit Panikkäufen dazu beiträgt, dass alte Menschen vor leeren Supermarktregalen stehen.
»Ich weiß nicht, warum die Leute so viel Klopapier kaufen – wenn Sie nichts zu essen haben, kommt hinten nichts raus«, sagt ein bayrischer Prepper, der nur seinen Vornamen angibt: Stefan befasst sich auf dem in der Szene sehr populären YouTube-Kanal »Outdoor Chiemgau« mit Themen wie Survival und Prepping und engagiert sich ehrenamtlich als Helfer beim Technischen Hilfswerk. Würde sich jeder zumindest für zehn Tage aus seinen Vorräten selbst versorgen können, dann wären die meisten Krisen gar nicht erst zu einem logistischen Chaos ausgeartet, sagt er: »Wenn die Leute nicht den Hilfskräften auf den Keks gingen, weil sie für sich und ihre Kinder nix zu essen haben, dann müssten wir uns nur um Unfälle oder ältere Menschen kümmern, die alleine nicht zurechtkommen.«
Prepper verweisen gerne darauf, dass sie gar nicht viel anderes tun, als die Ratschläge der Regierung zu befolgen. Tatsächlich empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jedem Bürger, Lebensmittel und Trinkwasser für zehn Tage vorzuhalten. So ist es in dem aktualisierten Zivilschutzkonzept vorgesehen, das das Bundesinnenministerium im August 2016 vorgestellt hat. Dieses soll dafür sorgen, dass die Bevölkerung zum Selbstschutz fähig ist, bevor staatliche Maßnahmen anlaufen. »Die wachsende Verwundbarkeit der modernen Infrastruktur und die Ressourcenabhängigkeit bieten vielfältige Angriffspunkte«, zitierte die Bild5-Zeitung aus dem Dokument.
Im Grunde hatte das Ministerium nicht mehr getan, als ein jahrzehntealtes Konzept zu überarbeiten. Trotzdem sorgte die Nachricht im Sommer 2016 für Aufregung, weil Zivilschutz rund 30 Jahre lang kein Thema mehr gewesen war. Nun aber forderte die Regierung die Bevölkerung erstmals seit Ende des Kalten Krieges wieder auf, Notvorräte anzulegen. Das 69-Seiten-Papier ist umfangreich und sehr konkret. Es nennt nicht nur Nahrungsreserven, sondern auch eine Hausapotheke, Kerzen, Decken und Bargeldreserven. Zwar hält das Bundesamt einen »Angriff auf das Territorium Deutschlands, der eine konventionelle Landesverteidigung erfordert«, für unwahrscheinlich. Sinnvoll sei aber, »sich auf eine solche, für die Zukunft nicht grundsätzlich auszuschließende existenzbedrohende Entwicklung angemessen vorzubereiten«.
Wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, war das Konzept »keine Reaktion auf die jüngsten Attentate in Würzburg und Ansbach oder auf die derzeitige Flüchtlingssituation«. Vielmehr seien die Anschläge am 11. September 2001 und das Elbhochwasser 2002 der Anlass gewesen.6
Ayn Rand und der »rationale Eigennutz«
Längst nicht alle Prepper sind Vorbilder für ein verantwortungsvolles Miteinander. In Teilen der Szene geht es um das genaue Gegenteil: die Auflösung des Sozialvertrags. An die Stelle von Zivilgesellschaft, sozialer Sicherung und gegenseitiger Hilfe schiebt sich der Einzelne, der sich nur um sich und seine Kernfamilie kümmert – oder sich als Teil einer Kleingruppe dem Überlebenskampf stellt, in der aber auch nur die willkommen sind, die etwas Nützliches beizutragen haben.
In der Autarkie und der krisenbereiten Robustheit vieler Prepper spiegelt sich ein radikaler Individualismus, der auch in Ayn Rands Opus magnum »Atlas Shrugged« den Ton vorgibt. Das 1957 erschiene Buch gilt als Standardwerk der libertären Rechten in den USA. Und auch, wenn es in dem Roman nicht um das Preppen im engeren Sinne geht, liefert er mit seiner Idee des »rationalen Eigennutzes« der Szene bis heute direkte oder indirekte Inspiration.
Die 1200 Seiten entfalten ein recht krudes Plädoyer für einen knallharten Laissez-faire-Kapitalismus: Eine Gruppe von Industriellen setzt sich gegen korrupte Regierungen zur Wehr, die ihre Minen und Fabriken enteignen und verstaatlichen wollen. Die kleine Elite tritt in Streik – und vernichtet damit die gesamte amerikanische Infrastruktur. Das Land versinkt in Elend, Chaos und Dunkelheit, ehe ein Neuanfang möglich wird – mit einem Gemeinwesen, das sich auf Egoismus stützt. Das Buch endet mit einem Bekenntnis, das als Programm verstanden werden kann: »Ich schwöre bei meinem Leben und bei meiner Liebe zu ihm: Ich werde nie für andere leben, noch werde ich von anderen erwarten, dass sie es für mich tun.«
Es gibt Prepper, bei denen die individuelle Vorsorge ins Anti-Soziale kippt und mit einer faschistischen, nihilistischen Ideologie einhergeht. Wenn die Krise die bestehende Ordnung annihiliert, öffnet sie auch gedanklichen Spielraum für sozialdarwinistische Fantasien von Größenwahn, Gewalt und Dominanz, kurz gesagt: »Gesetz des Dschungels« statt demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Eine wachsende Weltuntergangsindustrie bedient solche Vorstellungen vom Überlebenskampf mit teurem Notfall-Equipment und dazu passenden Trainingskursen von zweifelhaftem Nutzwert.
Rechtsextremismus kann dabei eine Rolle spielen. Häufiger bewegt sich die Einstellung irgendwo zwischen Libertarismus und Ökologie. Auf der einen Seite ist die Freiheit des Individuums für Prepper oft Maßgabe des Handelns; sie wollen ihre eigenen Spielregeln festlegen, unabhängig von Eingriffen des Staates, von dem sie ohnehin kaum etwas erwarten, jedenfalls nichts Gutes. Auf der anderen Seite legen viele von ihnen Wert auf gesundes Essen, regionale Kost und Produkte, die frei sind von Gentechnik, chemischen Unkrautgiften und synthetischen Düngemitteln. Deshalb ist Krisenvorsorge oft mit Konzepten wie Selbstversorgung, Slogans wie »zurück zur Natur« und Aussteigertum verknüpft, die auch Linke anziehen.
Die Wald-Planspiele einiger Prepper erinnern an einen weiteren Vordenker des kompromisslosen Individualismus, Henry James Thoreau, der mit »Walden« so etwas wie der geistige Vater aller Aussteiger und naturschwärmenden Gesellschaftskritiker wurde: Der Autor zog sich am 4. Juli 1845 in die Einsamkeit der Wälder Nordenglands zurück. Am Walden-See probte Thoreau das Leben fernab der Zivilisation im Einklang mit der Natur. Zwei Jahre dauerte der Selbstversuch, und sein Bericht darüber wurde zum Kultbuch.
Thoreau strebte nach Einfachheit und einer robusten Lebensfreude, die im Wald am intensivsten spürbar wird. Er wollte sich auf das Wesentliche besinnen, alles Überflüssige hinter sich lassen, die Einschränkungen der Zivilisation abstreifen. In »Walden« schreibt er: »Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. (…) Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde.«
3. Bug-in, Bug-out: Begriffe und Definitionen
Es gibt keine Erhebungen dazu, wie viele Menschen sich in Deutschland auf einen Krisenfall vorbereiten, aber es gibt Anzeichen dafür, dass das Interesse zunimmt, eins davon sind die steigenden Zahlen von Prepperkanälen auf YouTube und Preppergruppen auf Facebook, die sich in den vergangenen Jahren massiv ausgebreitet haben: Allein auf Facebook findet man auf Anhieb ein halbes Dutzend Gruppen mit jeweils 3000 bis 10000 Mitgliedern, Tendenz steigend. Auf YouTube hat ein Prepping-Influencer wie Survival Mattin 602000 Abonnenten, der Magdeburger Szene-Star Fritz Meinecke kommt sogar auf mehr als eine Million.
Hinzu kommt eine schwirrende Vielfalt von ständig neuen Webshops für Notfallausrüstung, Wasserfilter, Nahrung; die Krise bietet viele wirtschaftliche Perspektiven. Auch die Zahl der Survival- und Preppingkursveranstalter steigt ständig. Wichtig ist dabei, im Kopf zu behalten, dass das kommerzielle Angebot nicht unbedingt den Bedürfnissen von Preppern entspricht und viele auch bewusst gerade kein Teil der Konsumgesellschaft sein wollen. Richard Mitchell schreibt in »Dancing at Armageddon«: »Im Herzen des wirtschaftlichen Handelns zu stehen und respektierten Einfluss in der Welt der Dinge zu haben, ist ein Ideal der Survivalisten. Ein stummer Konsument zu sein, abhängig von einem monolithischen System, das von anderen gelenkt und begrenzt wird, ist ihnen ein Gräuel.«
Sehr oft distanzieren sich Prepper verächtlich von der Masse der Menschen, die das Mehr, Mehr, Mehr des globalisierten Kapitalismus unhinterfragt mitmachen und ihr komfortables Leben in der Wohlstandsgesellschaft für eine Gewissheit halten. Hier allerdings ein Warnhinweis: Es ist schwer, generelle Aussagen über Prepper zu treffen – gerade diejenigen, die vom Stereotyp abweichen, verhalten sich häufig still; lautstarke Wortmeldungen kommen eher von denjenigen, die radikale Meinungen vertreten.
Zwischen den einzelnen Akteuren gibt es oft keine Verbindung, auch vom Typus und von der Methodik her unterscheiden sie sich stark. Darunter sind Heimwerker, Naturliebhaber, Gartenfreunde, Outdoor-Sportler, Menschen also, die ein ganz normales Leben führen und das Preppen als eine Art Hobby betreiben. Am anderen Ende des Spektrums stehen Prepper, die ihr ganzes Leben an den Zielen der Krisenvorsorge ausrichten und sich zwanghaft mit Untergangsszenarien befassen. Welche Vorkehrungen zu treffen sind, hängt davon ab, welche Art von Katastrophe erwartet wird. Die Methoden sind vielfältig: Die meisten legen Lager mit Notvorräten an, einige trainieren Kampfsportarten oder besorgen sich Waffen, manche haben sich in ländliche Gebiete zurückgezogen oder zumindest einen Zufluchtsort auf dem Land eingerichtet – Retreater heißt dieser Vorsorge-Typus in den USA.
Da das Phänomen aus Amerika stammt, sind Anglizismen und militärische Abkürzungen verbreitet: Es gibt Bug-in-Prepper, die ihre Häuser mit Schutzräumen sowie verstärkten Sicherheitsvorrichtungen zu abwehrbereiten Festungen aufrüsten und Bug-out-Spezialisten, die sich darauf vorbereiten, im Ernstfall die Stadt zu verlassen, um draußen in der freien Natur zu überleben.
Shelter-Bau im Wald – eine Unterkunft aus Ästen, Blättern und Moos
Hier überlappen sich die Begriffe Prepper und Survivalist. Eine genaue Abgrenzung ist nicht möglich, auch kursieren durchaus widersprüchliche Definitionen. Generell kann man sagen, dass Survival ein Set von Fähigkeiten bezeichnet, das dem Menschen ermöglicht, sich in Not- oder Krisensituationen allein in der Wildnis durchzuschlagen.
Der Survivalist trainiert dafür, im Ernstfall ohne Hilfsmittel überleben zu können; er zündet das Feuer mit Feuersteinen an, schnitzt sich aus einem Ast ein Essbesteck und baut sich für die Nacht einen Unterschlupf aus Blättern und Zweigen. Er weiß, wie man jagt, Tiere ausnimmt und zubereitet, welche Beeren essbar sind und wie er seine Spuren verwischt, um Verfolger abzuschütteln. Dabei wiederum gibt es Schnittmengen mit den sogenannten Bushcraftern, die tage- oder wochenlange Ausflüge in die Natur möglichst ohne Ausrüstung unternehmen. Ihnen geht es vor allem um das Abenteuer und die Naturerfahrung, um die Rückbesinnung auf Urinstinkte, Urfertigkeiten und die Unabhängigkeit vom Luxus der Zivilisation.
»Allseitiges Pandämonium«
Survivalisten und Bushcrafter wenden dieselben Techniken an, sie unterscheiden sich mehr in ihren Zielen, wie Ronny Schmidt, der Survivaltrainer aus Thüringen sagt: »Der Bushcrafter will in den Wald rein. Der Survivalist will raus.« Anders ausgedrückt: Der Bushcrafter sucht die unmittelbare Naturerfahrung, er will sich in der Wildnis bewehren und Abstand zur Zivilisation gewinnen. Der Survivalist dagegen schlägt sich aus Notwendigkeit in den Wald, er will darin überleben und wendet dabei Bushcraft-Techniken an, aber er ist aufgrund einer Notlage dort, nicht weil ihn der Ruf der Natur ereilt hat.
Längst nicht jeder Bushcrafter bereitet sich auf Krisen vor, längst nicht jeder Prepper will im Ernstfall in den Wald fliehen. Aber viele eignen sich zur Vorbereitung Survival-Fertigkeiten an. Und oft sind Survivalisten nicht nur eine Art erwachsene Pfadfinder, sondern sorgen auch vor; viele Survival-Kursanbieter haben zugleich Prepping-Schulungen im Programm. Die Inhalte sind ähnlich, nur die Zielgruppe etwas anders.
Es gibt aber auch Prepper, die grundlegende Unterschiede sehen; in einer Gruppe auf Telegram zum Beispiel rät ein Mitglied den anderen von Survival-Trainings ab, »da wir Prepper anders als Survivalisten im Vorhinein Ausrüstung wie Messer und Co. bevorraten und nicht Feuersteine etc. suchen, um uns aus den gebrochenen Stücken ein Messer zu basteln. Außerdem ist Shelter-Bau mit Lagerfeuer und Steinkreis im Wald nicht im Sinne des Preppers, der unentdeckt bleiben will«.
In den USA dagegen werden beide Gruppen gemeinhin als Subspezies derselben Art gesehen, manche verwenden die Begriffe »Prepper« und »Survivalist« synonym. Meist aber betrachtet man dort Prepper eher als diejenigen, die sich mit Vorratslagern und Bunkern auf die Krise vorbereiten und Survivalisten als die in aller Regel bewaffneten Überlebenskämpfer, die im Wald für die Endzeit trainieren.
Feuer machen, Kochen über der Feuerstelle – Survivalisten üben das Überleben in der Wildnis
Der amerikanische Autor David Black sieht die Unterschiede in der Schwere der erwarteten Krise. In seinem Buch »Survival Retreats« spricht er bei Preppern von »Individuen oder Gruppen, die sich aktiv für kleinere oder mittlere Störungen der öffentlichen Versorgung aufgrund von Katastrophen oder nationalen Notfällen vorbereiten, die von kurzen Störungen der politischen und sozialen Ordnung begleitet sein könnten.« Prepper misstrauten der Regierung, glaubten aber an die Haltbarkeit der Gemeinschaft und den Bestand der Technologie. Survivalisten dagegen definiert Black als »eine Bewegung von Individuen oder Gruppen, die sich aktiv auf apokalyptische Katastrophen vorbereiten, seien sie menschengemacht oder natürlich, die in einen vollständigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollaps« führen »und in allseitigem Pandämonium und Chaos enden«.
4. Heuschrecken aus der Unterwelt – die Apokalypse als Ende der westlichen Zivilisation
Die Art des Preppens, um die es in diesem Buch geht, ist ein relativ neues Phänomen. Vorbereitung auf katastrophische Ereignisse aber ist eine Tradition, die praktisch so alt ist wie die Menschheit. Schon die Johannes-Offenbarung in der Bibel beschreibt, wie es mit der Welt auf schreckliche Art zu Ende gehen werde: Blut und Feuer regnen vom Himmel, Sterne stürzen ins Wasser, Heuschreckenschwärme steigen aus der Unterwelt auf und fallen über die Welt her. Wenn alle Plagen ihr Werk vollendet haben, ist die Zeit für die zweite Wiederkunft Jesu gekommen, und der letzte Kampf zwischen Gut und Böse nimmt seinen Lauf; danach entsteht das Himmelreich, in dem die Gläubigen ein ewiges Leben erwartet. Praktische Vorbereitungen erwähnt der Prophet in der Offenbarung nicht. Die einzig probate Form des Preppens ist hier fromme Einkehr. Einlass zum Reich Gottes und damit zum ewigen Leben wird nur einer auserwählten Schar von besonders standhaften Gläubigen gewährt.
Seit mindestens zwei Jahrtausenden gehen die Menschen im Westen davon aus, dass der Weltuntergang jeder Zeit kommen kann, wie es die Bibel vorhersagt. Auch die islamische Welt und das Judentum kennen apokalyptische Erzählungen, die nordische Mythologie hat mit Ragnarök ihre Entsprechung. Immer wieder wurden Epidemien, Kriege oder Naturkatastrophen als Vorboten der Apokalypse gedeutet; im Christentum gilt das Weltende zugleich als Schreckensszenario und als Hoffnung auf Erlösung. Eine Fülle von Weltuntergangssekten hat mit der Ankündigung, die Endzeit habe begonnen, Anhänger um sich geschart. Zahllose selbsternannte Propheten haben Omen interpretiert und einen konkreten Zeitplan für die Ereignisse der Offenbarung aufgestellt. Für die Mormonen zum Beispiel gehört die praktische Vorbereitung auf die Apokalypse zur Glaubenspraxis. Die mit 16 Millionen Mitgliedern extrem einflussreiche »Kirche Jesu Christi der Heiligen Letzten Tage« hat sogar ein Infoblatt mit Tipps und Hinweisen zur Vorratshaltung herausgegeben und empfiehlt ihren Anhängern das Vorhalten einer Notreserve für mindestens drei Monate. In der »Doktrin und Glaubenspraxis« der Mormonen heißt es: »Wir legen den Mitgliedern der Kirche in aller Welt ans Herz, für Notzeiten vorzusorgen, indem sie einen Grundvorrat an Lebensmitteln und Wasser anlegen und etwas Geld sparen. Wir bitten Sie, weise vorzugehen [und] es nicht [zu übertreiben].«7
Aber die Apokalypse ist nicht nur biblisches Motiv, sondern auch wissenschaftliches Szenario: Schon Anfang der siebziger Jahre haben Wissenschaftler für den »Club of Rome« anhand von Systemanalyse und Computersimulationen durchgerechnet, wie sich die Wachstumsraten der Bevölkerung, die Industrialisierung und die Ausbeutung der Rohstoffreserven auswirken werden. Ihr Bericht »Die Grenzen des Wachstums« schließt mit einer unheilvollen Warnung: »Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unvermindert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.«
Überall Katastrophen
Viele Schreckensszenarien, die von der Wissenschaft prognostiziert wurden, sind Wirklichkeit geworden. Die Erkenntnis, dass das Wachstum Grenzen hat, ist längst keine Minderheitsmeinung mehr. Spätestens seit die Schülerbewegung »Fridays For Future« weltweit Hunderttausende auf die Straßen brachte, ist der Klimawandel ein Thema, an dem auch die Politik nicht mehr vorbeikommt. Reale Ereignisse scheinen dem bisweilen apokalyptischen Tonfall der Aktivisten recht zu geben: In Europa vertrocknen die Wälder infolge mehrerer Rekordhitzesommer, in Australien brennt der Busch, am Amazonas geht der Regenwald in Flammen auf, Wirbelstürme verwüsten die Küstenregionen in den USA, in der Arktis verhungern die Eisbären, das tauende Eis der Permafrostböden setzt schlafende Krankheitserreger frei. Bis 2040 soll es laut Greenpeace bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlinge geben.8
Es hat auch mit der Logik der Medien zu tun, dass sich der Eindruck einstellt, die Welt rotiere in einem ständigen, hochtourig laufenden Krisenmodus. Die Finanzkrise (2007), die Flüchtlingskrise (2015) und die Corona-Krise (2020) sind Beispiele dafür. Zugleich werden kleinere Störungen und Unfälle zur Katastrophe hochgejazzt. Wer die aktuellen Schlagzeilen googelt, stößt gleich auf mehrere Dutzend aktuelle Katastrophen: Ein brennender Öltanker vor Sri Lanka könnte die »größte Öko-Katastrophe seit Jahrzehnten« auslösen, in Belgien droht bei der Regierungsbildung eine »Katastrophe für Flandern«, und in Niedersachsen warnt der dortige Energie- und Umweltminister aufgrund der auslaufenden Förderung für die Windkraft: »Wir steuern auf eine Katastrophe zu.«9
Prepper ziehen Inspiration, Argumente und Beispiele für ihre Szenarien aus Medienberichten und wissenschaftlichen Studien. Die unvorbereitete Mehrheit hält das Sperrfeuer der Krisenmeldungen aus, indem sie die Risiken ausblendet. Katastrophen wirken unvorstellbar, bevor sie sich ereignen, und historisch-abstrakt, nachdem sie vorübergezogen sind. Anders ist dies für die junge Generation, die den Klimawandel als akute Bedrohung begreift.
5. In Erwartung der Klimakatastrophe: Der Doomer
Der zornige Elan der »Fridays For Future«-Bewegung ist eine Reaktion auf die Entwicklungen, eine andere ist depressive Lethargie. In den US-Medien kam ab 2019 ein weiterer Begriff auf, der Menschen mit dieser resignierten Art von Weltuntergangsstimmung bezeichnet: Der »Doomer« glaubt, dass ökologischer Raubbau, Überbevölkerung, Klimawandel und Umweltverschmutzung zu einem Zusammenbruch der Zivilisation führen werden, der mit Massensterben oder gar dem Aussterben der menschlichen Rasse einhergeht.
Der Begriff wurde populär, nachdem Jonathan Franzen am 8. September 2019 im New Yorker sein Essay »What If We Stopped Pretending«10 veröffentlicht hatte. Darin schreibt er, dass der Klimawandel praktisch nicht mehr kontrollierbar, die Apokalypse nicht mehr aufzuhalten sei: »Der Krieg gegen den Klimawandel war nur so lange sinnvoll, wie er zu gewinnen war«, schreibt Franzen. Diese Phase sei nun aber vorbei, und andere Arten von Handlungen relevant, praktische Vorbereitung auf Brände, Überflutungen und Flüchtlinge zum Beispiel.
Zusätzlich gewönnen »weltverbessernde Handlungen« an Bedeutung: »In Zeiten des zunehmenden Chaos suchen die Leute eher Schutz in Stammesdenken und bewaffneter Gewalt als in der Rechtsstaatlichkeit, und unsere beste Verteidigung gegen diese Art von Dystopie ist der Erhalt funktionierender Demokratien, funktionierender Rechtssysteme, funktionierender Gemeinschaften.«
Der depressive Doomer, ein Gegenbild zum kraftstrotzenden, von Anspruchsdenken bestimmten »Boomer«; er hat auch eigene Memes. Die Bilder erschienen zunächst auf der Plattform 4chan, eines zeigt einen jungen Mann mit Beanie-Mütze und Zigarette. Das weibliche Pendant, das seit Januar 2020 auf Reddit und Tumblr kursiert, »Doomer Girl«, ist ein schwarzhaariges Mädchen mit großen, seelenvollen Augen. Man könnte die pessimistische Klima-Malaise der Doomer also auch als aktuelle Version von Teenage Angst deuten: Doomer glauben, dass sich politische Korruption, gesellschaftliche Gleichgültigkeit und strukturelle Ungerechtigkeit nicht beheben lassen. Politisch festgelegt sind sie dabei nicht: Es gibt sie sowohl im extrem rechten als auch im extrem linken Teil des Spektrums und überall dazwischen.
Auch der britische Nachhaltigkeitsforscher Jem Bendell geht in seinem Essay »Deep Adaptation, A Map for Navigating Climate Tragedy« davon aus, dass der Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation infolge des Klimawandels unausweichlich ist; innerhalb von nur zehn Jahren sei damit zu rechnen.11 Der Artikel von Juli 2018 wurde mehr als eine halbe Million Mal heruntergeladen und ist der BBC zufolge »das, was einem Manifest für eine Generation selbsternannter ›Klima-Doomer‹ am nächsten kommt«12.
Da die Katastrophe gewiss ist, sei Bendell zufolge der einzig gangbare Weg die »Tiefenadaptation«. Dazu gehören: »Resilienz« durch einen Ausbau der Infrastruktur, »Verzicht«, also das Aufgeben derAspekte, die den Klimawandel befördern, und »Wiederherstellung«, die Rückkehr zu alten kulturellen Werten und Praktiken.
Die heftige Kritik anerkannter Klimaforscher an Bendells Theorien tat der viralen Verbreitung keinen Abbruch; infolge der Veröffentlichung bildete sich eine regelrechte Tiefenadaptions-Bewegung, deren Facebook-Seite mehr als 10000 Mitglieder hat, mit Ablegern in gut einem Dutzend Länder. Bei Experten mag der Text heftig umstritten sein, doch womöglich erreichte er seine Wirkung gerade wegen seiner drastischen Formulierungen: »Du wirst unterernährt sein. Du wirst nicht wissen, ob du bleiben oder gehen willst. Du wirst fürchten, gewaltsam getötet zu werden, bevor du verhungerst.« Angesichts dieser brutalen Sätze hat der Essay tatsächlich mehr mit Debatten in militanten Preppergruppen gemein als mit wissenschaftlichen Texten.
Manche Medien nutzen das Wort »Doomer« inzwischen inakkurat als Anglizismus für militante Tag-X-Nazis; auch manche Prepper distanzieren sich vom rechtsextremen Milieu, indem sie von »Doomern« sprechen. All das sorgt in der Szene für bitteren Spott: »Irgendwie haben es die Mainstreammedien mal wieder fantastisch hinbekommen und ein Wort medial auf das Negativste überhaupt geprägt«, schreibt Sebastian Hein. »Fälschlicherweise wird dieses Wort ›Doomer‹ in der Prepper-Szene auch von Unwissenden verwendet, um genau dieses Klischee zu erfüllen und zu bestärken.«
Die Realität ist komplizierter. Fakt ist, dass die Szene alle möglichen Strömungen bündelt. Bei den Vorbereitungen auf den Ernstfall schwingt vielfach eine mal mehr, mal weniger kaschierte Katastrophenlust mit. Die imaginierten Krisen und auch die hypothetische eigene Rolle sind überzogen vom matten Schimmer der Verklärung: im Einklang mit der Natur leben, mit maximalem Sicherheitsabstand von Formfleisch, Fastfood-Ketten, digitalisierter Arbeitswelt und flexiblen Genderidentitäten. Das kann man Aussteigerromantik nennen. Oder antimodern. Dem postheroischen Mann stellt sich hier ein archaisches Kriegerbild entgegen; toxic masculinity und white fragility haben in der Endzeit keinen Platz.
»Es gibt Leute, die in unserer Gesellschaft nicht zu Rande kommen und sich als Opfer fühlen«, sagt der Betreiber eines Prepperforums. »Manche denken, dass das Leben nach der Krise einfacher wird, weil sie sich nehmen können, was sie schon immer haben wollten.« Oft kreisen die Planungen und Probetrainings um den »Break-out«, den Ausbruch, also den Moment, in dem sie sich von der Zivilisation in die Wildnis schlagen. Damit öffnet die Krisenvorsorge auch einen Fluchtweg aus der Komplexität der wirklichen Welt: Das eigene Land beackern, als Jäger und Sammler durch die Wälder ziehen – die Welt im Griff haben. So reduziert sich die Vielfalt der globalisierten Welt auf den Einzelnen und die Seinen. Die Fülle der Wahlmöglichkeiten schnurrt auf die Überlebensfrage zusammen.
4 TAB beim Bundestag: https://tinyurl.com/l7lg5ma
5 T-Online: https://tinyurl.com/y94wym5r
6 Süddeutsche Zeitung: https://tinyurl.com/y6uf9bn6
7 Kirche Jesu Christi: https://tinyurl.com/yblser2t
8 Greenpeace: https://tinyurl.com/yyvjeg7d
9 Handelsblatt: https://tinyurl.com/y9346sxz
10 New Yorker: https://tinyurl.com/y4metm73
11 Lifeworth: https://tinyurl.com/ya6lxow7
12 BBC: https://tinyurl.com/ybrxp8q3