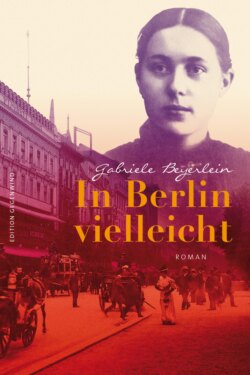Читать книгу In Berlin vielleicht - Gabriele Beyerlein - Страница 5
KAPITEL 2
ОглавлениеLene kleckste etwas Schmierseife auf den Fußboden, streute Sand darüber, tauchte die Wurzelbürste in den Zinkeimer mit heißem Wasser und scheuerte weiter. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ihre Gelenke taten vom langen Knien schon weh. Aber sie hatte gerade erst die Hälfte des Flures geschafft. Hell glänzten die rohen Holzdielen, wo Lene sie schon gescheuert und gewischt hatte. Grau und stumpf sahen sie aus, wo sie erst noch bearbeitet werden mussten. Morgen, wenn sie nach der Prüfung nach Hause kamen, sollte alles festlich und sauber aussehen, hatte die Frau Lehrer gesagt. Und nun buk sie sogar noch einen Kuchen! Und fragte Lene bei der Arbeit ab! Als ob Lene ihre Tochter wäre.
„Der dreiundzwanzigste Psalm!“, rief die Frau Lehrer aus der Küche.
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“, antwortete Lene und leierte im Rhythmus ihrer Bewegungen weiter: „Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser ...“
„Der hundertste Psalm!“
„Jauchzet dem Herrn alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden“, sagte Lene auf und scheuerte und wischte und scheuerte und wischte. Dann endlich schüttete sie das Schmutzwasser vor die Haustür, pumpte am Brunnen vor dem Schulhaus sauberes Wasser in den Putzeimer, goss in der Küche kochendes aus dem Kessel dazu, ging noch einmal zum Frischwasserholen an den Brunnen, füllte den Kessel nach und stellte ihn wieder auf den Dreifuß über die Glut. Die Frau Lehrer nickte ihr anerkennend zu. Lene lächelte. Eine Arbeit von selber zu machen, weil man wusste, dass sie nötig und an der Reihe war, das war besser, als immer nur Befehlen gehorchen zu müssen. Und die Anerkennung der Frau Lehrer tat gut. Da wusste man doch, wofür man sich plagte!
Lene kehrte zum Scheuern in den Flur zurück. „Der dreiundsiebzigste Psalm, Vers dreiundzwanzig bis sechsundzwanzig!“, rief die Frau Lehrer hinter ihr her.
„Dennoch bleibe ich stets bei dir“, begann Lene und griff nach der Bürste.
Sechs Psalmen, fünf Gesangbuchlieder mit allen Versen — sogar die zwölf Verse von „Befiehl du deine Wege“ — und das Glaubensbekenntnis mit Auslegung, dann war der Flur sauber. Und Lene war nicht ein einziges Mal stecken geblieben. Wenn die Mutter doch zur Prüfung kam, dann würde sie schon sehen, dass sie sich für ihre Tochter nicht zu schämen brauchte! Und der Herr Lehrer musste sich auch nicht schämen, dass er Lene Schindacker in sein Haus aufgenommen hatte.
Sie stand mit schmerzenden Beinen auf, nahm den Eimer und leerte ihn draußen. Auf dem Dorfplatz spielten die Lehrerkinder mit ein paar anderen Kindern Murmeln. Eine Weile sah Lene zu. Murmeln hätte sie als Kind auch gern gespielt, aber nie welche gehabt, und wer keine hatte, konnte nicht mitspielen und keine dazugewinnen, so war das nun mal. Und mit fünf Jahren war es mit dem Spielen sowieso vorbei gewesen.
Sie erinnerte sich an ihren fünften Geburtstag, als wäre es gestern gewesen. Schweigend wie immer war das Mittagessen verlaufen, denn nur der Bauer durfte bei Tisch ein Gespräch anfangen, und das tat er so gut wie nie. Aber als er den letzten Bissen aufgegessen und Messer und Gabel am Kittel abgewischt hatte, hatte er gesagt: Die Lene ist heute fünf geworden! Vor Schreck war ihr die trockene Kartoffel im Hals stecken geblieben. Der Bauer redete von ihr! Zeit, dass sie was arbeitet für ihr Brot!, hatte der Bauer weitergesprochen. Lene, von morgen an hütest du die Gänse! Und eines sag ich dir, wenn dir eine entwischt und ins Haferfeld läuft, dann geht's dir schlecht! Und wenn dir eine auf den Bahndamm läuft und vom Zug überfahren wird, dann traust du dich am besten gar nicht mehr nach Hause! Ist das klar?!
Es war sehr klar gewesen. Und so war sie am nächsten Morgen einer Schar schnatternder Gänse ausgeliefert worden, die nicht im Geringsten von ihren Befehlen beeindruckt gewesen waren, und einem bösartigen Ganter, der fast so groß war wie sie selbst und dessen Bisse höllisch wehtaten. Wenn nicht Lenes Patin, die Altbäuerin, gewesen wäre, die an den ersten Tagen mit ihr die Gänse auf die Weide getrieben und ihr gezeigt hatte, wie man sich mit der Rute bei den Gänsen und sogar bei dem Ganter Respekt verschaffen konnte ...
Nein, es war keine Gans überfahren worden, aber ins Haferfeld ausgebüxt waren sie mehr als einmal, und sie da wieder rauszubekommen, das ging nicht, ohne hinterherzulaufen und damit Halme niederzutreten, und wenn der Siewer-Bauer das gemerkt hatte, so war es immer auf eine Tracht Prügel hinausgelaufen. Der Siewer-Bauer machte keine leeren Drohungen.
Wenn er wenigstens der Vater gewesen wäre. Bei einem richtigen Vater, da war es etwas anderes. Der Herr Lehrer war manchmal auch streng mit seinen Kindern, wenn es eben sein musste, aber er liebte sie trotzdem, das merkte man. Doch bei einem Bauern, der einem seinen Namen nicht gab und bei dem man im Kuhstall schlafen musste ...
Morgen, bei der Prüfung, würde er sehen, dass trotzdem etwas aus ihr geworden war. Wenn es ihn überhaupt etwas anging.
„Beate!“, riss dicht hinter ihr eine Stimme Lene aus ihren Gedanken. Die Frau Lehrer war herausgekommen und stand nun neben ihr in der Schulhaustür. „Komm rein!“, rief sie erneut nach ihrer Tochter. „Du musst noch Klavier üben!“
Beate, die eben eine ganze Hand voll bunter Murmeln gewonnen hatte, sah auf und verzog das Gesicht. „Ich will noch draußen bleiben!“
„Mag schon sein!“, erwiderte die Frau Lehrer gelassen. „Aber du musst üben! Du weißt, dass dein Vater sehr ärgerlich wird, wenn du dein neues Stück nicht kannst! Also rein mit dir!“
Beate maulte, erhob sich betont widerwillig und kam auf ihre Mutter und Lene mit einem missmutigen „Immer dieses blöde Üben!“ zu.
„Freu dich doch, dass du Klavierspielen lernen darfst!“, fuhr Lene das Mädchen an. „Andere wären froh drum!“ Sie erschrak über ihre eigene Heftigkeit.
„Du weißt ja nicht, wie langweilig das ist!“, antwortete Beate patzig. „Du musst es ja nicht!“
Lene presste die Lippen zusammen. Was Beate da sagte, tat so weh, dass sie hätte schreien mögen oder sogar dreinschlagen. Aber die Kleine konnte ja nichts dafür. Sie ahnte nicht, dass Lene keinen größeren Wunsch gehabt hätte, als vom Herrn Lehrer Klavierunterricht zu bekommen. Und es nie gesagt hatte. Weil ihr so was nicht zustand. Weil sie sich ihr Brot verdienen musste und eben nur das Dienstmädchen war und nicht die Tochter.
„Nun ist aber genug, Beate!“, erklärte die Frau Lehrer sehr bestimmt und sah dem Mädchen kopfschüttelnd nach, wie es im Schulhaus verschwand. „Sag mal“, wandte sie sich dann an Lene, „hast du dir schon Gedanken gemacht, wohin du in Stellung gehen willst, wenn du mit der Schule fertig bist?“
Lene starrte die Frau Lehrer an. Auf einmal war ihr, als wanke der Boden unter ihr. „Was, wohin?“, stotterte sie. „Aber wieso — ich, ich dachte, ich bleib — kann ich denn nicht bei Ihnen bleiben? Bin ich denn — ich dachte — sind Sie denn nicht zufrieden mit mir?“ Heiß stieg ihr die Angst auf: Hatte die Frau Lehrer vielleicht etwas von ihren Träumen gemerkt und wollte sie deswegen los sein? Oder wusste es gar der Herr Lehrer selbst?!
„Ach, Lene!“ Die Frau Lehrer legte ihr die Hand auf die Schulter. „Natürlich sind wir zufrieden mit dir, das weißt du doch, so fleißig und anstellig, wie du bist! Du bist mir ans Herz gewachsen fast wie mein eigen Kind, und meinem Mann auch, das weiß ich, das darf ich so sagen. Und ich gebe dir auch das beste Zeugnis, das ein Mädchen bekommen kann. Aber bleiben — ich kann dir ja keinen Lohn zahlen, Lene. Kein Pfennig bleibt mir übrig am Monatsende. Es reicht einfach nicht.“
Lene schluckte. Langsam beruhigte sich ihr Herz, standen die Beine wieder sicher. Sie wurde nicht hinausgeworfen. Sie war nicht entlarvt. Es ging nur ums Geld. „Dann bleib ich eben ohne Lohn.“
Die Frau Lehrer schüttelte den Kopf. „Nein, Lene. Das wäre nicht recht. Nicht, nachdem du eingesegnet bist. Solange du noch ein Schulkind bist, ist es etwas anderes. Wir haben dir ein ordentliches Zuhause gegeben und du bist mir zur Hand gegangen, und das hatte so seine Richtigkeit. Aber jetzt bist du vierzehn und musst dir etwas verdienen und etwas zurücklegen. Wenn einmal ein anständiger Bursche kommt, der es gut mit dir meint, wirst du jede Mark brauchen, damit ihr einen Hausstand gründen könnt.“
Lene schwieg. Es stimmte, was die Frau Lehrer da sagte. Wenigstens war es nicht so, dass sie gehen musste, weil man sie nicht mehr haben wollte oder weil man etwas gemerkt hatte. Aber die Familie verlassen müssen, ihn nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr am Abend sein Klavierspiel hören und Lieder mitsingen dürfen, wie sollte sie das überhaupt aushalten? So grau würde alles sein ohne ihn, nein, das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Und auch die Frau Lehrer und die Kinder würden ihr fehlen, wo sie doch gehofft hatte, dazuzugehören, nicht richtig natürlich, aber doch irgendwie ...
„Ich habe gehört, der Lenz-Bauer sucht eine junge Magd!“, fuhr die Frau Lehrer fort. „Dann kannst du im Dorf bleiben.“
„Der Lenz-Bauer?“, fuhr Lene auf. „Nie!“ Der Vater von der Grete — dann würde sie sich von der herumkommandieren lassen müssen und ganz unten an deren Tisch sitzen!
Die Frau Lehrer sah sie verwundert an. „Warum nicht der Lenz-Bauer? Aber wie auch immer, such dir beizeiten was! Du kannst ja auch deine Mutter fragen, vielleicht kommst du auf dem Gut unter, wo sie ist.“
Dann doch lieber der Lenz-Bauer, dachte Lene. Wenn ich nicht mehr beim Herrn Lehrer sein darf, dann ist sowieso alles gleich.
Aus dem Schulhaus drang Beates Klaviergeklimper. So lustlos und stümperhaft die Tasten auch angeschlagen wurden, die Melodie des Volksliedes war doch zu erkennen: „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß ... „
Lene presste die Hände im Schoß zusammen. Hier vorne in der Kirche auf den Stühlen zu sitzen in dem neuen grauen Kleid — und zu wissen, dass die ganze Gemeinde einem im Rücken saß und aufpasste, ob man auch nichts Falsches sagte oder sich falsch benahm!
Dabei war sie sicher, dass sie nichts Falsches sagen würde. Schließlich hatte die Frau Lehrer sie alles abgefragt und sie hatte keinen einzigen Fehler gemacht.
Nein, das war es nicht. Aber hinten in der letzten Reihe saß auf der Frauenseite im Kirchenschiff die Mutter. Sie war gekommen, sie war wirklich gekommen, in einem einfachen schwarzen Kleid mit Schultertuch, denn ihr Festgewand war ja nun aufgetrennt und wartete darauf, für Lene zum Konfirmationskleid umgenäht zu werden.
Lene hatte die Mutter entdeckt, als sie mit den anderen Konfirmanden hinter dem Herrn Pastor in die Kirche eingezogen war. Einen kurzen Blick hatte sie mit der Mutter getauscht, und es kam ihr fast vor, als hätte die Mutter gelächelt. Jetzt musste Lene sich zusammenreißen, damit sie nicht aufstand und sich umdrehte, um noch einmal hinzusehen.
Auf der anderen Seite der Kirche saß der Siewer-Bauer auf dem Platz, auf dem er immer saß.
Selbst mit gesenktem Kopf hatte Lene beim Einzug die Blicke der Leute gespürt, die zwischen dem Siewer-Bauern und der Marie Schindacker hin- und hergingen, Blicke, die sie in ihrem Rücken spürte, seit sie hier vorn saß, Blicke, die sich in ihrem Nacken kreuzten.
Auf einmal wünschte sie, die Mutter wäre nicht gekommen.
„Ich weiß, woran ich glaube“, sang sie mit den anderen Konfirmanden.
Was war nur mit ihrer Stimme los? Sie hatte doch eine gute Singstimme, das sagte der Herr Lehrer immer. Nun schien sie ihr brüchig und heiser. Doch nach und nach gewann sie im Singen Sicherheit. Klarer klang es nun schon: „Ich weiß, was ewig dauert ...“
Drei Verse, dann begann die Prüfung. Der Herr Pastor begann mit den Zehn Geboten. Lene atmete auf: Das war leicht, auch wenn er die Gebote nicht der Reihe nach abfragte. Karl — das neunte Gebot. Grete — das dritte Gebot. Heinrich — das erste Gebot. Alles lief wie am Schnürchen. Dann hörte Lene ihren Namen. Sie stand auf, ohne Angst. „Das sechste Gebot!“, verlangte der Herr Pastor.
Das sechste Gebot.
Auf einmal veränderte sich etwas in der Kirche. Kein Scharren von Füßen mehr, kein Knarren einer Bank, kein Husten. Es war, als hielten alle den Atem an. Die Stille wurde hörbar. Nahm sie nicht etwas Lauerndes an?
Das sechste Gebot.
Die Mutter auf der linken Seite der Kirche, der Siewer-Bauer auf der rechten. Und sie, Lene, hier vorn.
In Lenes Hals war es trocken. Die Kehle zugeschnürt. Alles um sie herum weit weg.
„Lene Schindacker!“, hörte sie aus der Ferne die unnachgiebige Stimme des Herrn Pastor. „Wir warten!“
Sie schluckte, rang um jede Silbe. „Das sechste Gebot“, flüsterte sie. „Du sollst nicht ehebrechen.“
„Lauter! Wir hören nichts!“
Sie nahm alle Kraft zusammen, schrie beinahe, Tränen in den Augen: „Du sollst nicht ehebrechen!“
Sie hörte Unruhe, ein paar Schritte im Kirchgang, aufgeregtes Tuscheln, dann das laute Knarren der Tür, das Zuschlagen, und wusste ohne sich umzudrehen: Es war ihre Mutter, die den Kirchenraum verließ.
Lene sank auf ihren Stuhl. Sie zitterte am ganzen Körper. Und plötzlich dachte sie: Ich geh weg von hier. Ich geh nach Berlin. Und nie, nie wieder kehr ich zurück.
„Was willst du?“, fuhr der Herr Lehrer auf. „Nach Berlin in eine Fabrik?!“
Lene nickte. Nun war es heraus. Und vielleicht, vielleicht hielt er sie zurück und sagte: Dann bleib lieber bei uns!
„Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen!“, polterte er los und schlug mit der flachen Hand auf den Esstisch, dass die Tassen schepperten. „Willst du etwa in der Gosse landen?“
„Ich bitte dich, Gotthelf, denk an die Kinder!“, warf die Frau Lehrer ein.
Lene spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, wie ihr Gesicht zu glühen begann. So hatte sie sich das Gespräch nicht vorgestellt, heute, am Tag nach ihrer Konfirmation, heute, am ersten Tag, an dem sie zu den Erwachsenen gehörte. „Wieso denn“, stammelte sie, „Anne ist doch auch in einer Fabrik in Berlin. Sie hat gesagt, sie arbeitet in einer Spinnerei, sie hat ihre eigene Spinnmaschine, da muss sie immer die leeren Spulen aufstecken und die Fäden dran festbinden und die vollen Spulen herunternehmen und so, und überhaupt —“ Lene holte tief Luft. Langsam redete sie sich Mut an, sogar Zorn — es war nicht gerecht von ihm, es war einfach nicht gerecht, sie aus dem Haus zu weisen und ihr dann noch Vorwürfe zu machen, wenn sie ihr Leben selbst in die Hand nahm! „Und überhaupt, ich weiß gar nicht, warum Sie so böse sind! Ich würde ja gerne hier bei Ihnen bleiben, dafür würde ich sogar das andere aushalten hier im Dorf ...“
Ihre Stimme drohte umzukippen, verzweifelt rang sie um Fassung, nahm einen neuen Anlauf: „Sie sagen doch immer, Arbeit ehrt, und Anne sagt, in der Fabrik verdient man dreimal so viel wie als Magd, und wie das ist, Stall ausmisten und Mist breiten und melken, bis einem die Hände wehtun, und Heuernte und Rüben hacken, das weiß ich, da macht mir keiner was vor! Ich seh's ja an meiner Mutter, mit dreißig hat sie schon einen krummen Rücken, und außerdem will ich nach Berlin!“
„Ach ja?“, meinte er. „Und wo, bitte, wenn ich fragen darf, willst du wohnen in Berlin?“
Wohnen? Darüber hatte sie noch nicht nachgedacht. Sie zuckte die Schultern. „Es wird sich schon was finden! Große Ansprüche hab ich ja nicht, ich hab lange genug im Kuhstall geschlafen!“ Herausfordernd blitzte sie ihn an. Und hoffte doch noch immer nichts sehnlicher, als dass er sagen würde: Bleib bei uns!
Er lachte sarkastisch. „Und da willst du jetzt den Schweinestall draufsetzen, was? Nein, im Ernst, Lene!“ Er machte eine Pause und als er weitersprach, war seine Stimme wieder ruhig und sehr eindringlich: „Du hast keine Ahnung, wie es zugeht unter den Arbeitern in Berlin, was das für eine Not und für ein Elend ist und in was für Verhältnisse du da kommen würdest!“
„Aber die Anne“, erhob Lene Einspruch.
„Ja, die Anne! Du hast nur ihr schönes Kleid und ihre feinen Stiefel gesehen! Mädchen, Mädchen, die Anne würde sich lieber die Zunge abbeißen, als hier im Dorf zu erzählen, wie es ihr wirklich geht! Und dabei hat sie es noch gut, denn sie hat einen Bruder mit Familie in Berlin und bei dem hat sie Unterschlupf gefunden. Ganz gleich, mit wie vielen sie das Bett teilen muss, es sind wenigstens Verwandte! Aber du, Lene, meinst du denn wirklich, von den paar Mark, die du in der Fabrik verdienst, kannst du dir eine Kammer nehmen in Berlin? Die Mieten sind so teuer, dass dir die Augen aus dem Kopf fallen würden! Ich sag dir, wie es ausgehen würde: Als Schlafgängerin müsstest du dich bei ...“
„Schlafgängerin, was ist das?“, fragte der kleine Hans.
„Bist du wohl ruhig!“, sagte der Herr Lehrer. „Du weißt doch: Kinder haben bei Tisch still zu sein, wenn sie nicht gefragt sind!“ Dann nahm er seine an Lene gerichtete Rede mit großem Ernst wieder auf: „Bei wildfremden Leuten müsstest du dich in irgendeiner düsteren Hinterhofwohnung einquartieren oder in einem feuchten Keller, und da steht dir dann nicht mehr zu als ein Bett, und das nicht einmal für dich allein. Zehn Leute in einer Kammer, Männer, Frauen und Kinder durcheinander, einer steigt über den anderen drüber, und die restliche Zeit würdest du auf der Straße herumhängen und in Kneipen. Die Arbeiter saufen sich in den Destillen die Seele aus dem Leib, und so ein junges, frisches Mädchen wie du — ich kann jetzt hier nicht deutlicher werden vor den Kindern, aber dafür habe ich dich nicht erzogen! Auch wenn ich dir nichts mehr zu befehlen habe, weil ich nicht mehr dein Lehrer bin und nicht mehr deine Herrschaft, ein wahres menschliches Interesse habe ich doch an dir und ich will nicht tatenlos dabei zusehen, wie du vor die Hunde gehst! Also schlag dir gefälligst das mit der Fabrik aus dem Kopf!“
Lenes Finger krampften sich um den Becher mit warmer Milch, dass die Knöchel weiß hervortraten. Sie konnte auf einmal nichts mehr denken, schaute nur auf die Haut, die sich auf der Milch gebildet hatte.
„Wir meinen es ja nur gut mit dir, Lene!“, beteuerte die Frau Lehrer. „Du träumst dir immer was zurecht, aber die Wirklichkeit, die sieht anders aus. Wenn du dich nicht beim Lenz-Bauern verdingen willst — es stimmt schon, zur Magd bist du mir eigentlich zu schade. Du hast so eine rasche Auffassungsgabe und musikalisch bist du auch noch. Eine wie du wäre zur Lehrerin begabt, aber das ist ja nun leider nicht möglich, dazu fehlt dir nun mal der familiäre Hintergrund, und wir können die Welt nicht ändern. Aber ich könnte mir dich gut in einer besseren Familie als Dienstmädchen vorstellen. Ich habe gehört, das Hausmädchen von der Frau Pastor wird heiraten. Wenn du willst, rede ich mit der Frau Pastor und empfehle dich. Das kann ich reinen Gewissens tun und dann wissen wir, dass du in guten Händen bist. Und jetzt hol noch mal Brot herein, drei Scheiben!“
Lene Schindacker!, hörte Lene die Stimme des Herrn Pastor. Das sechste Gebot! Wir warten!
Nie und nimmer würde sie in dessen Haus gehen. Das war ja noch schlimmer als die Grete Lenz ...
„Ich hab mir nun mal vorgenommen, ich geh nach Berlin!“, erklärte sie und wunderte sich selbst darüber, wie laut und bestimmt ihre Stimme klang. „Und geschworen hab ich mir, das Dorf hier sieht mich nicht wieder! Weil ich eben bei Ihnen nicht bleiben kann, weil Sie mich nicht mehr ...“ Hastig stürzte sie in die Küche. Dort lehnte sie sich an die Wand und weinte in ihre Schürze.
Als Lene mit dem Brotkorb in der Hand wieder das Zimmer betrat, sagte die Frau Lehrer: „Dann geh eben als Dienstmädchen nach Berlin! Aber zu anständigen Leuten, mit Familienanschluss! Da hast du eine Unterkunft, freie Kost und Logis, bist den Gefahren der Großstadt nicht schutzlos ausgesetzt und lernst noch etwas in der Haushaltsführung dazu.“
„Keine schlechte Idee!“, meinte der Herr Lehrer und strich sich den Bart. „So kann es gehen, da kommst du nicht unter die Räder. Ja, Lene, das machst du! Berlin — unsere Reichshauptstadt! Die Museen, die Bibliotheken, die Oper, die Theater! Und nicht zu vergessen: Seine Majestät! Ach, was gäbe ich drum ... „
Heute hatte sie keinen Blick für das Schloss. Barfuß lief Lene die Allee entlang, fast rannte sie. Schon vor Morgengrauen war sie aufgestanden, damit sie noch von der Mutter Abschied nehmen und von da aus zur Bahnstation wandern konnte, ehe sie den Zug nach Berlin nahm, aber nun war sie doch spät dran. Der Frau Lehrer war immer noch etwas und noch etwas eingefallen, was sie ihr an Ermahnungen und Ratschlägen mit auf den Weg geben wollte, die Kinder hatten sich an sie gehängt, Beate hatte sogar geheult, und das war schlimm, weil es Lene beinahe auch die Tränen in die Augen getrieben hatte und sie sich doch so fest vorgenommen hatte, nicht zu weinen. Schon gar nicht beim Abschied vom Herrn Lehrer.
Er hatte ihr lange die Hand auf die Schulter gelegt und lauter Sachen gesagt, die sie sich nicht gemerkt hatte, weil sie überhaupt nichts gehört hatte, nur die Hand hatte sie gefühlt und sein Gesicht gesehen, das ernst und doch so weich aussah, als würde er die Mondscheinsonate spielen. Dann hatte er ihr erklärt, sie dürfe sich als Abschiedsgeschenk ein Buch aus dem mittleren Fach von seinem Schrank aussuchen, und sie hatte sich lange nicht entscheiden können. Es war so gut gewesen, ganz nah neben ihm vor seinem Schrank zu stehen und die Bücher in die Hand zu nehmen, die er liebte, gewünscht hatte sie, der Augenblick würde nie zu Ende gehen. Erst als er sie gedrängt hatte, sich endlich zu entscheiden, hatte sie schließlich den Gedichtband genommen. Weil dies das Buch war, mit dem sie ihn am öftesten gesehen hatte, es roch sogar nach seinem Pfeifentabak. Und weil es das Buch war, das er am meisten vermissen würde — dann würde er wenigstens immer an sie denken.
Lene schniefte kurz. Mehr erlaubte sie sich nicht.
Das Buch lag mit ihren anderen Reichtümern in der Rückentrage, mit dem Konfirmationskleid und der Unterwäsche und der guten Schürze und mit dem Gesangbuch, das sie von ihrer Patin, der Altbäuerin, bekommen hatte und in das die Patin Lenes Konfirmationsspruch hineingeschrieben hatte: „Befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's wohl machen.“ Die Schuhe, die kostbaren neuen Schuhe, die sie von der Mutter zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte und die viel zu schade waren, um auf den steinigen Straßen abgelaufen zu werden, hingen mit den Schnürsenkeln unten an die Trage geknotet und baumelten bei jedem Schritt.
Mit der Post hatte die Mutter die Schuhe geschickt. Eine Woche vor der Konfirmation war das Paket im Schulhaus angekommen und Lene war fast das Herz stehen geblieben vor Überraschung, denn so ein Paar Lederstiefeletten war teuer, der Lohn von Monaten musste dafür draufgegangen sein. Und sieben Taler hatte die Mutter auch dazugetan — sieben Taler, das waren ganze einundzwanzig Mark, mit denen konnte sie auf jeden Fall die Fahrkarte nach Berlin bezahlen und zur Not auch eine Unterkunft für ein paar Tage, bis sie eine Anstellung fand.
Dafür war die Mutter zur Konfirmation nicht im Dorf erschienen. Das war Lene gleich, ganz und gar gleich. Es war sogar gut, denn so hatte nicht wieder so etwas passieren können wie bei der Prüfung ...
Lene erreichte die Wirtschaftsgebäude. An der Stalltür zögerte sie kurz. Die ganze Nacht hatte sie nicht schlafen können und hatte sich so vieles zurechtgelegt. Am längsten hatte sie darüber nachgedacht, was sie dem Herrn Lehrer sagen sollte, aber dann hatte sie nur stumm dagestanden und zu allem genickt, was er ihr gesagt hatte, obwohl sie es irgendwie gar nicht gehört hatte, und nichts geantwortet als: „Und vielen Dank auch!“ Was sie der Mutter zum Abschied sagen würde, hatte sie sich auch überlegt, aber nun war auch das auf einmal alles weg.
Sie blieb in der offenen Tür stehen. Die Mutter saß auf dem Melkschemel neben einer Kuh und zog gleichmäßig an den Zitzen. Prall schoss der Milchstrahl in den Eimer.
„Ja, Mutter“, sagte Lene, „ich geh dann. Nach Berlin. Als Dienstmädchen. Die Frau Lehrer hat eine Anzeige aus der Zeitung geschnitten. Von einer Stellenvermittlung. Da soll ich hin, hat sie gesagt, und mir eine anständige Herrschaft aussuchen, eine mit Ordnung und Moral.“
Die Mutter sah kurz auf, ohne das Melken zu unterbrechen. „So. Gehst du also wirklich. Nach Berlin, sagst du? Du glaubst wohl, du bist zu Höherem berufen? Na, was willst du auch daheim!“
Lene wusste keine Antwort.
„Dass du auch was sparst!“, forderte die Mutter. „Auf ein Sparbuch, hörst du? Und halt dich brav und lass dir nichts vormachen!“
Lene nickte. „Die Frau Lehrer hat gesagt, ich soll nicht in einen Haushalt, wo Söhne, ich mein, junge Herren ...“ Sie brach ab.
Die Mutter lachte verächtlich auf „Die Frau Lehrer! Die kennt das Leben, was! Söhne! Als ob es nicht auch verheiratete Gockel gäbe, die hinter jeder Henne her sind!“
Lene stieg das Blut in den Kopf Der Siewer-Bauer — unausgesprochen und doch zum Greifen nah hing der Name ihres Nicht-Vaters in der stickigen Stallluft.
Der Milchstrahl klang im Eimer, Fliegen summten, die Kühe malmten das Heu. Eine Kuh rasselte an der Kette. Eine muhte. Das Schweigen wurde lang.
„Ach, Mutter!“ Lene stockte, ging ein paar Schritte näher, ohne auf den Mist zu achten. „Ach, Mutter ...“ Ihre Stimme schwankte.
Die Mutter stand auf, griff sich an den Hals und löste ihr Kettchen mit dem silbernen Kreuz, das kleine Kreuz, ohne das Lene ihre Mutter niemals gesehen hatte. „Da! Bind's dir um! Und dass du's nicht verlierst!“ Dann nahm sie Eimer und Schemel, gab der nächsten Kuh einen derben Klaps, ließ sich nieder und begann wieder mit dem Melken.
Lene stand mit offenem Mund und sah das Schmuckstück in ihrer Hand an. Warm wurde ihr, froh und traurig zugleich. „Mutter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist doch deins, danke!“, stammelte sie und legte sich das Kettchen um. „Dass du mir das schenkst ...“
„Wirst noch den Zug verpassen!“, sagte die Mutter schroff. „Bleib gesund, Lene!“
„Du auch, Mutter, bleib du auch gesund!“
Keine Antwort, nur das Spritzen der Milch.
„Na dann, ade, Mutter!“
„Ade, Lene!“
Ein letztes vergebliches Warten, dann wandte Lene sich zur Tür. Da rief die Mutter hinter ihr her: „Und pass bloß auf, dass es dir nicht geht wie mir! Dass du dir ja kein Kind anhängen lässt, dann ist dein ganzes Leben versaut!“
Blindlings stolperte Lene aus dem Stall. Sie sah kaum, wohin sie trat.
Wenig später saß sie eingepfercht zwischen zwei Handwerksburschen auf der hölzernen Bank im Zug, umklammerte mit der einen Hand ihre Trage, mit der anderen das kleine silberne Kreuz an ihrem Hals und hörte die Lokomotive pfeifen. Der Zug ratterte laut. Ihr Herz schien ihr noch lauter zu schlagen.
Schließlich zwang sie sich, zum Fenster hinauszublicken. Da sah sie die Wiesen vorbeiziehen, auf denen sie Gänse gehütet hatte. In der Ferne das Dorf: den Kirchturm, das Dach des Schulhauses.
„Nie wieder!“, flüsterte Lene. „Nie wieder!“