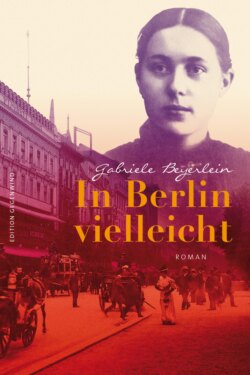Читать книгу In Berlin vielleicht - Gabriele Beyerlein - Страница 6
KAPITEL 3
Оглавление„Na, Fräulein, sind Sie hier festgewachsen, oder was?“
Lene wurde geschoben, geschubst, gegen das schmiedeeiserne Geländer gedrängt, das den Abgang aus der hohen Halle umgrenzte, und landete schließlich fast ohne ihr Zutun auf der großen Treppe, die vom Bahnsteig nach unten führte. Die Menschenmenge riss sie einfach mit, Männer, Frauen und Kinder, Bäuerinnen mit Körben voller Zwiebeln und Kohl, Mägde mit aufgeregt in Käfigen gackernden Hühnern, Gepäckträger mit riesigen Koffern auf den Schultern, vornehme Damen in Samtjäckchen und Cape, den hinten zum Cul de Paris drapierten Rock zierlich mit einer Hand raffend, Herren im Gehrock und Zylinder, Männer in schmutzig blauer Arbeitskleidung, verwegen die Mütze in die Stirn gedrückt, prächtige Offiziere und einfache Soldaten, zerlumpte Jungen und solche im feinen Matrosenanzug, kleine Mädchen an der Hand junger Frauen in Tracht mit weißem Schultertuch und Flügelhaube: ein unübersehbares Gewühl, ein Reden und Lachen, Rufen und Fluchen. Oben auf dem Gleis pfiff der Zug. Eine dichte Rauchwolke zog durch die Bahnhofshalle und hüllte sie alle ein.
Am Fuß der Treppe blieb Lene stehen, an die Wand gedrückt. Als der Rauch verzogen war, hatte sich auch das Gedränge gelichtet. Krampfhaft hielt sie den Zettel mit der Annonce umklammert und sah ratlos nach rechts und nach links. Zwei Ausgänge — welchen sollte sie nehmen? Sie hielt Ausschau nach jemandem, den sie fragen konnte: die alte Frau dort mit ihren kümmerlichen Blumensträußen vielleicht oder den Jungen, der aus seinem Bauchladen Zigarren anbot? Unschlüssig ging sie nach links und trat ins Freie, wich sofort wieder zurück: Eine riesige Kutsche ratterte vorbei. Zwei Pferde zogen das übergroße Gefährt, zahllose Gesichter hinter den Fenstern, und selbst oben auf dem Dach noch Bänke voller Leute. Das musste ein Pferdeomnibus sein, Lene erinnerte sich jetzt, dass der Herr Lehrer davon erzählt hatte. Gefolgt wurde er von einem mit Säcken hoch beladenen Fuhrwerk und einem kümmerlichen Kohlekarren, den ein magerer Hund und ein schmächtiger Junge gemeinschaftlich zogen, einer so erschöpft wie der andere. Vornehme Kutschen begegneten den Fahrzeugen und ein offener Zweispänner, Fußgänger quetschten sich durch den Verkehr, liefen todesmutig über die Straße. Lene schwirrte der Kopf. Und da — sie konnte es kaum glauben: Ein seltsames Ungetüm fuhr die Straße entlang, eine Kutsche ohne Pferde, angetrieben von einer monströsen, puffenden und knatternden Dampfmaschine.
Lene floh zurück, suchte den zweiten Ausgang, fand sich zwischen wartenden Pferdedroschken und zwei Schutzleuten mit Pickelhauben, die ernsten Gesichtes die Kutscher befragten, während ein Wachtmeister auf hohem Ross thronend die Szene beobachtete. Da konnte sie doch nicht ...
Wieder in die Halle. Vielleicht doch die alte Frau fragen, die ihre Blumensträuße zum Verkauf anbot? Doch die Alte war verschwunden.
„Neu hier, was, Fräuleinchen?“, wurde sie von einer freundlichen Frauenstimme in ihrem Rücken angesprochen. Erleichtert drehte Lene sich um. Endlich jemand, der ihr helfen würde!
Eine ältere, dicke Dame in Rot und Schwarz stand da und lächelte ihr aus geschminktem Gesicht breit zu. Lene starrte. Was für ein Hut! Ein halber Garten aus künstlichen Blumen und Straußenfedern fand darauf Platz, und um den Hals der Dame wogte und wehte eine Federboa. „Weißt wohl nicht wohin, Fräuleinchen, was?“, fragte die Dame.
„Ich, nein, das heißt, doch!“, stammelte Lene und hielt der Dame den Zettel hin. „Linkstraße. Können Sie mir sagen, wie ich da hinfinde?“
Die Dame warf einen kurzen Blick auf die Anzeige und schlug die Hände mit allen Zeichen des Entsetzens zusammen. „Du willst dich doch nicht in die Fänge so eines Vermittlungsbüros begeben?! Fräuleinchen, man merkt, dass du noch nie in Berlin warst!“ Die Dame musterte Lene von oben bis unten. „Du suchst wohl deine erste Stellung, was?“
„Ja. Das heißt: nein!“, erwiderte Lene. „Ich war schon in Stellung, fast fünf Jahre bei unserem Herrn Lehrer daheim. Aber jetzt such ich mir was in Berlin. Und bitte, wenn Sie so freundlich wären, wenn Sie mir sagen würden, was ist denn so schlimm an einem Vermittlungsbüro?“
„Die ziehn dir nur das Geld aus der Tasche, da bist du fünf Mark los, so schnell kannst du gar nicht schaun, und dann ist nichts mit Stellung, und dann ist Nacht und du stehst auf der Straße und weißt nicht wohin. Aber nun schau mal nicht so unglücklich, Fräuleinchen. Wie heißt du denn überhaupt?“
„Lene, gnädige Frau!“ Lene machte einen Knicks.
„So, Lene. Ich will dir mal was sagen, am besten kommst du erst mal mit zu mir. Wir finden schon was für dich. Aber wir müssen dir erst ein bisschen den Großstadtpep beibringen und dich zurechtmachen; ich will ja nichts sagen, aber das Dorf sieht man dir schon von weitem an. Komm nur mit, ein paar Stationen mit dem Pferdeomnibus, und schon sind wir da!“
„Ja aber, ich kann doch nicht so einfach, das ist doch zu gütig ...“, murmelte Lene unsicher. Irgendetwas war ihr nicht ganz geheuer. Die Dame schien ihr allzu hilfsbereit. Oder war das hier so in der Stadt?
Die Dame lachte und fasste sie am Arm. „Jetzt zier dich mal nicht, bist hier in Berlin und nicht mehr auf dem Dorf. Wart nur ...“ Unter unaufhörlichem Geplauder lotste die Dame sie durch die Bahnhofshalle auf den Ausgang zu, indem sie Lenes Oberarm fest umklammert hielt. Nur noch zwei, drei Schritte waren sie von der Tür entfernt, als diese sich öffnete und zwei Wachtmeister in blauer Uniform und Pickelhaube hereinkamen.
Die Dame ließ Lenes Arm los. Und auf einmal war sie weg.
Verblüfft drehte Lene sich um, blickte nach allen Seiten, sah eben noch, wie die Dame in fliegender Hast um die Ecke bog. Ihre Federboa wehte hinter ihr her.
Erst war eine seltsame Leere in Lenes Kopf, dann begann es darin zu wirbeln. Die aufdringliche Freundlichkeit — das Angebot, sie mit nach Hause zu nehmen — der feste Griff am Arm — die Wachtmeister — das fluchtartige Verschwinden ...
Ihr Herz schlug schnell und dumpf.
Was hatte diese Dame mit ihr vorgehabt? Und war sie überhaupt eine Dame? War sie nicht allzu grell geschminkt gewesen? Der Satz des Herrn Lehrer: Willst du in der Gosse enden?
Auf einmal erschien ihr Berlin wie ein bodenloser Morast. Wäre sie nie hierhergekommen!
Lene rannte hinter den Schutzleuten her. „Ach bitte, Verzeihung ...“
Die Wachtmeister drehten sich nach ihr um. „Ja?“ Wie streng und kurz angebunden das kam! Auf einmal fand sie keine Worte, stand nur da, den Zettel noch immer in der Hand, und schwieg.
Der ältere der beiden nahm ihr den Zettel aus der Hand und las die Adresse: „Dienstbotenvermittlung! So, so!“ Unter seinem Blick fühlte sie sich schuldig. „Da geh erst einmal zur nächsten Polizeistation und lass dein Gesindebuch abstempeln! Das ist nämlich von Gesetzes wegen das Erste, was du zu tun hast!“ Und dann sehr streng: „Du hast doch ein Gesindebuch?“
„Ja, Herr Wachtmeister!“ Ihre Stimme war nur ein Flüstern.
Wie lange sah sich der Herr Polizeihauptmann ihre Zeugnisse denn noch an? Erst das Schulzeugnis, dann das Zeugnis, das ihr die Frau Lehrer über ihre Arbeit als Haus- und Kindermädchen geschrieben hatte. Und jetzt betrachtete er das Gesindebuch mit dem Eintrag ihres Dienstes beim Herrn Lehrer mit einem Misstrauen, als erwarte er, auf die Spur einer Straftat zu stoßen!
Der Wachtmeister unten in der Wachstube hatte sie hier heraufgeschickt zum Herrn Polizeihauptmann. Weil der ein Dienstmädchen suche, wie der Wachtmeister gesagt hatte, nachdem er ihre Papiere studiert hatte.
Dienstmädchen bei einem Polizeihauptmann ... Eigentlich hatte sie nie etwas mit der Polizei zu tun haben wollen, und schon gar nicht mit einem Hauptmann! Aber wenn in Berlin so seltsame Sachen passierten wie das mit der Dame am Bahnhof, die offensichtlich gar keine Dame gewesen war und die wahrscheinlich etwas mit ihr vorgehabt hatte — sie mochte sich gar nicht vorstellen, was —, dann war es am besten, sich an die Polizei zu halten. Das würde bestimmt auch der Herr Lehrer sagen. Etwas Anständigeres als einen Polizeihauptmann konnte es doch nicht geben, oder?
Lene trat verstohlen von einem Fuß auf den anderen. Die Riemen des Tragekorbes schnitten in ihre Schultern, aber sie traute sich nicht, ihn abzunehmen. Der Herr Polizeihauptmann hatte sie nicht dazu aufgefordert. Er hatte ihr auch nicht gesagt, dass sie sich setzen dürfe.
Halb und halb begann sie zu wünschen, er möge sie ablehnen. Er sah so streng aus und so unerreichbar in seiner Uniform und mit seinem gezwirbelten Schnurrbart und den tiefen, steilen Falten zwischen den Augenbrauen und dem Monokel, das er sich zum Lesen vor das rechte Auge geklemmt hatte. Kaum wagte sie zu atmen.
„Mutter: Marie Schindacker“, las der Herr Polizeihauptmann vor. „Vater: unbekannt!“ Der Ton, in dem er das sagte! Ein Blick traf sie, als sei sie soeben eines Verbrechens überführt worden.
Lenes Kopf wurde heiß. Und sie hatte geglaubt, nach Berlin würde sie das nicht verfolgen!
Er ist gar nicht unbekannt, es ist der Siewer-Bauer, wollte sie widersprechen. Sie schwieg. Es würde alles nur schlimmer machen.
Sie wünschte sich weg.
Er versenkte sich wieder in ihre Papiere. „Das andere scheint alles in Ordnung zu sein — soweit man solchen Zeugnissen trauen darf!“, erklärte er schließlich und verstaute umständlich das Monokel an der goldenen Kette in seiner Brusttasche. „Fünfzehn Mark Lohn monatlich, Kost und Logis. Du hast alle Arbeiten zu erledigen, die du von der gnädigen Frau aufgetragen bekommst, und zwar zügig, ordentlich und unauffällig! Wenn ich eines hasse, dann dass man andauernd über Besen und Putzeimer stolpert oder Geschirrgeklapper hört! Eine Wohnung hat sauber zu sein, aber man hat nicht zu merken, wie sie sauber gemacht wird, merk dir das. Und keine Widerworte! Alle vierzehn Tage ein freier Sonntagnachmittag, vor Torschluss Punkt zehn Uhr hast du am Abend zurück zu sein und keine Sekunde später. Kein Besuch, wohlgemerkt! Und dass du dich nicht in dunklen Hauseingängen rumdrückst und mit Burschen anbandelst, dann fliegst du, und zwar hochkant, verstanden?“
„Ja, Herr Polizeihauptmann“, brachte Lene hervor und knickste. Hieß das, er wollte sie anstellen? Unheimlich wurde ihr bei diesem Gedanken. Genau genommen sträubte sich alles in ihr dagegen. Aber Nein zu sagen — ging das überhaupt?
„Vermeide grundsätzlich, nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße zu sein!“, fuhr er im Ton strenger Ermahnung fort. „Du könntest für ein zweifelhaftes Frauenzimmer gehalten und von der Polizei aufgegriffen und zur Sitte gebracht werden, das ist die einschlägige Polizeistation. Was dich dort erwartet, das will ich dir lieber nicht erzählen — dann bist du abgestempelt für dein Leben, also sieh dich vor! Und dass du mir nicht die Sitten vom Land in meinen Haushalt einschleppst! Ihr vom Landvolk habt einen merkwürdigen Begriff von Moral, das sieht man ja schon daran, dass du keinen Vater hast. Aber mein Haushalt ist ein anständiger Haushalt. Ich habe vier Kinder, ich achte auf Moral, also keine zweifelhaften Bemerkungen zu den Kindern und kein verdorbenes Verhalten, sonst bekommst du es mit mir zu tun! Verstanden?“
„Verstanden“, flüsterte sie und machte wieder einen Knicks. Sitten vom Land, verdorbenes Verhalten — wovon sprach er überhaupt? Das sieht man ja schon daran, dass du keinen Vater hast ...
Sie wollte weg, zurück nach Hause, zur Frau Lehrer. Lieber keine fünfzehn Mark verdienen und sich dafür nicht solche Sachen anhören müssen und so allein sein, so grausam allein.
Doch die Frau Lehrer hatte sie fortgeschickt. Und schließlich war sie kein Kind mehr, schon lang nicht mehr, und hatte schon mit fünf Jahren die Gänse gehütet und war sogar mit dem Ganter fertig geworden.
Trotzdem: Das hier, das war etwas anderes.
Er schrieb etwas auf einen Zettel und schob ihr diesen über den Tisch. „Hier, das ist meine Adresse. Du kannst mit dem Pferdeomnibus fahren, der hält genau gegenüber der Wache, die Linie habe ich dir aufgeschrieben. Und jetzt geh und melde dich bei der gnädigen Frau. Sag ihr, ich habe dich engagiert!“
„Ja!“ Sie knickste wieder. Und dachte: Ich brauche da nicht hinzugehen. Ich muss ihm gar nicht sagen, dass ich nicht zu ihm will. Einfach nicht in diesen Bus steigen. Zur Vermittlungsstelle gehen und mir was anderes suchen. Wenn ich heute nichts finde, dann morgen. Dann muss ich mir eben in einer Pension ein Bett für die Nacht nehmen, für eine Nacht reicht mein Geld.
Erleichtert atmete sie auf: Ja, so machte sie es. Besser keine Stelle als eine bei diesem Herrn da!
„Auf Wiedersehn dann, Herr Polizeihauptmann!“ So schnell wie möglich wollte sie weg, doch im Gehen fiel ihr ein: „Ach, bitte, kann ich die Zeugnisse und das Gesindebuch wiederhaben?“ Sie streckte die Hand aus.
Er faltete die Zeugnisse zusammen, steckte sie in das Gesindebuch, öffnete eine Schreibtischschublade, legte das Gesindebuch hinein, schob die Schublade zu und schloss sie ab. „Deine Papiere behalte ich hier für dich in sicherer Verwahrung, solange du bei mir in Dienst bist!“, erklärte er gelassen und sah ihr kühl ins Gesicht. „Das ist besser so! Du glaubst nicht, wie oft Gesindebücher verloren gehen! Bis heute Abend, Lene!“
Sie floh aus seinem Zimmer, den Flur entlang, die Stufen hinunter, stand auf der Straße. Ein Pferdeomnibus hielt, sie kletterte hinauf und zwängte sich durch die schmale Tür. Mit der Rückentrage fegte sie einem sitzenden Arbeiter die Mütze vom Kopf. „Nun passen Sie doch auf, Fräulein!“, raunzte er sie an. Kein Sitzplatz frei, die mächtigen Pferde zogen an. Das Gefährt ruckte und sie klammerte sich am Geländer der nach oben führenden Treppe fest. Der Kondukteur kam mit dem Billet. Sie hielt ihm den Zettel mit der Adresse hin, aber er schüttelte den Kopf: „Da sind Sie in die falsche Richtung eingestiegen, Fräulein! Streng genommen müsste ich Ihnen den Preis trotzdem berechnen. Sie sind wohl fremd zugezogen, was?“
Lene nickte, zerknüllte den Zettel in ihrer Hand. „Heute!“
„Na dann, beim nächsten Halt raus und über die Straße rüber, und am besten fragen Sie, wann Sie aussteigen müssen!“
Wieder stand sie auf der Straße. Es hatte angefangen, in Strömen zu regnen, förmlich zu schütten; ein Frühjahrsgewitter ging nieder. Das Wasser floss ihr aus den Haaren, rann über ihre Wangen, als wären es Tränen.
Mit durchnässtem Kleid saß sie endlich im richtigen Pferdeomnibus, die Rückentrage hielt sie an sich gepresst auf dem Schoß. Auf einmal war ihr alles auf merkwürdige Art gleichgültig. Der Polizeihauptmann hatte ihre Papiere behalten. Sie musste bei ihm dienen, hatte keine Wahl, na und? Beim Siewer-Bauern hatte sie auch dienen müssen und keiner hatte sie gefragt.
Hinter den beschlagenen Fenstern zog die Stadt vorbei, Haus an Haus, höher als die Kirche daheim waren die meisten. Selten ein Baum, nie ein Vorgarten oder auch nur eine Blume. Wie Ameisen die Menschen, eilig, hastig, keiner blieb stehen zu einem kleinen Plausch, keiner schien den anderen zu kennen.
Der Kondukteur bedeutete ihr auszusteigen. Sie kletterte aus dem Omnibus. Der Regen hatte nachgelassen. In der Ferne grollte der Donner.
Auf der Suche nach der richtigen Hausnummer kam sie an fünfstöckigen neuen Häusern mit strahlenden, wunderschönen Fassaden und reich dekorierten Toren vorbei, an einer Baustelle und an trostlosen Ruinen, in deren Erdgeschossen und Kellern noch Geschäfte ausharrten und auf großen Plakaten wegen bevorstehenden Abrisses mit Sonderangeboten warben.
Dann ging sie an alten, vergrauten Häusern entlang, deren Prachtzeit in ferner Vergangenheit gelegen haben musste und deren Front unter einer Flut von Reklametafeln kaum mehr zu erkennen war. So also ist es in Berlin, dachte sie und nahm jede Einzelheit in sich auf. Solange sie schaute, musste sie nicht denken.
„Plissee-Brennerei Woldemar Wimmer“, las sie halblaut, „Lotterie-Contor, Krügers Bierhaus, Besatzartikel Flach & Engel — was das wohl sein mag? —, Nähseiden Engros Isidor Salomon, Priesters Costumes, Röcke, Backfisch Kleider, Rauchwaren Gebrüder Feiler, Bäckerei & Conditorei, Privat Mittagstisch Wilhelm Pollin, Festsäle-Centrum, Destille. Was ist denn das?“
Dann hatte sie die Hausnummer dreizehn erreicht. Noch einmal verglich sie mit dem Zettel. Dreizehn, da stand es. Im Dorf daheim gab es kein Haus mit der Nummer dreizehn. Weil das eine Unglückszahl war. Hierher schien es zu passen.
Es war eines von den alten Häusern. Ein schönes Haus, bei dem man gleich sah, dass vornehme Leute darin lebten: Angedeutete Säulen hatte es zwischen den hohen Fenstern und reich mit steinernen Blumenranken und geflügelten Löwen verzierte Friese. Es war nicht von Reklametafeln entstellt, dafür schmückte es ein kunstvolles Schild über dem hohen Tor, das von Wappen, Krone und zwei Marmorfiguren halbnackter Athleten gekrönt war. Weil hier ein Polizeihauptmann wohnte? Nein, das Schild verkündete die feinen Stahlwaren von Wilhelm Bankowsky, Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs. Noch größer wiederholte sich dieses Schild über dem Geschäft im Erdgeschoss, das selbiger Hoflieferant betrieb. Im weniger eindrucksvollen Nachbarhaus führte eine steile Treppe nach unten in einen Kellerladen. Milch u. Sahne. Obst, Gemüse & Südfrüchte versprach dort die Aufschrift auf dem Haussockel.
Das Tor zum Haus Nummer dreizehn stand offen. Lene trat in eine modrig riechende Einfahrt, die durch das Gebäude in den Hinterhof führte. Auch hier Schilder: Hausieren strengstens verboten!, Das Spielen der Kinder auf Hof Flur und Treppe sowie das Umherstehen vor der Haustüre ist streng untersagt! und neben der linker Hand ins Haus abgehenden Tür die Schilder mit den Namen der Haushaltsvorstände. Da stand er: Polizeihauptmann Adolf Grossmann, 2. Stock.
Etwas drückte Lene den Atem ab. Da war der Wunsch, umzudrehen, den Pferdeomnibus zum Bahnhof zu nehmen, ins Dorf zurückzufahren. Sie könnte sich doch noch beim Lenz-Bauern verdingen, er hatte noch keine neue Jungmagd gefunden, und der Herr Lehrer konnte ihr vielleicht helfen, dass sie ihre Papiere wiederbekam ...
Damit Grete dann zu ihr sagte: Erst waren wir dir nicht gut genug, aber nun haben sie dich in Berlin wohl nicht haben wollen, na ja, Hochmut kommt vor dem Fall!?
Nein! Nie wieder, hatte sie sich geschworen.
Lene strich sich das Wasser aus den Haaren, streifte umständlich ihre kostbaren Stiefel auf der Kokosmatte ab und stieg die Treppe hinauf. „Frisch gebohnert!“ behauptete ein Schild, das an einer Treppenstufe angeschraubt war, aber dass das nicht stimmte, sah Lene gleich. Die Treppenstufen waren grau und abgetreten.
Wenn man sie mit Sand scheuern, wachsen und polieren würde wie den Flur im Schulhaus, könnten sie wieder blitzen. Ja, das wollte sie gleich morgen tun. Dann würde die gnädige Frau zu ihr sagen: Wie du das machst, Lene! Ich wusste gar nicht, dass die Treppe wieder so schön werden kann! Und eine zweite Portion Nachtisch würde die gnädige Frau ihr geben, als Extralob. Bei so vornehmen Leuten gab es bestimmt jeden Tag Nachtisch und nicht nur sonntags wie bei Lehrers, und ganz besondere Sachen, von denen Lene bisher nur aus Büchern wusste, Zitronencreme und Schokoladenmouse oder so eine gute rote Grütze mit Vanillesoße, wie die Frau Lehrer sie zum Geburtstag vom Herrn Lehrer gekocht hatte ...
Lene nickte vor sich hin: Wenn sie fleißig war und ihre Arbeit gut machte, würde sie sich an den köstlichsten Sachen satt essen dürfen. Was wollte man mehr vom Leben? Und alles andere würde sich finden. Wahrscheinlich war der Herr Polizeihauptmann sowieso den ganzen Tag auf seiner Wache, es kam viel mehr auf die gnädige Frau an, und die war bestimmt ganz anders als ihr Mann. Sie hatte Kinder wie die Frau Lehrer, und die war zu ihr auch immer wie eine Mutter gewesen.
Entschlossen zog Lene an dem Klingelzug im zweiten Stock und hörte in der Wohnung das scheppernde Gebimmel der Glocke.
Kurz darauf folgte Poltern von schnellen, kurzen Schritten, aus der Tiefe der Wohnung drang Kindergeheul. Die Tür wurde aufgerissen. Ein Junge von sechs, sieben Jahren stand da und musterte sie. „Du tropfst!“, erklärte er. „Wer bist du?“
„Ich bin die Lene, euer neues Dienstmädchen!“ Sie lächelte ihm zu. Es schien ihr wie ein glückliches Vorzeichen, dass dieser Junge ihr die Tür geöffnet hatte. Nun würde alles gut.
„Ach so!“ Er drehte sich um und schrie in die Wohnung zurück: „Mutti, da ist die Neue!“
Neugierig sah Lene in den Flur. Unwillkürlich hielt sie die Luft an. So eine Pracht! Ein dunkelrot gemusterter Teppich zog sich über die ganze Länge, dunkelrot mit goldenen Ranken auch die Tapeten, braun und gold die überhohe Decke, in ihrer Mitte eine prächtige goldene Stuckrosette. Drei Petroleumlampen brannten, dennoch herrschte ein geheimnisvolles Dämmerlicht. Linker Hand ragte ein monströses Möbelstück aus dunkel gebeiztem Holz in den Flur — fast wie ein griechischer Tempel aus einem Buch des Herrn Lehrer sah es aus: Säulen trugen einen figurengeschmückten Fries, unter dem einige schmiedeeiserne Kleiderbügel hingen, zwei göttinnenartige Wesen hielten einen großen Kristallspiegel, ein Mohrenkind reckte eine silberne Schale in die Höhe. Auf beiden Seiten dieses Tempels hing eine Sammlung von Schwertern und Spießen an der Wand. Vom Ende des Flures starrten Lene furchterregende Masken irgendwelcher wilden Völker entgegen.
Nun öffnete sich die angelehnte Tür unter den Masken und eine Dame trat hindurch und kam auf Lene zu, ein kleines, weinendes Mädchen auf dem Arm.
Lene machte einen Knicks und grüßte.
„Dich schickt der Herr Polizeihauptmann?“, fragte die Dame und runzelte die Stirn. Ihre Stimme klang genervt und eine Spur zu schrill. „Mein Gott, du kommst wohl frisch vom Land? Dabei habe ich ihn doch gebeten ... Na, wenn der gnädige Herr dich engagiert hat, da kann man nichts machen. Hoffentlich schlägst du mir nicht die Gläser und das Porzellan kaputt! Das ziehe ich dir vom Lohn ab, das sage ich dir gleich! Jetzt komm erst mal rein! Wie heißt du überhaupt?“
„Lene Schindacker, gnädige Frau.“ Es war, als gehe eine Tür in ihr zu, die sich gerade einen Spalt weit geöffnet hatte. Nein, die Frau Polizeihauptmann hatte nichts mit der Frau Lehrer gemeinsam.
„Gut, Lene! Hör zu, ich habe jetzt keine Zeit, dir alles zu zeigen und zu erklären. In einer Stunde kommt der gnädige Herr nach Hause, dann muss alles in Ordnung sein und das Abendessen auf dem Tisch stehen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht! Ich habe deine Vorgängerin fristlos entlassen müssen, sie hat in meiner Abwesenheit ihren sogenannten Bräutigam in meiner Küche empfangen! In meiner Küche! Und nun stehe ich alleine da mit der ganzen Arbeit, und Olgachen ist auch noch krank! Komm mit, zieh dir erst mal was Trockenes an, und dann kannst du gleich das Zimmer in Ordnung bringen und den Tisch decken!“
Hinter der gnädigen Frau betrat Lene das Zimmer am Ende des Flures. Ein schmaler, nach links führender langer und düsterer Schlauch war es mit einem einzigen Fenster im linken Eck. Ein mit Spiel- und Malsachen übersäter Tisch stand vor diesem Fenster. Der ganze Raum war mit dunklen Möbeln überladen, zwei Jungen bauten am Boden mit Bausteinen. Neben dem Tisch gab es eine weitere Tür — wie groß war diese Wohnung denn noch?!
Die gnädige Frau öffnete diese zweite Tür. „Die Küche!“, sagte sie knapp. Lene hätte beinahe einen Schrei der Bewunderung ausgestoßen. In letzter Sekunde schloss sie wieder den Mund, die gnädige Frau sollte nicht merken, dass sie so etwas noch nie gesehen hatte, sonst hieß es nur wieder, man merke, dass Lene vom Land kam!
Lene hatte davon gehört, dass es Küchen gab, die keine rauchgeschwärzten kleinen Löcher waren, weil in ihnen nicht über einem offenen Feuer in der Esse gekocht wurde, sondern auf richtigen Öfen, die man Kochmaschinen nannte. Die Frau Lehrer hatte immer davon gesprochen, wie sehr sie sich so eine Küche wünschen würde — aber so schön hatte Lene sich eine solche Küche nicht vorgestellt! Ein großer, heller Raum mit zwei Fenstern zum Hinterhof und weiß gestrichenen Wänden. Steinfliesen am Boden, ein Tisch in der Mitte, ein weiß und blau lackiertes Buffet, Wandborde mit Kupfertöpfen und -pfannen, mit in blauen Blumenmustern bemalten Steingutkrügen und -schüsseln, mit Schneidebrettern und Tellern aus Porzellan, halbhohe Kommoden und Schränkchen, auf denen eine Küchenwaage mit Marmorplatte, ein Bolzenbügeleisen und eine Ansammlung von Haushaltsgegenständen, die Lene nicht einmal kannte, ihren Platz hatten, und da die berühmte Kochmaschine, der Traum der Frau Lehrer: Wie ein rechteckiger Ofen sah sie aus, weiß emailliert die Wände, aus Messing die wie Löwentatzen geformten Füße, silbrig glänzend die Griffe, tiefschwarz die Herdplatte.
„Da oben auf dem Hängeboden ist dein Schlafplatz“, erklärte die gnädige Frau und wies auf ein Brett, das unter der Decke über dem Herd eingezogen war. „Da kannst du auch dein Gepäck verstauen und dich umziehen! Dort hinter dem Vorhang ist die Leiter! Mach schnell, ich muss an den Herd!“ Damit eilte die gnädige Frau aus der Küche.
Lene wollte gleich dem Befehl gehorchen, da entdeckte sie den emaillierten Ausguss an der Wand und darüber den blitzenden Hahn. Sie stockte mitten in der Bewegung. Sollte es hier tatsächlich fließendes Wasser geben? Sie hatte davon gehört — auch darüber hatte die Frau Lehrer gesprochen —, aber dergleichen noch niemals gesehen. Vorsichtig drehte sie an dem Hahn. Sofort kam Wasser heraus, spritzte in den Ausguss und verschwand wieder durch ein Loch. Lene strahlte. Sie schloss den Hahn und öffnete ihn wieder, versuchte es noch einmal und noch einmal. Was für ein unerhörter Luxus! Nie wieder würde sie frisches Wasser vom Brunnen herein- und Schmutzwasser hinausschleppen müssen! Was das Zeit und Kraft sparte! Unzählige Male jeden Tag war sie daheim mit dem Wassereimer hin- und hergegangen. Hier würde die Arbeit nicht so schwer sein wie bei der Frau Lehrer. Vielleicht hatte sie es ja doch gut getroffen.
Sie beugte sich unter den Wasserhahn und ließ sich den kühlen Strahl in den Mund laufen, trank ausgiebig. Dann wischte sie sich mit dem Handrücken das Gesicht ab und holte die Leiter hervor. „Reinlichkeit das Herz erfreut“ war mit Rosenmuster umrankt auf den Vorhang gestickt. Lene grinste. Dass es bei der Frau Polizeihauptmann nicht besonders reinlich war, hatte sie gleich gemerkt. Bei der Frau Lehrer jedenfalls hatte nie so viel Staub auf den Möbeln gelegen, wie es in dem Zimmer nebenan der Fall war.
Sie legte die Leiter an den Hängeboden und stieg hinauf. Vergebens versuchte sie hineinzukriechen, die Rückentrage war im Weg. Auf der Leiter balancierend nahm sie die Trage ab und schob sie vor sich auf das Brett, beinahe hätte sie das Gleichgewicht verloren. Endlich gelang es ihr, auf allen vieren in den Verschlag zu kriechen. Er war kaum höher als ein Meter, im Sitzen stieß sie sich beinahe den Kopf. Eine Matratze mit Kissen und Decke lag darin, sonst nichts. Aber schön warm war es hier oben. Mühsam schälte Lene sich aus dem nassen Kleid, dauernd eckte sie an Decke oder Wand an. Es dauerte lang, bis sie sich in ihr Konfirmationskleid gezwängt hatte. Eigentlich war es eine Schande, dieses kostbare Kleid zur Arbeit anzuziehen, aber sie hatte nichts anderes. Sie nahm noch eine blaue Schürze aus der Trage, breitete das nasse graue Kleid zum Trocknen aus und kletterte wieder nach unten. Als sie sich eben die Schürze umband, kam die gnädige Frau zurück.
„Hast du keine weiße Schürze?“
„Nein, gnädige Frau!“
„Das darf doch wohl nicht wahr sein! Du musst dir morgen zwei große weiße Schürzen und zwei kleine zum Servieren kaufen und auch gleich zwei weiße Häubchen, die wirst du dann ja wohl auch nicht haben! Ich borge dir das Geld, wenn du es nicht hast, und behalte es dann von deinem Lohn ein. Das Kleid ist immerhin ganz passabel, wenigstens schwarz! Das graue kannst du zur Hausarbeit tragen, aber wenn der gnädige Herr zu Hause ist und du bedienen musst, immer das schwarze! So, und jetzt geh ins Berliner Zimmer!“
„Berliner Zimmer?“, fragte Lene verständnislos.
„Du weißt ja nicht einmal die einfachsten Sachen! So ein Durchgangszimmer wie nebenan, das den repräsentativen Teil der Wohnung mit den Räumen zum Hof hin verbindet, nennt man Berliner Zimmer! Unter der Woche halten wir uns die meiste Zeit darin auf. Meinst du, ich lasse die Kinder im Salon spielen? Also räum die Spielsachen auf und mach schnell noch etwas sauber, es muss dringend Staub gewischt werden, die Staublappen sind hier in dem Körbchen. Dann deck den Tisch, die Tischdecke liegt in der untersten Kommodenschublade obenauf. Das Geschirr mit dem einfachen blauen Rand, Suppenteller und kleine Teller, nur für drei Kinder, ich bringe Olga schon ins Bett!“
Die Jungen zeigten wenig Neigung, Lene beim Aufräumen zu unterstützen. Auf ihre Frage nach ihren Namen antworteten sie, als sei es eine Auszeichnung, dass sie sich überhaupt mit ihr abgaben: Karl der Älteste, Wilhelm, der ihr die Tür geöffnet hatte, der Mittlere, Frieder, der Jüngste, noch im kurzen Kleid. Unsicher, wohin die Dinge gehörten, schob Lene Spiel- und Malsachen auf einen Stapel und schichtete herumliegende Bausteine in den zugehörigen Kasten. Der kleine Frieder stimmte ein zorniges Gebrüll an, als sie der Burg zu Leibe rückte, die er mitten im Weg errichtet hatte.
„Was machst du mit dem Kind?“, schrie die gnädige Frau aus der Küche.
„Nichts! Ich räum nur die Bauklötze weg!“, erwiderte Lene und holte den Staublappen. Die Frau Lehrer hatte sie nie verdächtigt, den Kindern etwas anzutun, nur wenn einmal eines schrie.
Wie einen dunklen harten Knoten spürte sie eine stumme Wut in sich. Beim Staubwischen tobte sie diese aus. Die Möbel waren lang nicht sauber gemacht worden, die graue Staubschicht war auf dem dunklen, glänzenden Holz deutlich sichtbar. Anscheinend war Lenes Vorgängerin schon länger gekündigt und die gnädige Frau war sich zu schade, selbst sauber zu machen. Wie vollgestellt alles war und wie viel Zeit das kostete! Kristallvasen und -schalen, Kerzenhalter und kleine Bronzefiguren, Aschenbecher und Porzellandosen, Uhren und Schreibutensilien, es nahm kein Ende. Und dann die vielen Verzierungen an den Möbeln, die gedrechselten Säulen und aufwändigen Schnitzereien, die kleinen Geländer und zahllosen Vorsprünge! Wie viel schneller war es gegangen, die glatten, einfachen Möbel der Frau Lehrer vom Staub zu befreien ...
Lene holte die Tischdecke aus der Kommode und stand ratlos vor dem Geschirrschrank. Einfacher blauer Rand, Suppenteller, kleine Teller. Wo mochte das Besteck sein? Endlich fand sie, was sie suchte, deckte sechs Gedecke und warf noch einmal einen prüfenden Blick auf alles. Was für ein Glück, dass die Frau Lehrer ihr beigebracht hatte, wie man einen Tisch deckte, rechts die Messer, links die Gabeln, oben die Löffel!
Die gnädige Frau kam herein, den Brotkorb in der Hand. „Warum hast du für sechs Personen gedeckt, kannst du nicht bis fünf zählen?“
„Was, wieso, der gnädige Herr, die gnädige Frau, Karl, Wilhelm, Frieder und ich, das sind doch sechs?“
Die gnädige Frau stieß ein kurzes Lachen aus. „Und du! Mein Gott, was bist du doch für eine Landpomeranze! Es mag ja sein, dass bei euch im Dorf das Gesinde mit der Herrschaft am Tisch sitzt, aber bei uns nicht! Dein Platz ist in der Küche! Du bedienst uns bei Tisch und kannst selber essen, wenn unsere Mahlzeit beendet ist, merk dir das! Und jetzt räum das sechste Gedeck wieder ab!“
Lene lag zusammengekauert auf ihrer Matratze, das Kopfkissen wie eine Puppe im Arm. Ganz nass geweint war es schon. Bei Tag zu weinen hatte sie sich bereits als kleines Mädchen soweit als möglich abgewöhnt. Es hätte damals alles nur schlimmer gemacht, den Siewer-Bauern aufgebracht und die Mutter unwirsch gemacht. Die Zeit der Tränen war nachts.
„Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens ...“, sang Lene leise vor sich hin. Sie liebte dieses Lied schon seit langem. Im Schulunterricht hatten sie es gelernt, es hatte eine schwierige Melodie. Der Herr Lehrer hatte es auf dem Klavier begleitet und war schier verzweifelt, weil die meisten Kinder immer wieder falsch gesungen hatten. Aber abends, wenn sie es dreistimmig gesungen hatten — nur der Herr Lehrer und die Frau Lehrer und sie, weil die Kleinen es auch noch nicht konnten —, da hatte es wunderschön geklungen.
„Wie dir's und andern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen; er sieht und kennet aus der Höhe der betrübten Herzen Sorgen“, sang Lene. Das Lied brachte die Schulstube zurück und die Abende am Klavier, wenn Beate sich dicht an sie gekuschelt hatte.
Wie schön wäre es, wenn jetzt wieder Beate zu ihr ins Bett kriechen würde! So allein war sie hier oben auf dem Hängeboden, so ganz allein. Zum ersten Mal in ihrem Leben hörte sie nachts nicht die Atemzüge von anderen, die Atemzüge der Lehrerkinder in den letzten Jahren oder die ihrer Mutter und der Kühe in ihrer Kindheit.
„Er zählt den Lauf der heißen Tränen und fasst zuhauf all unser Sehnen. Gib dich zufrieden!“
Ja, das musste sie wohl: sich zufrieden geben. Sie war jetzt in Berlin, und da hatte sie schließlich hin gewollt, und dass alles ganz anders war, als sie es sich vorgestellt hatte, das war eben so, wie es war. Es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können, wenn sie nur daran dachte, was das vielleicht mit dieser grell geschminkten Dame am Bahnhof zu bedeuten gehabt hatte ... Der Herr Lehrer hatte sie ja gewarnt: So schnell konnte es gehen, dass man in Berlin in der Gosse landete. Jetzt war sie jedenfalls bei anständigen Leuten und der Herr Polizeihauptmann passte auf, dass sie nicht unter die Räder kam. Sollte sie sich da etwa nicht zufrieden geben?
Fünfzehn Mark Lohn, das war doch was, auch wenn sie davon erst mal die Schürzen bezahlen musste, was sie nicht gerecht fand, aber es musste wohl so sein. Die gnädige Frau tat bestimmt nichts gegen das Gesetz. Aber dass sie nicht mit bei Tisch sitzen durfte! Als sei sie aussätzig. Da kam man sich nicht als Mensch vor, sondern wie ein Stück Vieh.
„Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen, und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott gar kühnlich sagen ...“ Ja, das wollte sie, Gott wollte sie es sagen, weil es ihr bei der gnädigen Frau die Sprache verschlagen hatte. Kein Wort hatte sie herausgebracht, als die gnädige Frau nach dem Abendessen die Reste von der Tafel — das große Stück Fleischwurst und das Eckchen Käse und das schöne frische Brot und die Äpfel und den Butternapf — in der Speisekammer verschlossen hatte, den Schlüssel eingesteckt und ihr einen Kanten vertrocknetes Brot mit der Bemerkung hingeschoben hatte: Das kannst du in die Kartoffelsuppe brocken, dann wird es weich. Altes Brot ist viel gesünder als frisches und sättigt besser. Und hier, den Milchreis kannst du auch haben!, und dabei mit dem Löffel die Schimmelschicht abgehoben hatte, die auf dem Reis wuchs, als ob Lene es nicht längst gesehen hätte, dass der Brei ganz verdorben war!
Nein, den Milchreis hatte sie nicht gegessen, sie wollte nicht krank werden an ihrem ersten Arbeitstag. Sie hatte sich den Rest Suppe mit Wasser verdünnt und das Brot drin eingeweicht, aber satt war sie nicht geworden von dem alten Brot. Und das war so gemein, so gemein, so gemein, denn sie hatte gut gearbeitet, hatte schnell und gründlich Staub gewischt trotz all dieser blöden Sachen, die auf den Möbeln herumstanden, und hatte beim Abspülen nichts kaputtgemacht und hatte jeden Auftrag ausgeführt und bis nach zehn Uhr noch die vorknöpfbaren Hemdbrüste für den gnädigen Herrn gestärkt und gebügelt, dass sie ganz steif geworden waren und glänzten wie Seide! Und für gute Arbeit gab es gutes Essen, so war es immer gewesen daheim, aber hier war es nicht so, und das tat so weh, dass ihr schon wieder die Tränen kamen.
„Es kann und mag nicht anders werden: alle Menschen müssen leiden; was webt und lebet auf der Erden, kann das Unglück nicht vermeiden ...“, sang Lene schluchzend vor sich hin. Langsam wurde sie ruhig. Und müde, so unendlich müde. Gib dich zufrieden, zufrieden!, raunte es in ihrem Kopf. Sie tastete neben sich auf den Boden, wo sie vor dem Zubettgehen das Gedichtbuch hingelegt hatte. Sie schob es sich unter den Kopf, drehte das Gesicht darauf, berührte es mit den Lippen, sog den Duft ein: Pfeifentabak und Schulstube, der Geruch des Herrn Lehrer.
Daheim ...