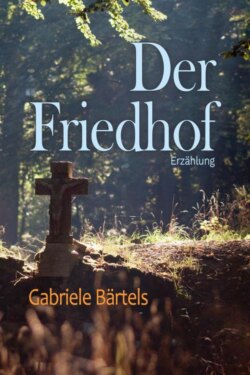Читать книгу Der Friedhof - Gabriele Bärtels - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eins
ОглавлениеGestern war Totensonntag. An keinem Tag des Jahres laufen mehr lebende Menschen auf mir herum. Sie besuchen ihre Verstorbenen, und wenn sie durch eines meiner vier Tore schreiten, hemmen sie automatisch ihren Schritt. Es überkommt sie eine leise Ehrfurcht, jedenfalls dann, wenn sie nicht zum Personal gehören.
Heute verhüllt ein schwacher Nebel die winterharten Wacholderbüsche und Ahornbäume, an deren Zweigen noch vereinzelte, tiefrote Blätter baumeln. Eines davon segelt gerade auf den Kopf eines kitschigen Engels aus Polyresin, der vortäuscht, aus Marmor zu sein. Niemand außer mir hat es gesehen.
Die sieben Gärtner, die zugleich Totengräber sind, die Pastoren, Pfarrer, Betriebsleiter und Verwaltungs-Angestellten laufen immer schnell. Sie sind den Umgang mit denen, die sich in meiner Erde auflösen, gewohnt und spüren auch die Ruhe nicht, die alle anderen überkommt, die ein paar Meter weit auf der gepflasterten, leicht ansteigenden Allee entlanggehen, an deren Ende meine Kapelle aus roten Klinkersteinen steht.
Ende November strahle ich auf Menschen wohl die Stimmung aus, welche meinem Zweck am ehesten entspricht: Die Blätter der Laubbäume sind herabgefallen, kahle Äste recken sich in den grauen Himmel. Auf einigen Gräbern stehen starre, vertrocknete Stauden. Alle Grabsteine sind kalt, die Trampelpfade abseits der Hauptwege matschig, sämtliche Wasserhähne abgestellt. Es blühen nur noch zahlreiche Plastikblumen.
An einem ähnlich trüben Tag Anfang Dezember huschte eine schmale Dame durch das Osttor. Sie trug einen dunklen Mantel und Pumps, deren Absätze sich tief in den Schotter zwischen den Pflastersteinen bohrten. Sie sah sich suchend um, entdeckte einen Gärtner, der eine alte Weide beschnitt, machte einen Schritt auf ihn zu, als wollte sie etwas fragen, blieb zögernd stehen, wandte sich wieder ab. Offenbar hatte sie die Absicht, selbst nach einem bestimmten Grab zu suchen.
Keine einfache Aufgabe, denn ich bin weitläufig. Einige Bereiche sind mehrere Hundert Jahre alt, und die Mausoleen der ehemaligen städtischen Oberschicht stehen heute unter Denkmalschutz. Andere Bereiche wurden mehrfach umgegraben und neu genutzt, dabei sind auch sämtliche mit Hakenkreuzen versehenen Grabsteine ausgebaggert worden. Man riss zudem einen Eisenzaun ein und erweiterte meine Fläche um ein Drittel, so dass aus meiner ehemals quadratischen Anlage eine irgendwie eckige Sache geworden ist, umringt von einer hohen Mauer mit Toren in jede Himmelsrichtung. Im Winter werden sie vom Gärtnerlehrling nach Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen, manchmal schon um fünfzehn Uhr.
Die Dame fror, ihre Pumps wurden matschig, sie presste ihre Tasche an sich und hielt mit der anderen Hand den Mantel zu. Bewundernswert systematisch ging sie Weg für Weg ab, entzifferte die Buchstaben auf den Grabsteinen, in Bronze gegossen, in Granit gehauen oder in Gold graviert auf schwarzem Marmor.
Ich kenne alle Namen und Geschichten der hier Begrabenen, auch der zu Asche Verbrannten und jener im anonymen Sammelgrab, denn ich habe sie voll und ganz absorbiert. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Ich helfe nie jemandem, sehe seit Jahrhunderten nur zu, wie sich immer neue Menschen zu Trauerzügen formieren, die zunehmend kürzer werden, obwohl sich die Bevölkerung der Stadt, die mich umgibt, insgesamt verzehnfacht haben muss, sonst würden nicht so viele Leute sterben. Zahllose Grabreden hörte ich mit, die über den Verblichenen nur das Beste berichteten. Heutzutage bestellen nicht religiöse Menschen gern einen Trauerredner dazu. Denn ganz ohne Zeremonie, allein auf sich gestellt, würden die untröstlichen Angehörigen, die mit derlei Angelegenheiten keine Routine haben, keinen Anfang und kein Ende finden.
Ich fühle die rechteckigen Gruben, die man täglich in meine Oberfläche schlägt – inzwischen mit kleinen, wendigen Baggern - und wie tags darauf ein Sarg darin versenkt wird. Nach der Beerdigungszeremonie, wenn die Hinterbliebenen den Ort verlassen haben, schaufeln die Gärtner meine Wunde wieder zu, und stapeln die Blumenkränze auf den frischen Hügel.
Es braucht ein paar Tage, bis er über meinem neuen Dauergast zusammensackt und den neuen Sarg luftdicht umschließt. Beinahe sofort beginnt dann meine gute Erde ihr Werk zu tun, aber das geht so langsam vor sich, dass davon anfangs nichts zu merken ist.
Die Dame suchte eine Stunde und ahnte wahrscheinlich nicht, dass sie höchstens ein Viertel meiner Fläche abgeschritten hatte. Sie zitterte jetzt, ihre Fingerspitzen waren weiß, und ihre von halblangen Locken verdeckten Ohren leuchteten rot. Auf dem westlichen Hauptweg war sie dem Gärtner wieder begegnet. Er war unrasiert, trug schwere Gummistiefel und schob eine Karre mit Weidenruten vor sich her. Die Dame hielt den Kopf gesenkt, murmelte einen halben Gruß und eilte an ihm vorbei, als würde sie nicht suchen, sondern hätte ein Ziel.
Schließlich blieb sie stehen, neben dem Grab eines Wissenschaftlers, dessen Name ihr nichts sagte, obwohl es ein Nobelpreisträger war. Sie fummelte ein Smartphone aus der Tasche und rief mit angenehmer Stimme und höflichen Worten ein Taxi. Dann rannte sie den Hauptweg hinunter zum Osttor, so gut es ihre Stöckelschuhe zuließen. Der Blumenladen neben dem Eingang draußen hatte im Winter geschlossen. Ich hörte, wie ein Wagen heranfuhr, anhielt und abfuhr.
Schon um sechzehn Uhr brannte nur noch im Backsteingebäude der Friedhofsverwaltung Licht. Meine Tore waren fest verriegelt. Dunkelheit und noch mehr nasskalte Stille als tagsüber senkten sich über meine Wege und die unregelmäßigen Reihen aus Eisenkreuzen und Quadern. Weit entfernt war Autoverkehr zu hören. In der Nähe raschelten Amseln im Laub und hüpften von einem kahlen Zweig zum anderen, empört zwitschernd. Feldmäuse linsten unter Sandsteinumrandungen hervor, in denen sie sich ein warmes Winterlager bereitet hatten, ein Raum davon gefüllt von Bucheckern, die dieses Jahr reichlich gefallen waren. Die Augen eines Uhus glänzten im Dunkeln wie die einer Wildkatze.
Die Mauern, die mich umrahmen, sind hoch. Auf den First hat man Glassplitter in Beton gegossen. Doch ein blutiger Schnitt in der Hand hält Jugendliche nicht davon ab, ihre mitternächtlichen Mutproben zu wagen. In den Ecken mancher Mausoleen liegen leere Tabakbeutel, rostige Bierdosen und Kerzenreste - nicht die einzigen Zeugen ihrer nächtlichen Zusammenkünfte.
Irgendwann habe ich begriffen, dass sie hierherkommen, um sich zu gruseln. Das muss ein seltsames Gefühlsgemisch aus Angst und Lust sein. Von Geistern ist die Rede, von Vampiren, Verfluchten und herumwandernden Gerippen, aus deren leeren Augenhöhlen es rot glüht. Ich habe derlei hier noch nie gesehen. Auch die Füchse, Tauben und Katzen, die auf meinem Grund gestorben sind, tanzen nicht als durchsichtige Geister herum. Richtig ist, dass sich geflügelte oder vierbeinige Aasfresser und zuletzt Würmer und Mikroben an ihnen gütlich tun, bis sie ich sie vollkommen absorbiert habe.
Weil die jungen Leute mindestens zu zweit auftauchen und die Szenerie mit ihren Smartphones beleuchten, scheint ihr Grusel ohnehin nicht so stark zu sein: Dieselben erscheinen selten ein zweites Mal, und im Winter bleiben ohnehin alle weg. Auch die Zahl der Diebe, die früher häufig meine Mauern überwanden, hat sich drastisch reduziert. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass auf meinem Gelände nichts mehr zu holen ist, außer für Fetischisten, Andenkenjäger und Grabschänder. Die wirklich wertvollen Bronzen und Statuen, die einst überall zwischen Hainen standen, sind bereits vor langer Zeit gestohlen worden oder wurden vorsorglich abgebaut.
Noch vor fünfzig Jahren blieben regelmäßig Besucher vor diesen Grabwächtern stehen und starrten gebannt auf in Stein gehauene Trauer, Hoffnung und ewige Liebe. Dass hinter Nadelbäumen diese mit Taubendreck bedeckten Köpfe durchschienen und steinerne Körper durch verschnörkelte Grabumzäunungen schimmerten, hatte mir einen Zauber verliehen, den meine Besucher in diesem Jahrtausend nicht mehr erahnen können.
Kein Hinterbliebener stellt heute mehr eine teure Originalplastik auf ein öffentlich zugängliches Gelände. Es überwiegen billige Kopien der meistverkauften Trauersymbole, gegossen in Beton oder Plastikgemisch. Dürers Hände, dicke Engel mit gesenkten Köpfen, gebrochene Herzen, rot lackiert, mit silbernem Flitter bestreut. Den Geschmack der Zeit scheint es zu treffen.
Einen Tag darauf erschien die Dame wieder zur selben Zeit. Diesmal trug sie warme Stiefel, Lederhandschuhe und einen dicken, grünen Schal, der sich wie eine Python um ihren zarten Hals schlang. Sie mochte um die Fünfzig sein, an den Schläfen wurde ihr Haar grau, aber ihr Gesicht war glatt und hell.
Heute zögerte sie nicht mehr lange, sondern hielt sich links, schritt zügig die Wege ab, wandte den Kopf hin und her, um beidseitig Namen zu entziffern, und stieß zu meiner Verwunderung sehr schnell auf ein unscheinbares Grab, das in zwanzig Jahren niemand mehr besucht hatte. Doch es wurde von der Gärtnerei gepflegt, und das bedeutete, dass noch Angehörige existierten, die für die Liegestätte zahlten. War die Dame eine Angehörige von Stefan Triesel, jenem jungen Mann, der sich vor dreißig Jahren mitten im Sommer das Leben genommen hatte?
Ähnlichkeiten konnte ich nicht feststellen, denn das Gesicht des Toten hatte sich längst aufgelöst. Ich sehe ihn stets in seiner derzeitigen Form, das sind lediglich noch einige seiner größten Knochen. Doch nicht nur sein Körper, auch seine Geschichte sind ein Teil von mir geworden, und in diesem Fall deckte sich die Grabrede, die sein älterer Bruder damals gehalten hatte, mit dem kurzen Leben des jüngeren: Er war ein Leidender gewesen, ein sanfter Weltschmerzensjüngling kurz vor dem Abitur, mit träumenden Augen.
Nie hatte er einem Menschen Schaden zugefügt, nur sich selbst. Er war in aller Herrgottsfrühe auf ein Baugerüst geklettert, hatte LSD genommen, eine halbe Stunde dort oben gesessen, noch bevor der erste Vogel einen Laut von sich gab. Und als ein schwacher Schein hinter den Dächern den Sonnenaufgang ankündigte und alle Vögel wie irre sangen, sprang er.
Nur ein verschlafener Passant, der seinen Hund ausführte, sah von der gegenüberliegenden Straßenseite den kurzen Sturzflug mit an, wandte sich aber ab und hielt die Ohren zu, bevor der Körper aufkam. Stefan Triesel lebte dann noch eine halbe Stunde auf dem Bürgersteig, die Schädeldecke zerschmettert, nur seine runde Metallbrille war heil geblieben. Ihre Gläser ruhen unversehrt in meiner Erde, das Gestell ist verrostet.
Die Dame schien gefasst, als sie jetzt stehenblieb und offenbar immer wieder den Namen las, den Geburtstag, das Sterbedatum. Der Grabstein war aus gewöhnlichem, grauem Granit, die Buchstaben eingefräst. Es blühten noch ein paar Alpenveilchen zwischen den robusten Bodendeckern, die jegliches Unkraut erstickten.
So halten die Gärtner die Gräber jener Toten pflegeleicht, deren Angehörige nicht mehr erscheinen, was früher oder später bei all meinen Toten der Fall ist. Erst dann, wenn sich keiner mehr erinnert oder die Nutzungsdauer abgelaufen ist, trennt sich die Menschheit endgültig von diesen Seelen. Die Fläche wird wieder geebnet, neue Liegestellen markiert und mit fünfstelligen Nummern versehen.
Natürlich gilt das nicht für die Ehrengräber der Stadt: Deren Liegezeit wird um Jahrzehnte verlängert, denn es scheint den Menschen wichtig zu sein, einen Ort zu haben, an dem die Erinnerung Gestalt annimmt, gleichgültig, ob man den Verstorbenen persönlich kannte und ungeachtet der Tatsache, dass nach dieser langen Zeit wirklich nichts mehr von ihm übrig ist. Die Erinnerung an ihn könnte demnach überall in gleicher Qualität erfolgen, aber vielleicht können sich die Menschen nur auf einem Friedhof wie mir darauf konzentrieren. Denn außerhalb meiner Grenzen scheint es inzwischen äußerst hektisch zuzugehen. Ich höre ja nur das Hupen, Quietschen und das Geschrei, aus dem ich mir oft keinen Reim machen kann. Und ich sehe, wie hinter meinen Mauern Gebäude wachsen, die gigantische Schatten auf mich werfen. Früher hatten sie höchstens vier Etagen, heute vierzig.
Die Dame sprach kein Wort, daher erfuhr ich nicht direkt, was der Anlass ihres Besuches war. Ich konnte mir aber ausrechnen, dass sie zum Zeitpunkt des Todes von Stefan Triesel etwa in seinem Alter gewesen sein musste. Und wenn sie nicht Schwester oder Cousine war, dann musste sie ihn geliebt haben. Niemand sonst hält so lange an einer Erinnerung fest.
Die Schulfreunde des jungen Mannes hatten die Abiturzeit weit hinter sich gelassen, waren wahrscheinlich zum Studium in andere Städte gezogen, hatten Familien gegründet und wieder zerstört. Stefan Triesels älterer Bruder war nach Amerika ausgewandert, und hatte seine Eltern nachgeholt. Das weiß ich, weil sie vor fünfzehn Jahren, kurz vor ihrer Abreise, das letzte Mal am Grab ihres Sohnes gestanden hatten, um ihm unter Tränen zu erzählen, warum sie ihn nie wieder besuchen würden. Da waren sie selbst schon grauhaarig.
Und diese Dame stand hier, als wolle sie zum Anfang ihres Lebens als ganz junge Frau zurückkehren. Weinte sie? Ihre Schultern zuckten. Vielleicht war es nur Ratlosigkeit.
Manche Menschen erhoffen sich etwas Großes, wenn sie vor ein Grab treten. Eine Erkenntnis. Eine Botschaft. Tränen. Verzeihung. Aber manchmal sind da nichts weiter als farbige Kiesel, in hübsche Muster gelegt, eine niedergebrannte Kerze, deren rote Plastikhülle bis oben hin voll Regenwasser steht. Und drei Gräber weiter zupft eine Witwe Unkraut aus dem Grab ihres Mannes und stört die Atmosphäre, die man sich eingebildet hat.
Von diesen Witwen gibt es hier viele. Man kann sie schnell verwechseln. Sie sind regelmäßig hier, grüßen einander und humpeln oft, wenn sie ihre Gießkannen von dem Gestänge holen, an dem an die hundert grüne, gelbe, rote und pinkfarbene Gießkannen hängen, jeweils mit Fahrradschloss gesichert. Jeden Fremden, der hier auftaucht, mustern die Witwen mit heimlichen Seitenblicken. Doch heute war keine von ihnen da, zu feucht, zu kalt ist das Wetter für ihr Rheuma oder ihre Gicht. Im Winter sind die Toten einsamer als im Sommer.
Jetzt hockte sich die Dame hin, achtete nicht darauf, dass die Kante ihres Mantels im feuchten Laub versank, legte eine Hand auf den eingravierten Vornamen Stefan, fuhr mit dem Zeigefinger die Buchstaben nach, langsam und zärtlich.
Ich kannte diese Dame nicht, aber sie machte einen kultivierten, selbstbewussten Eindruck. Mit dem verstorbenen Stefan Triesel zusammen konnte ich sie mir überhaupt nicht vorstellen. Er hatte Ledersandalen getragen, ausgebeulte Cordhosen und einen alten Parka. Hätte er seinen Weltschmerz überlebt, wäre er vermutlich ein verhuschter Professor geworden, mit feinen, weißen Händen. Oder ein Versager. Sicher war er mit achtzehn hübsch gewesen, hatte vielleicht dunkle Augen, dunkle Locken gehabt und einen festen, muskulösen Körper.
Aber ihm fehlte Haltung, das konnte man noch jetzt an seinen Knochen sehen. Seine Schultern waren ständig hochgezogen, seine Knie leicht eingeknickt. Damit stand er ganz im Gegensatz zu dieser sich sehr gerade haltenden Frau, die sich allein glaubte - was sie auch war, denn ich zähle ja nicht.
Trotzdem behielt sie ihre Gefühle im Zaum, presste nur die gefalteten Hände gegen die Brust, weinte nicht, sagte nichts, legte nichts nieder. Als sie sich aufrichtete und fortging, war ich fast sicher, sie morgen wieder zu sehen.