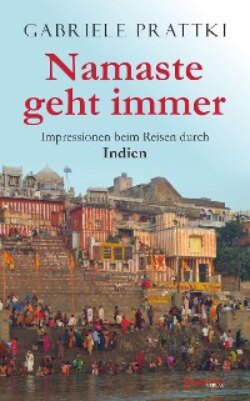Читать книгу Namaste geht immer - Gabriele Prattki - Страница 10
Оглавление1983 – Erste Indienreise
Ella und Sabina fanden nach ihrer Ankunft in New Delhi für zwei Nächte eine preiswerte Unterkunft. Sie beschlossen, auch für die zwei Nächte nach der Ladakh-Reise dort Quartier zu nehmen, bevor Sabina die Rückreise antreten und Ella drei Wochen nach Burma reisen würde.
Als sie zum ersten Mal an den Slums vorbeifuhren, musste Sabina sich übergeben. Sie hatte zunächst geglaubt, es seien riesige Müllhalden. Das stimmte auch, aber Menschen hausten darin. Sie war entsetzt und weinte. Die Menschenmassen in den lauten Straßen der damaligen Zehn-Millionen-Metropole ängstigten sie. Unvermeidlich kam sie ständig mit Menschen, die ihr fremd waren, in Berührung. Alle schienen es eilig zu haben. Und bei den Gerüchen war jede Nuance zwischen himmlisch duftend und erbärmlich stinkend vertreten.
Ella reagierte meist gelassen, während Sabina fassungslos war. Elend, Dreck, die riesige Kluft zwischen Armen und Reichen, die in New Delhi überall gegenwärtig war – regte sich niemand darüber auf? Wurde irgendetwas dagegen unternommen?
Einmal weigerte sie sich, in eine Fahrradrikscha einzusteigen. Sie fand es entsetzlich, von einem abgemagerten alten Mann gezogen zu werden und wollte, ohne die Entfernung zu kennen, zum Roten Fort laufen. Ella wies sie darauf hin, dass der Mann mit den Rikscha-Fahrten seinen Lebensunterhalt verdiente. Widerwillig stieg sie ein.
2012
Auf dem Weg zur Jama Masjid, der Freitagsmoschee, informiert Kishan die Gruppe über Details in perfektem Deutsch, was das Zuhören leicht macht. Englisch mit indischem Akzent fände Sabina auch interessant.
Die englische Sprache wurde in Indien nach der Unabhängigkeit beibehalten, weil man sie als Standortvorteil im globalen Wettbewerb entdeckt hatte. In den verschiedenen Bundesstaaten Indiens gilt daneben je eine von sechzehn ausgewählten Mehrheitssprachen als offizielle Amtssprache.
Der Erbauer der Moschee, Mogulherrscher Shah Jahan, zog jeden Freitag mit seinem Hofstaat in prunkvoller Prozession von seinem Palast zur Moschee und demonstrierte auf diese Weise seinen Machtanspruch über Religion und Staat.
Die Moschee – ein Wunderwerk der Architektur mit Kuppeln, Toren, Galerien und Ecktürmen in faszinierender Symmetrie.
Sabina gefällt der vertikale Wechsel von rotem Sandstein und Marmorbändern; die Wirkung ist großartig und schlicht zugleich. Der Innenhof der größten Moschee Indiens bietet 25000 Gläubigen Platz. Dass Menschen solche Schönheit erschaffen können, erstaunt Sabina immer wieder.
Sie findet sich im Moment gar nicht schön, sondern komisch. Am Eingang erhielten die Frauen eine Art knöchellangen Mantel in, wie sie findet, hässlich machenden Farben. Der soll die Kleidung westlicher Touristinnen, die lange Hosen oder kurze Röcke tragen, im Innenhof der Moschee weitgehend verhüllen. Die Freundlichkeit von indischen und vielen anderen Besuchern lässt sie ihre Eitelkeit und die eigenwillige Verkleidung aber schnell vergessen. Und welche Touristin kann mit den in edle, farbenprächtige Saris gekleideten Inderinnen schon konkurrieren?
Sie kommt mit einigen indischen Familien kurz ins Gespräch, was von strahlendem Lächeln auf allen Seiten begleitet wird. Diese Menschen möchten sie fotografieren. Dann darf sie von deren Kindern ein Foto machen. Sie ist entzückt von den hübschen Kleinen.
Zarte Figuren, die indischen Frauen mit ihren fein geschnittenen Gesichtern, gekleidet in so leuchtenden Farben, dass Sabina glaubt, davon betrunken zu werden: rosa, türkis, hellgrün, azurblau, fliederfarben, gelb, lila, dunkelrot, orange, ocker, unifarben oder mit feinen Mustern. Die Frauen tragen Ohr- und Nasen-ringe oder Perlenstecker, mehrere Armreifen aus verschiedenen Materialien, Halsketten und feine Kettchen um die Fußgelenke. Frauen in anderer Kleidung gehören verschiedenen Religionen an, etwa dem Sikhismus oder Islam. Manche der jungen indischen Frauen in New Delhi sind modisch gekleidet.
In der Nähe der Hauptstraße Chandi Chowk liegt ein Sikh-Tempel. Der Straßenname erinnert Sabina an ihre erste Indienreise. Hier war das Menschengedränge damals beängstigend dicht und die ständige Tuchfühlung sehr befremdlich für sie.
Unter den Mogulherrschern war Chandi Chowk die schönste Flaniermeile mit Grünstreifen und einem Wasserkanal in der Mitte. Heute ist dort ein Chaos an Verkehrsmitteln aller Art – auch eine Art Stoff-Fühlung: Blech an Blech.
Auf dem weißen Sikh-Tempel leuchtet eine goldene Zwiebelkuppel. Den Tempel darf man nur ohne Schuhe, Strümpfe, Tabakwaren und mit Kopfbedeckung betreten. Wer kein Kopftuch oder keinen Hut hat, kann das Haar mit einem orangefarbenen Tüchlein bedecken, das Touristen vor dem Tempel angeboten wird. All dies dient dazu, den Tempel nicht zu entweihen.
Sabina setzt sich mit den anderen der Reisegruppe für kurze Zeit auf den Boden. Er ist wie die Hauptgänge mit roten oder grünen Teppichläufern für die nackten Füße ausgelegt. Sie sieht der fremden religiösen Zeremonie interessiert zu, auch wenn sie nicht weiß, welche Bedeutungen die Rituale haben.
Danach werden sie durch eine Großküche geführt, in der es verführerisch duftet. Ehrenamtliche Helfer kochen in riesigen Behältern das Linsengericht Dal oder backen auf großen Herdplatten Chapati, indisches Brot. Die Küche ist Teil einer sozialen Einrichtung der Sikhs, die Nahrungsmittel an Hungrige verteilt.
In einem großen Saal sitzen viele Menschen auf dem Boden und nehmen die Speisen mit der rechten Hand zu sich.
Weiße Säulengänge umgeben in einem Innenhof des Tempelgeländes ein großes Becken mit blaugrün schimmerndem Wasser. Ein etwa fünfjähriger Junge, den Sabina wegen des Turbans als Sikh erkennt, schaut sie unverwandt an. Er trägt mit Nieten dekorierte Jeans und einen rosafarbenen Pullover mit einem Häschen darauf. Als sie seinen Blick erwidert, dreht er sich schüchtern zu seiner Mutter, die ihr zulächelt. Zwillinge, die noch in Windelhöschen stecken, tragen auf dem Kopf winzige Turbane wie eng anliegende Mützchen und trippeln an der Hand ihrer Väter. Die sind jung und attraktiv, tragen Turbane und Bärte, da sie als Sikhs nie ihr Haar schneiden. Ein kleines Mädchen, wenig älter als die Jungen, ist gekleidet wie ein Püppchen mit einem hellgrün schimmernden Kleidchen, Spangen in den kurzen, schwarzen Locken und glitzernden Sandälchen mit Blockabsatz, in denen die kurzen, leicht krummen Beinchen unsicher paddeln. Die farbenprächtig gekleidete hübsche Mutter der Kleinen trägt eine weit geschnittene Hose, die sich nach unten verengt, darüber ein Kleid, das bis unters Knie geht und einen Sari-Überwurf.
Vor dem Tempelgelände erläutert Kishan, was unter Sikhismus zu verstehen ist. „Sikh bedeutet Jünger des Gurus Nanak Dev. Von ihm wurde der Sikhismus im Indien des 15. Jahrhunderts gegründet. Er konnte die damaligen in der Religion geltenden Rituale, den Aberglauben und die Dogmen nicht akzeptieren. Die Sikh-Religion ist monotheistisch und der allmächtige Gott ein Gott der Gnade. Er straft nicht, sondern hat den Menschen geschaffen, damit er seine wahre Stellung im Kosmos erkennt und sich mit diesem vereinigt. Sikhismus lehrt ein weltliches Leben. Man soll der Menschheit dienen, um Toleranz und Brüderlichkeit zu fördern, mit der Umwelt und Gott in Harmonie leben, optimistisch sein und hoffen. Wenn alle anderen Mittel bei Konflikten versagt haben, ist der Einsatz des Schwertes berechtigt.“ Sabina hält den Atem an.
„Frauen sind gleichberechtigt“, fährt Kishan fort, „Mitgift und Scheidung nicht erlaubt. Nach der Verbrennung der Toten wird deren Asche in einen Fluss gestreut.“
Der Bus schiebt sich durch New Delhis dichten Verkehr, vorbei an Menschenmassen und unzähligen kleinen Verkaufsständen. Im Gegensatz zu Ella traute Sabina sich auf ihrer ersten Indienreise nicht, an den Straßenständen zu essen. Das wird sie auch während dieser Reise nicht tun. Sie bleibt vorsichtig.
Brot wird an den Straßen gebacken, Gekochtes brodelt in Töpfen, Süßigkeiten türmen sich in bunten Farben. Daneben liegen auf Planen Autoreifen und Kleinstteile, vermutlich fürs Fahrrad. Schrott wird in Mengen am Straßenrand gelagert. Chai, der in Indien beliebte und meist getrunkene Tee, wird mit Milch, Zucker und Gewürzen aufgekocht. Cola, Limonade, Wasserflaschen, Tücher und Stoffbahnen, Hemden, Kinderkleidung – alles liegt zum Kaufen aus. Autos parken abgedeckt oder ohne Schutz auf Gehwegen neben Karren mit Lebensmitteln. Menschen schlängeln sich daran vorbei. Manche winken den Reisenden im Bus lächelnd zu, der an einer Gedenkstätte für Mahatma Gandhi vorbeifährt und weiter durch die Straßen der Achtzehn-Millionen-Stadt voller LKWs, Fahrräder, Tuk-Tuks, wie die dreirädrigen Autorikschas genannt werden, Autos, Fahrradrikschas, Kühe, Pferdekarren und Traktoren mit Anhängern. Mittendrin bewegen sich Menschen, mehr Menschen als Sabina jemals an einem Ort erlebt hat. Häuser zwischen ruinenhaft und stolz ragen auf, an denen Reklametafeln entlang der Fassaden großflächig ihre Kaufbotschaften heraus-schreien. Alte Holzgitter zieren Fenster und Balkone. Über allem liegt staubgrauer Dunst, der Smog der Metropole.
Rückblick
Auf ihren Reisen besichtigte Ella auch Großstädte. So ausgiebig wie Peking allerdings nur einmal: Sie marschierte einem Gefährten zuliebe an einem Tag dreißig Kilometer, sagte ihm nichts von ihren schmerzenden Füßen und hatte noch Wochen später schwarzblaue Zehen.
Am liebsten reiste sie zu abgeschiedenen, fast unerforschten Orten, an denen die Einheimischen kaum Kontakt mit Fremden gehabt hatten. In den siebziger Jahren war sie in vielen Staaten Südamerikas und Afrikas unterwegs gewesen und hatte sich intensiv mit Geschichte, Kultur und Lebensweise der Bewohner beschäftigt. Ende der achtziger Jahre beteiligte sie sich an einem Forschungsprojekt über eine Bevölkerungsgruppe in Papua Neuguinea. Sie lebte einige Wochen mit den Einheimischen und wie diese in einer kleinen Hütte auf Pfosten, unter der die Schweine lagen. Über das Projekt entstand ein Buch, in dem deutlich wurde, wie wichtig die Vermittlung ethnologischer Themen in verschiedenen Schulfächern für Toleranz gegenüber fremden Kulturen ist.
Ella konnte sich fließend in verschiedenen Sprachen verständigen. Neben Englisch und Französisch hatte sie Spanisch und Suaheli gelernt, Arabisch und Chinesisch kamen hinzu. Sie hatte nach jeder Reise das Bedürfnis, den Menschen zu Hause das Fremde nahe-zubringen und ihnen einen weiten Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Auf diese Weise wollte sie dazu beitragen, eurozentrisches Denken abzubauen, das Europa als Mittelpunkt und anderen Völkern überlegen betrachtet. Ihr Wunsch entwickelte sich zu ihrer Mission.
2012
Beeindruckende Ruinen erinnern an den Beginn der islamischen Herrschaft über Nordindien im Jahr 1193. Der Hinduismus wurde zu jener Zeit verdrängt. Hindu-Heiligtümer wurden zerstört, viele Säulen von Hindutempeln jedoch für den Bau von Moscheen verwendet. Man war auf einheimische Steinmetze, Architekten und Künstler angewiesen.
„So wurde der Grundstein für die indo-islamische Architektur gelegt“, erläutert Kishan. Der 73 m hohe Turm Qtub Minar fällt sofort ins Auge, der den Sieg des Islam dokumentieren sollte. Er hat unten einen Durchmesser von 14,3 m, oben nur 2,7 m. Qtub heißt Weltachse, und Sabina fragt sich, ob der Zerstörer Qtub sich den Namen selbst zugelegt hat.
Abends wird das Hotel in Alwar erreicht. Sabina ist zu müde zum Essen. Angefüllt mit Eindrücken aus New Delhi und von der langen Fahrt, wartet sie mit dem Auspacken und öffnet die Tür ihres Zimmers, um den Gestank nach Desinfektionsmittel herausströmen zu lassen, der ihr Kopfschmerzen bereitet. Sie genießt den Blick auf einen Brunnen inmitten des schönen Innenhofes maurischer Bauweise. Eine mondlose Nacht kündigt sich an.
Wie lange ist die Reise nach Ladakh her?, fragt sie sich beim Einschlafen. Fast dreißig Jahre …