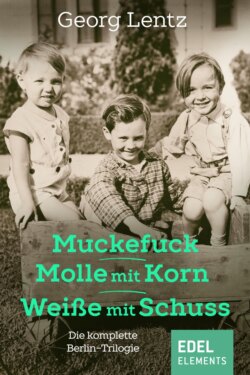Читать книгу Muckefuck / Molle mit Korn / Weiße mit Schuss - Georg Lentz - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEines Tages gerieten wir in eine Zwangslage, weil neue Gesetze den Nachweis einer lückenlosen Ahnenkette verlangten. Und irgendwo, leider, befand sich da eine Lücke. So zog Minnamartha mir eine Rüschenbluse an und grüne Hosen, ließ mir die Ponys stutzen und führte mich ins fotografische Atelier. Viele Treppen waren zu erklimmen. Im Vorzimmer mit hellen Landhausmöbeln lagen Alben auf, Posen anbietend für Einzel- und Familienfotos. Herren stützen behandschuhte Hände auf kleine Tische. Damen saßen, Dutt oben auf dem Scheitel, kerzengerade in Lehnstühlen. Studenten gruppierten sich in vollem Wichs mit langen Pfeifen, vorn lagerten zwei auf ihren Ellbogen, und in der Mitte zeigte ein Wappenschild, dass es sich um Akademiker der Vereinigung Frankonia handelte. Wir aber, wir wollten Bestimmtes. Kopf im Halbprofil nämlich, zum Nachweis, dass kein Ohrläppchen angewachsen war, was immerhin auf unerwünschte Abstammung hingewiesen hätte.
Der Meister, im dunklen Anzug, führte uns unters Glasdach seines Ateliers, probierte Hintergründe, setzte mich auf einen Drehschemel. Legte Platten in den altmodischen Apparat ein. Unters schwarze Tuch verschwand der Operateur, verweilte dort merkwürdig lange. Dann aber kroch er wieder hervor, und mit der Hand auf jene Stelle deutend, wo ein ledernes Käppchen das Objektiv verschloss, behauptete er, dort komme ein Vögelchen heraus. Minnamartha lächelte mir ermutigend zu. Es kam kein Vögelchen, als der Meister die Kappe fortnahm und bis vier zählte. Aber ich hatte auch nicht ernsthaft damit gerechnet. Das Halbprofil, darauf kam es doch an!
Zwei Tage später bekamen wir die Abzüge, oval geschnitten, auf Passepartout geklebt und geschützt von einem Blatt feinsten Seidenpapiers. Das Ohrläppchen zeigte sich deutlich frei.
Ein zweiter Besuch folgte, bei einem Herrn, der mir riesige Zirkel an Stirn, Hinterkopf und Schläfen setzte, dann rechnete, und den Beweis mitgab, dass Karl Kaisers Schädelindex sich im Rahmen arischer Möglichkeiten bewegte.
In diesen Wochen trübte eine dumpfe Atmosphäre die sonst so fröhliche Stimmung in unserer Laube. Auch Minnamartha, erfuhr ich, hatte sich ähnlichen Prozeduren unterziehen müssen, denn bei ihr fehlte der Ahne. Sie nahm fünf Pfund ab, vergaß ihre Eieruhr aufzuziehen und litt unter tausend Augen, die in der Kolonie Tausendschön beobachteten, ob die Angelegenheit gut oder schlecht für uns ausgehen würde. Denn schnell hatte sich herumgesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, Minnamartha und mich als nicht rasserein einzuordnen. Doch fotografische Platten und Zirkel rehabilitierten uns, wir bekamen unsere arische Anerkennung.
Ich kam in das Alter, in dem Kinder nützlich zu sein haben. Auch Jungen. Mädchen sind nützlicher. Sie spülen ab und polieren staubige Fußböden mit dem Mop. Mich hielt Ede an, im Garten Unkraut zu jäten, und weil ich das ungern tat, gab es darüber einige Auseinandersetzungen. Auf die Dauer blieb ich Sieger.
Doch kam die Zeit der Ernte heran, plumpste erst das Obst, so halfen keine Ausreden wie beim Unkraut. Hier hagelte es Landsberger Renetten. Dort wollten dicke, saftige Williams-Christ-Birnen dem Zugriff genäschiger Wespen entzogen sein. Die schlimmste Geißel jedoch, und damit begann die Erntezeit, waren drei Schattenmorellenbäume.
Sauerkirschen! Man kann ein Pfund davon essen oder zwei, oder auch zehn. Die Bäume aber lieferten Zentner. Minnamartha stellte ihre Uhr auf sechzig Minuten, Menschlein baggerte im Keller diesmal nicht Husarenstiefel aus, sondern ein gutes Dutzend Spankörbe, die im letzten Herbst dort unten verstaut worden waren, liftete die leicht verschimmelten, von Jahr zu Jahr mehr zertrümmerten, mit Strippe geflickten Behältnisse ans Tageslicht, und auf ging es zu den Bäumen, an denen die Sauerkirschen durchs Laub leuchteten. Bevor wir aber in die Bäume klommen, marschierte Alfons Reh ein, die zahme Dohle Jakob auf der Schulter.
»Mann«, sagte Ede, »später, später. Die Schattenmorellen sind reif. Wir müssen …«
»Weiß ich, weiß ich«, krächzte Herr Reh, und auch die Dohle sagte »weiß ich«, und dann meinte Herr Reh, Schattenmorellen gäbe es gar nicht.
Minnamarthas Uhr tickte, ich stand da mit den Körben und offenem Mund, die Dohle schaute unschuldig ins Gelände, und Herr Reh schnarrte los: »Was ihr meint, is ’ne Späte Amarelle, habe ick ooch, zwei Bäume. Ist noch massig Zeit zum Pflücken, da gehen doch die Stare nicht ran. An die sauren. Ich habe ja auch noch Büttners späte rote Knorpelkirsche, könn’se sich nich vorstellen, der Baum schwebt ja in de Luft, so viel Stare. Ick hebe immer den Tesching, denn haunse meistens ab. Aber kann ick den janzen Tach untern Kirschbaum sitzen? Ick dreh mir um, füttere Jakoben, der mach keine Kirschen, schon sind die Biester wieder da. Denn beißense in die Kirschen und schmeißen die mir ooch noch uffn Kopp. Son Ärger hat man mit späte Knorpelkirschen sage ick Ihnen. Ooch große Prinzessinkirsche habe ick, is derselbe Ärger. Nur früher. Allet schon jefressen. Wat machense denn mit de späte Amarelle?«
»Schattenmorelle«, korrigierte mein Vater sanft. Aber Herr Reh wollte davon nichts wissen, »Amarelle«, krächzte er, und »Amarelle« krächzte auch die Dohle Jakob.
Ede gab sich geschlagen. »Einwecken«, sagte er. »Aber nun müssen wir wirklich.«
»Einwecken, jut, jut«, meinte Herr Reh, oder jedenfalls verstanden wir seine Grobhobelgeräusche so. Dann ging er. Wir in die Bäume, eine Stunde sollten wir ja schon oben sein, Minnamarthas Uhr musste gleich klingeln.
Wenn wir mal beim Kirschenpflücken waren, gabs keine Ruhe, bis die Körbe voll oder die Bäume leer waren. Wir pflückten, zwanzig Minuten hingen wir im Grün, da bildete sich jenseits vom Zaun eine Volksversammlung. Wanda Puvogel stand da wie der Bismarckturm an der Havelchaussee, einen Finger in der Nase, und grinste. Drum herum Gigi, Häschen, sogar Irmchen, die nur selten ihren Garten verließ, aus Angst, es könnte donnern. Schließlich kam auch Ingrid, wie immer eine Hand unter dem Rock, und auch ein paar Erwachsene standen im Hintergrund.
Und alle grinsten. Oder lachten laut. Ingrid sang ihr Zitronenlied in passender Abwandlung, indem sie Zitrone durch Kirsche ersetzte. Sie sang: »Kürsche, Banane …«
Sie grinsten, sie lachten, tanzten auf dem Sandweg umher, und amüsierten sich wie Bolle aufm Milchwagen. Warum?
Schamrot, wie ich damals zwischen den Zweigen hing, erntend, erlebte ich Minnamarthas zweiten Tick. Wahrscheinlich hatte sie ihn durch jahrzehntelange Lektüre jener Kleingärtnerbibel entwickelt, die Das grüne Jahr hieß: Sie meinte, die Fruchtansatzknoten der Kirschbäume würden beschädigt, wenn man die Kirschen mit Stumpf und Stiel herunterriss. Ließ man andererseits die Stiele am Baum, hatte man Matsch im Körbchen.
Also verfiel meine Mutter auf die sinnreiche Idee, uns jedem eine – Schere in die Hand zu drücken, mit dem Befehl, die Kirschenstiele mittendurchzuschneiden! Solcherlei sprach sich herum, kaum zu glauben, das musste man gesehen haben! Und so ernteten wir Jahr für Jahr vor großem Publikum, schnapp, die Kirschen ins Körbchen, Gelächter draußen, Minnamartha ungerührt, manchmal klingelnd, Äste gefährdend, wenn sie sich trotz Übergewicht Kirschen schneidend in die Äste schwang, die blitzende Schere im Anschlag, Ede grinste, auf Hilfskräfte lauernd, die er zu locken suchte mit dem Satz: »Wir haben noch ’ne Schere.« Mit Erfolg fast immer, nach einiger Zeit, meistens schon kurz nach dem ersten Klingeln von Minnamarthas Zeitzerhacker, saßen ein paar Nachbarskinder mit in den Zweigen, Reservescheren schwingend, die nur einmal im Jahr benutzt wurden, bei der Kirschenernte eben, der Schattenmorellenabschneidung oder Einbringung der Späten Amarelle, falls Herr Reh recht hatte.
Diesmal bekamen wir Ingrid dazu, die ausnahmsweise beide Hände für eine ihr wenig normal erscheinende Tätigkeit benutzte. Ingrid schmückte ihre Ohren mit roten Kirschenohrringen, verschmierte sich den Mund mit rotem Saft und rotem Mus. Und auch das in etwa weiße Makohöschen Ingrids bekam rote Flecken, denn sie zerdrückte mit ihrem Mädchenpopo manche überreife Kirsche. Ingrid klomm von Ast zu Ast, blieb am Kirschbaumharz hängen, aus dem sich wundervolle weiche Bernsteinkugeln formen lassen, ihre langen braun gebrannten Beine und Arme stachen durchs grüne Laub, ihre Lippen schmausten Rotes und sie fragte: »Warum klingelt es denn hier?«
Minnamartha vermied es, diese Frage zu beantworten, von mir bekam sowieso niemand Auskünfte, schon gar nicht, wenn ich damit beschäftigt war, Schamröte zu bekämpfen oder wenigstens zu verbergen, Ede trug gerade volle Körbe zur Veranda. Ingrids Frage blieb im Kirschbaum hängen.
Wanda Puvogel stand vorm Gartenzaun, jetzt auf einem Bein, den gehobenen Fuß rieb sie an der Wade, und grinste dumm. Eine Doppelpackung Persil! Das stand noch auf dem Konto Wanda. Ich schmiss ihr eine faule Kirsche an den Kopf. Wanda tat, als habe sie es nicht bemerkt.
Weckgläser klaubte Minnamartha aus dem unergründlichen Keller unter der Veranda, der Weckapparat mit dem Thermometer, das oben im Deckel steckte, schnaubte und puffte, und gefüllt wanderten die Gläser wieder in den Keller. Auf Papierbögen häuften sich die Kirschkerne, denn selbstverständlich wurden die Schattenmorellen – lassen wir es nun einmal dabei, trotz Herrn Reh – entstielt und entsteint, bevor sie in die Gläser kamen. Wenn man die Kirschkerne knackte, fand man innen ganz kleine weiße Kerne, die angenehm bitter schmeckten. »Nach Blausäure«, sagte Ede. In Mengen genossen, soll das giftig sein.
Kirschen runter, Ferien bald zu Ende – das traf nun auch für mich zu, schon warteten die Freunde mit Vorgartenglatze und Bleyle-Strickanzug, und die bunten Posthornstifte. Nun war ich groß verhältnismäßig groß jedenfalls, und das war vielleicht der Anlass, dass in meinen Eltern ein kühner Entschluss reifte. Das Programm »raus aus der Laube« startete diesen Sommer.
Dieses Programm brachte beträchtliche Unruhe in unser Leben, denn es hieß nichts anderes als: Ein Häuschen muss her. Ein Häuschen mit Garten … Ich merkte, dass untergründig was los war. Ede und Minnamartha spazierten jetzt zuweilen an den milden Sommerabenden aus der Kolonie heraus, in Richtung Siedlungshäuser.
Ein höchst erstaunlicher Vorgang! Denn wer was auf sich hielt, vermied, sich dort sehen zu lassen, bei den Mittelständlern mit Wohnzimmerschrank und Couchgarnitur, so nämlich, wussten einige zu berichten, die nicht umhingekonnt hatten, die Siedlungshäuser zu betreten, sah es dort aus.
Jawohl! Couchgarnituren hatten sie, und Stehlampen. Was also war in meine Eltern gefahren, dass sie dort herumspazierten?
Besonders gerne blieben sie vor einem unbebauten Grundstück stehen, das mitten zwischen den Siedlungshäusern lag, irgendjemand war ausgestiegen, bevor die Bauerei begann, eine Lücke klaffte.
Eine störende Lücke, wie die Siedlungsbewohner immer wieder versicherten. Aber sie hatten ja alle schon ein Haus. Also blieb die Lücke, fast tausend Quadratmeter, ein Spielplatz der blassen Siedlungshauskinder inzwischen, die sich nicht zu uns aufs Feld trauten, weil sie dort Hiebe bekamen. »Wenn wir euch da erwischen, kriegt ihr den Arsch voll«, versicherten wir ihnen. Weil sie abends früh in die Häuser mussten, benutzten wir diese Zeit, um ihre Höhlen auf dem Grundstück zu zerstören.
Und jetzt standen Minnamartha und Ede davor! Auch in der Laube gab es nun lange Gespräche, von denen ich nicht viel verstand, wir fingen ja gerade mal mit dem kleinen Einmaleins an, und zwischen meinen Eltern war die Rede von »zwanzigtausend« und happig großen Teilen dieser Summe. Ich ahnte: Bald würde diese wunderbare Laubenzeit zu Ende gehen. Und das gefiel mir nicht.
Zusammen mit meinem Onkel Adolar, dessen tragisches Ende damals noch nicht vorauszusehen war, hatte Ede die erste Laube gebaut. Eine Stube, eine kleine Küche mit Spundbrettern verschalt, ein Schuppen mit Waschküche, und ein Verschlag für die spätere Stallhasenzucht: Das war der Anfang. Draußen die Abessinerpumpe, die frisches, klares Wasser gibt, innen an den Wänden Petroleumlampen, mit goldenen Messingschildern hinter den Glaszylindern. Ernie Puvogel führte auch Leuchtpetroleum, das in Blechkannen aufbewahrt wurde, man setzte einmal Pfand ein, und die Blechkannen kreisten dann. Die Gaszylinder zersprangen oft, wenn man sie beim Anzünden der Lampen versehentlich schräg hielt. Auch neue Zylinder waren bei Puvogel vorrätig.
Später, immer mit Onkel Adolars Hilfe, kam dann der Anbau dazu. Ein Wohnzimmer, massiv, mit Rosentapete, und die Veranda, alles ohne Baugenehmigung. An der Decke hing eine Prachtlampe mit Plüschlampenschirm aus unserer Mietshauswohnung. Ohne Funktion, denn es gab ja keinen Strom, vorerst. Phonographen waren damals zum Aufziehen, mit Uhrwerk, die Kurbel für Kinder ziemlich schwer zu betätigen, wir hatten ein neueres Modell, dessen tonverstärkender Blechtrichter in einem Nussbaumgehäuse verborgen war. Eine quadratische Tür musste geöffnet werden, damit der Ton ungehindert entquoll. Das Radio, getrennter Lautsprecher- und Empfängerteil (mit frei stehenden Spulen und Röhren), betrieben wir mit einem Akku, der alle paar Monate zum Aufladen musste.
Aber die Lampe im neuen Wohnzimmer muss auf die Elektrizitätswerke als Herausforderung gewirkt haben. Eines Tages errichtete eine Baukolonne scharf nach Karbolineum duftende Holzmasten, und die Lauben wurden, mit Zähler für jede, ans Stromnetz angeschlossen. Die Petroleumlampen hatten ausgedient, ich brachte die Leihkanne zu Puvogel zurück, der mürrisch die zwei Mark Pfand herausrückte: Das tat er jetzt etwa zwanzigmal am Tag. Und es war noch ungewiss, ob der Petroleumgroßhändler die vielen leeren Kannen zurücknehmen würde. Selbst Wanda war so verstört, dass sie manchmal vergaß, zuzuschlagen, wenn ich, vorsichtig in der Eierpampe tappend, an ihr vorbeischlich. Ich brachte einige Ladungen Persil heil nach Hause und sogar eine Papiertüte mit zwei Kilo weißen Bohnen.
Weil die Stadt einmal dabei war, ihre Randgebiete mit Installationen zu versehen, gruben sie auch einen breiten Graben für einen Hauptgasstrang quer durch die Kolonie, dabei Rosen, Stiefmütterchen und grüne Bohnen in Menge vernichtend, und einige Lauben ließen sich auch ans Gas anschließen. Darunter auch wir: Gekocht wurde nun auf einem Gasherd.
Nur der Plan, auch eine Wasserleitung hierherzulegen, wurde so lange verzögert, dass der Krieg ihn ganz vereitelte. So fließt immer noch das Wasser aus dem Abessinerbrunnen, die Pumpe friert, obwohl strohumhüllt, im Winter manchmal ein, im Sommer muss man oben erst eine halbe Gießkanne Wasser hineingießen, bis der zusammengeschnurrte Kolben fasst und das Grundwasser heraufzieht. Aber jeder ist daran gewöhnt, keiner beklagt sich.
Niemand wäre auch damals auf die Idee gekommen, dass die hinten an die Lauben geklebten Torfmullklos schädlich für das Grundwasser sein könnten: Solch feinere Gedankensprünge waren einer späteren, umweltschutzbewussten Generation vorbehalten. Mensch, Tier und Pflanze gediehen prächtig in der ökologisch trotzdem ziemlich einwandfreien Ordnung der Kolonie Tausendschön.
In dem neu angebauten Wohnzimmer, das nun auch schon etliche Jahre alt war, stand das Sofa mit Umrandung, einem gebeizten und polierten Holzrahmen hinter der Lehne, mit einem kleinen Spiegel in der Mitte und zwei Konsolen links und rechts, die allerlei Nippes aufnahmen, unter anderem Edes Husarentrinkkrug Reserve neunzehnhundertacht, die Rauchverzehrerkatze und neuerdings eine Pekingente aus Porzellan, deren Schnabel abgebrochen und notdürftig wieder angeklebt war. Herkunft: unbekannt. Hier saßen die Eltern nun immer öfter, selbst wenn draußen die spätsommerliche Sonne schien, und zählten Geld. Der Winter kam, eingehüllt in Stroh stand die Abessinerpumpe vor der Tür, und langsam stellte sich wirklich heraus: Meine Eltern hatten beschlossen, ihr Dasein als Laubenmenschen zu beenden und Hausbesitzer zu werden. Zu diesem Zweck hatten sie nun das brachliegende Grundstück zwischen den Siedlungshäusern erstanden, und die Bebauung desselben schien nicht mehr fern zu sein.
Die Sache sprach sich herum, ich merkte es daran, dass Harald Buseberg seine penetranten Angebote ließ, mir die Schnürung der Holzhand seines Vaters gegen die einmal festgesetzten zehn Pfennige Gebühr ernsthaft zu vermitteln.
Ein erstes Zeichen. Das zweite war, dass mich die Bleylejungen jetzt gelegentlich auf dem Schulweg an eine Akazie fesselten, sodass ich, nach mühsamer Befreiung, zu spät nach Hause kam, oder dass sie mich ohne Vorwarnung in gefüllte Wassergräben oder Dornenhecken stießen.
Fatal. Denn was war mir wichtiger als Laubenkind zu sein?
Inzwischen konnte die zahme Dohle Jakob einwandfrei »Rotfront – Rotfront« rufen, was zu Ohren Herrn Gallerts kam, und es gab eine ziemliche Auseinandersetzung, aus der Herr Reh, Besitzer des kecken Vogels, als Sieger hervorging: Eines Nachts malte er den strahlend weißen Fahnenmast Herrn Gallerts mit frischer Farbe bis in Greifhöhe an, und am nächsten Morgen blieb der aufrechte und mutige, hier in dieser Umgebung aber sehr einsame Sturmführer mit seiner schnieken Uniform daran kleben. Natürlich bestritt Herr Reh die Tat, erfolgreich, und Sturmführer Gallert rächte sich, indem er jetzt an nationalen Feiertagen kontrollieren ging, ob wir alle dem Reichsflaggengesetz Folge leisteten. Wider seine Überzeugung musste Ernie Puvogel jetzt neue deutsche Flaggen, kleinste Größe, in sein Sortiment aufnehmen. Sie wurden allerdings nur gekauft, nachdem ein Schutzmann die Laubenbewohner einzeln auf dieses Gesetz hingewiesen hatte.
Minnamartha, von ihren Kaufhausfressorgien längst das geworden, was höfliche Leute »stattlich« nannten, hatte eine Art, sich mit Seitenschwung aufs Sofa zu plazieren, dass jedes Mal der Husarenkrug ins Wackeln kam, und im Laufe mehrerer Geldsitzungen geriet er hüpfend an die Vorderkante der Konsole, von wo ihn dann Ede mit bald unbewusstem Griff wieder zurückschob, bis zum nächsten Mal. Geldzählen machte damals noch mehr Spaß als heute, weil es weniger Papiergeld, dafür aber schwere Münzen gab, die Ein- und Zweimarkstücke, und stabile, silberklingende Fünfmarkstücke, die sogenannten Heiermänner. Dunkel war und ist mir die Herkunft dieser Bezeichnung, aber ein Heiermann war damals ein Vermögen wert, dafür konnte man ein ganzes Schützenfest kaufen, oder Ernie Puvogels halben Laden, oder mit der Eisenbahn bis Neuruppin reisen. Ein Heiermann stellte was dar.
Nun sah ich gelegentlich auf dem Tisch unter der Plüschlampe ganze Säulen von Heiermännern sich türmen, die dann in unbekannte Verliese verschwanden, ich dachte, in geheime Verstecke hier in der Laube oder im nahen Birkenwäldchen vielleicht, wo wir löcherige Emailleeimer und Sprungfedern fanden oder gebrauchte Präservative, denn von Banken – jenen auf die man Geld tut, – hatte ich noch nichts gehört.
Ede vertrauten die Banken, er besaß ja das Laubengrundstück und seine Taxen, reale Werte also, und er schob ihnen nun viele schöne Heiermänner hinüber. Für Ede rollten sieben Taxen, ein gut gehendes Geschäft, die Leute in dieser unbequem weitläufigen Stadt fuhren mit Leidenschaft Taxe, Privatautos hatten damals die wenigsten. Und Ede, fest entschlossen, den Sprung zum Hausbesitzer zu machen, fuhr jetzt selbst mit. Nachtschicht, weil das mehr brachte. Erstens war der Tarif höher, und zweitens gaben die Betrunkenen mehr Trinkgeld.
Alles wurde in Ziegelsteine, in umbaute Meter umgerechnet. Die Siedlungshäuser, vor wenigen Jahren errichtet, sahen alle mehr oder weniger gleich aus, von einer Wohngesellschaft auf billigste Weise errichtet.
Unsere neue Heimat lag noch winterlich brach, Grünkohlzeit war es, die Laube dampfte vor Hitze, weil mein Vater, vom Nachtdienst durchfroren, »tüchtig Einkacheln« befohlen hatte. Die Presskohlen waren im Schuppen neben den Stallhasen gestapelt. Der Architekt, der von der Siedlungsgesellschaft kam, musste erst die Jacke ausziehen, dann den Schlips lockern, dann die Ärmel hochrollen, fast bis dahin, wo er Gummibänder um die Oberarme trug, weil die Ärmel ihm sonst – im unaufgerollten Zustand – zu weit aus der Jacke geschaut hätten.
Der Architekt brachte viele Rollen mit, Blaupausen, auf denen das für uns vorgesehene Heim sehr nett aussah. »Ist doch ganz adrett, nicht?«, fragte jedenfalls Minnamartha, der Architekt bestätigte das geflissentlich, Ede brummte. Es gab Typ eins A, zwei A, zwei B und drei A. Sie unterschieden sich geringfügig in der Größe. Minnamartha war für einen mittleren Typ, das sah nicht so aufschneiderisch aus und war im Platz ausreichend. Damals wusste sie nicht, dass im Bezug auf Widerstand gegen die Druckwellen von Luftminen die geringste Mauerfläche am günstigsten ist.
Der Architekt rollte seine Papiere zusammen, seine Ärmel herunter, zog den Schlips zu, fuhr in Jacke und Ulster und ging wieder. Vier Monate später, es war März und der Jahrestag der Saarheimkehr, rollten Lastwagen an das Grundstück, das ich Dornimauge nannte. Der Architekt, leichtsinnig ohne Mantel, aber den Hut auf, sprang umher, verscheuchte die Siedlungskinder, die ihre eingestürzten Höhlen wieder aufbauen wollten, und wies Arbeiter an, wo sie die Markierungen zum Ausschachten setzen sollten.
Damals erledigte das keine Planierraupe an einem einzigen Tag, es gab auch keine Fremdarbeiter, sondern Schwarz-Weiß rauchende, Zigarettenbilder (das Deutsche Heer im Manöver) umherstreuende Arbeiter hoben das Loch für den Keller aus. Zwei Wochen lang. Inzwischen wurden Mauersteine angefahren und Zement und viel Kalk und Sand, in dem die Siedlungskinder wüteten, und bald wuchs unser Haus. Die Mörtelträger tranken viel Bier und trugen Holzklotzen und weiße Fußlappen. Mit gemessenem Schritt stiegen sie die Leitern hinauf. Oben klatschten die Maurer, die auch viel Bier tranken, den Mörtel geschickt auf die Steine, arbeiteten mit Wasserwaage und Senkblei, und zogen die Mauern hoch. Jene Mauern, die mich bald ganz trennen würden von den Freunden der Kolonie Tausendschön, von der zahmen Dohle Jakob, der Fummelpoplerin Ingrid, von Häschen mit den Polstern an den Handgelenken, von Busebergs Holzhand, dem Malzbier im Emailleeimer und den summenden Schmeißfliegen in der spundbrettverschalten Küche.
Eines Tages kam Herr Reh, Jakob auf der Jacke. »Sie bauen?«, fragte er. Ede zuckte verlegen die Schulter, sich seines Verstoßes gegen die Sitten der Kolonie Tausendschön bewusst. Minnamartha gackerte »Unverhofft kommt oft, nicht?« Die Dohle hielt den Kopf schräg und sah sie vorwurfsvoll an. Es wäre nicht nötig gewesen, denn ausgerechnet Herr Reh, Altkommunist und Züchter von Vögeln, die staatszersetzende Parolen krächzten, dieser Herr Reh überraschte durch die Mitteilung: »Ich baue nämlich auch.«
Herr Reh erklärte schnarrend und mit vielfachem Räuspern aus seiner strapazierten Raucherlunge, dass die Siedlungsgesellschaft ihr Areal erweitere, drei Häuser, nach der anderen Seite hin. Und so habe er sich entschlossen. Typ eins A nur, das Kleinste. Ganz bescheiden.
»Meine Frau will das so«, sagte Herr Reh und ging wieder, meine Eltern in Staunen zurücklassend.
Bei den gelegentlichen Expeditionen, die ich nun in unsere zukünftige Heimat unternahm, sah ich zuweilen auch Herrn Reh, den gewandelten zukünftigen Hausbesitzer, wie er seine Baustelle beaufsichtigte. Er hüpfte durch Geröll und Zementstaub, Jakob auf der Schulter, der sein Repertoire durch das Wort »Scheibenkleister« erweitert hatte. »Scheibenkleister«, sagte auch Herr Reh, wenn er ausrutschte, und dann beschimpfte er die Arbeiter, sicher doch seine einstigen Kampfgenossen gegen die braune Gefahr: »Gesindel«, rief er, »Ihr Betrüger da oben! Tagediebe! Wie viele Steine habt ihr heute wieder geklaut?«
Die Maurer lachten. Manchmal, wie aus Versehen, traf Herrn Reh ein wenig Mörtel, der von der Kelle spritzte. Die Dohle schlug erschreckt mit ihren gestutzten Flügeln und flatterte zu Boden. Herr Reh hob sie aus dem Staub auf. Er drohte mit der Faust nach oben, wo die Maurer standen und grinsten. »Tierquäler«, rief Herr Reh. -»Scheibenkleister«, sagte die Dohle.
Siegfried führte die Laubenkinder an, die Jungen, denn die Mädchen scharten sich ja um die kesse Ingrid. Siegfried ging im Augenblick in meine Klasse, obwohl er drei Jahre älter war. Er blieb so oft sitzen, dass sie ihm zu Ostern immer eine neue Bank ins Klassenzimmer stellen mussten, in den Normalbänken blieb er inzwischen stecken. Siegfrieds Mutter versuchte, die Misere durch betont knabenhafte Matrosenanzüge zu verschleiern, in denen Siegfried aussah wie Tarzan als Bootsmannsmaat. Wo Siegfried hinschlug, blieb kein Auge trocken. So war es mir eher unheimlich, als er an der Spitze einer Delegation von Laubenkindern vor unserem Gartenzaun erschien, schrill pfiff und mich so zur Pforte rief. Da hatte man zu folgen!
»Was ist?«
»Ihr zieht um? In die Siedlung?«, fragte Siegfried, an einem Grashalm kauend. Die anderen standen stumm um ihn herum, die Ponys vom Glatzemitvorgarten-Haarschnitt auf die Augenbrauen hängend.
»Noch nicht«, murmelte ich heiter lächelnd.
»Aber ihr baut?«
»Meine Eltern, ja, die bauen.«
»Da gibt es Zigarettenbilder?«
»Ja.«
»Abliefern. Bei mir. Wöchentlich!«
Siegfried drehte sich um, die Bande trabte ab.
Das war eine schöne Bescherung, hätte Minnamartha gesagt. Mir fehlten noch ein Haufen Bilder zur Komplettierung der Serie Das Deutsche Heer im Manöver.
Wenn ich die Bilder von der Baustelle jetzt bei Siegfried abliefern musste, rückte mein Ziel, alle Bilder dieser Serie zu haben, wieder in weite Ferne. Außerdem fand man längst nicht in allen weggeworfenen Schachteln Bilder, weil viele Arbeiter sie mit nach Hause nahmen, für ihre eigenen Kinder.
Vielleicht würde es mir gelingen, die alten Kavalleriestiefel, an die nun niemand mehr dachte, aus dem Keller zu mausen und sie Siegfried zu geben? Konnte ich mich damit freikaufen? Aber wenn er nun gar keine Kavalleriestiefel haben wollte? Auf so was konnte ich es vielleicht gar nicht ankommen lassen. Die Knaben, die ihn als Führer erwählt hatten, waren auch nicht von Pappe. Und außerdem drangsalierten sie mich sowieso auf dem Schulweg. Wenn ich ihnen die Bilder nicht brachte, wusste ich genau, was mir bevorstand. Der Zimmereiplatz beim Feld war ganz in ihre Hände gefallen.
Eine schöne Bescherung. Also trabte ich jetzt zweimal täglich auf die Baustelle und äugte nach leeren Schwarz-Weiß-Packungen, zog gleich auch noch eine Schleife zu der Großbaustelle – drei Häuser – auf der Herrn Rehs Eigenheim wuchs und graste auch da das Terrain ab. Allerdings musste ich das gleich nach der Schule tun, weil ich sonst in die Fänge der blassen Siedlungskinder geriet, die genauso hinter Zigarettenbildern her waren wie ich. Einzeln schaffte ich sie zwar, aber sie traten immer zu mehreren auf. Außerdem schmissen sie von Weitem Lehmbrocken nach mir, und zwei oder drei verkrustete Kopfwunden waren schon unter meinen Haaren versteckt, Krusten, die ich vor Minnamarthas Kamm hüten musste.
Wenn ich genau den Zeitplan einhielt, – noch ein bisschen später am Nachmittag war natürlich alles abgeerntet -, bekam ich genügend Bilder zusammen, um einige für mich abzuzweigen. Den Rest stellte ich für die wöchentliche Lieferung an Siegfried zusammen. Die Übergabe war einfach: Draußen pfiff es, und ich brachte die Bilder ans Gartentor. Erst mal nur solche, die ich schon besaß: Gulaschkanone auf dem Weg zur Front, oder: Leichte Panzer im Vormarsch. -Von Rückzügen war auf den bunten Bildchen keine Rede.
Bei der dritten Ablieferung allerdings fragte Siegfried:
»Wer bekommt eigentlich die Bilder von den drei Häusern?«
So scheinbar ahnungslos wie möglich fragte ich: »Welche drei Häuser?«
Siegfried ging blitzschnell in Vorlage und schob mir über das Gartentor hinweg eine, dass mir der Schädel dröhnte.
»Du kriegst gleich eine an’n Bahnhof, dass dir alle Gesichtszüge entgleisen«, zischte er. »Her mit dem ganzen Zeug! Du bist beobachtet worden!«
Ich trottete in die Laube zurück und holte noch einen Stapel Bilder. Siegfried steckte sie ein.
»Was habt ihr eigentlich gegen mich?«, fragte ich. Siegfried tippte sich an die Stirn.
»Bei dir zischt’s wohl, Brüderchen«, sagte er. Dann trottete er davon, lässig mit den Armen schlenkernd, ohne sich umzusehen.
Bei den Laubenkindern hatte ich verschissen. Bei den Jungs jedenfalls. Nur Harald Buseberg streckte ab und zu seine klebrigen Pfoten nach mir aus, kniff die Augen zusammen und fragte scheinheilig: »Einmal Holzhand schnüren gefällig? Nur zehn Pfennige!« Ich spuckte ihm eine dunkelbraune Lakritzenaule auf sein Blondauge. Er wischte es weg und schwieg fortan.
Während die Maurer die letzten hellgelben Ziegel aufeinandertürmten, wurde bei uns weiter Geld gezählt. Heiermanntürme, und nun auch schon allerhand Scheine, denn die Summen, die zu bezahlen waren, nahmen mehr Umfang an. Die Bank gab »Hüpekeken«, wie ich unter dem Tisch umherkriechend verstand. Hypotheken also. Von meinem der erwachsenen Sichtwelt entrückten Aussichtspunkt sah ich den Architekten fast täglich anmarschieren, bei Regen mit Galoschen, sonst in braunen Halbschuhen, die von Mörtelstaub bedeckt waren. Dies und jenes musste geändert werden. Ob Windfang oder nicht wurde schließlich nach einer langen Woche geklärt. Gemauerter Herd in der Waschküche mit Kupferkessel war im Preis inbegriffen, aber so was wollte Minnamartha nicht. Auch die Frage, ob »Oma sich oben selbst was kochen konnte«, ließ mich kalt. Oma wohnte bei meiner Tante in Küstrin. Warum sollte sie sich also »oben was kochen?«
Jedes Mal aber sagte der Architekt über dem Tisch: »Das ist im Plan nicht vorgesehen. Das kostet extra.« Es hätte auch was extra gekostet, den Waschküchenkessel wegzulassen. Also wurde er doch geliefert.
Unter dem Tisch wringelten sich die Beine meines Vaters. Minnamarthas blieben wie Säulen fest stehen, und sie war es denn auch immer, die schließlich entschied: »Das wird gemacht.« Oder »das wird nicht gemacht«. Wurde es nicht gemacht, fügte sie noch hinzu: »Kommt Zeit, kommt Rat.«
»Später wird es noch teurer«, sagte dann der Architekt fast drohend und stand auf. Bevor er ging, kraulte er mir unterm Kinn, falls er mich erwischte, und sagte: »Na, Sohnemann? Ein schönes Kinderzimmer bekommst du!«
Ich hatte es schon besichtigt, im ersten Stock des Rohbaus, zur Straße hinaus, mit einem großen Fenster, was mir gar nicht so recht war. Bei auch mäßig geschätzter Anzahl meiner zukünftigen Feinde, die sich aus Laubenkindern und Siedlungskindern zusammensetzen würden, erschien es mir angebrachter, mich hinter einer Brustwehr aus Sandsäcken zu verschanzen. (Wie das Deutsche Heer im Manöver.)
Hatten meine Eltern sich für eine Änderung entschlossen, verlief der Abgang des Architekten freundlicher, auch schneller, meistens ohne Kinnkraulen. Meine Eltern blieben dann betreten zurück, es roch plötzlich nach Teer, weil die Nachmittagssonne auf das Dach der Laube prallte, man hörte wieder die Fliegen summen. Dann sagte Minnamartha: »Das heißt ja mit der Wurst nach der Speckseite werfen, Ede. Ob das richtig war?«
Bildlich sah ich Minnamartha, als gewaltige Vorstadtamazone mit nacktem Arm, Wurst nach einer Speckseite schleudernd, in Ernie Puvogels baufälligem Laden, vor dem Hintergrund von Waschmittel- und Reisstärkeplakaten. Peng: Wieder ein Treffer! Ob die Würste am Speck hängen blieben, wie jene im Märchen von den drei Wünschen, die statt Nasen im Gesicht saßen? Ungeklärt blieb das. Aus Gründen der Sparsamkeit verschwanden Kasseler Rippchen und Eisbein mit Sauerkraut von unserem Küchenzettel, es gab mehr Gemüse aus dem Garten. Das Gemüse war zwar frisch, aber alle hassten es. Ede machte sich ein paar Stullen mehr, wenn er zur Schicht oder in sein Taxenkontor ging. Wir klagten, wenn die Hühner, die wir hielten wie alle Laubenmenschen, nicht genug Eier legten. Meine Mutter, in Furcht, ihr Gewicht nicht halten zu können, legte zweimal in der Woche die Schürze samt Eieruhr ab, packte die Handtasche, und marschierte den Kilometer Fußweg ins Café Dorfaue, wo sie sich an Schwarzwälder Kirschtorte und Mohikanern labte. Mohikaner, die so hießen, weil sie durch ihren teilweisen Schokoladeüberzug indianerbraun (oder wenigstens eingeborenenbraun) waren, gehörten auch zu meinen Leibspeisen.
Dies war Minnamarthas Geheimnis, auch während der Bauerei blieb sie gigantisch, fest auf Säulen ruhend. Zusammen konnten wir kaum noch ausgehen, denn ich war ein spindeldürres Kind, so dünn, dass einmal ein Ullsteinfotograf Bilder von mir machte, die veröffentlicht wurden, um Spenden für hungernde Kinder in Asien zu erheischen. Meine Streichholzbeine besaßen nur in der Kniegegend knotenartige Verdickungen, wie bei Fohlen oder Pelikanen. In Badekostümen für mein Alter schlotterte ich, am Brustkorb konnte man, wie mein Vater behauptete, selbst durch den Wintermantel hindurch die Rippen zählen. Wo Minnamartha und ich miteinander auftraten, bildeten sich Zuschauergruppen.
Da die Eltern beschäftigt, die Freunde rar waren, erinnerte ich mich Onkel Huberts, der eine Laube in einer anderen Kolonie bewohnte, vielleicht zwanzig Minuten zu Fuß entfernt. Onkel Hubert war von Beruf Bierfahrer, er roch auch nach Bier, nach Tabak, und trug Ribbelsamthosen. Onkel Hubert hatte sich in letzter Zeit rar gemacht, er fand es überflüssig, dass »wir bauten«.
Seine Begrüßungen mied ich. Durch ständigen Umgang mit schweren Bierfässern gekräftigt, drückte er einem die Hand, dass man sie Minuten lang zwischen die Beine stecken musste, bis der Schmerz nachließ.
Onkel Hubert widmete sich, auf etwa vierhundert Quadratmetern, vorwiegend dem Maisanbau. Die Körner verfütterte er an seine Hühner. Seine Laube lag, kaum zu entdecken, in einem Dschungel von Maispflanzen. Nur auf einem zweimal zwei Meter großen Rasenplatz vor der Tür war es möglich, jenen Liegestuhl aufzustellen, auf dem sommers nach der Arbeit seine damals siebzehnjährige Tochter Mathilde ruhte und sich bräunte. Eine tolle Motte, wie wir alle fanden. Schlank war sie, eigentlich aus der Familie geschlagen, wie ich auch, denn alle anderen waren kräftig und untersetzt. Mathilde trug die neuesten Sonnenbrillen mit dickem weißem Rand, schmierte sich Creme ins Gesicht und befleißigte sich einer neckischen Sprache, etwa: »Ach, Karlchen, Lütter, sind wir wieder mal da?« Onkel Hubert sagte schlicht, wenns ihm zu viel wurde: »Halt die Klappe, Mathilde.« Im Übrigen verstanden sich die beiden ausgezeichnet. Trotz der zickigen Tochter und eingedenk der Tatsache, dass Onkel Hubert außer seinem Händedruck wenig bot, ging ich doch gerne zu ihnen, trank, auf einem Küchenhocker sitzend, Muckefuck aus einer Blechtasse und verschlang ein Stück zerquetschten Streuselkuchen, den Mathilde in ihrer Handtasche mitgebracht hatte, eingezwängt zwischen all den sonderbaren Utensilien, die sie zur Erhaltung ihrer Schönheit brauchte, ihre Cremetöpfe eben, Haarkämme, Spangen, Duftwässerchen, Abführmittel und in einer Tube was gegen Gesichtspickel, unter denen sie litt. Ihr Freund war, so erzählte sie jedem, ein Matrose, der auf einem Zerstörer fuhr. Aber der Zerstörer legte nie an, oder er war in Grönland stationiert. Den Freund, später sogar als Verlobter bezeichnet, sahen wir nie. Wenn ich bei günstiger Gelegenheit Onkel Hubert danach fragte, zuckte er nur die Schultern. Für blaue Jungs war er nicht zuständig. Onkel Hubert tauchte erst wieder im Familienkreis auf, als das neue Haus fertig war, endlich fertig, nach Tapetenkleister und frischer Fußbodenfarbe riechend. Bereitwillig kamen er, in Ribbelsamthosen wie immer, und Onkel Adolar, der ein weißes Hemd und eine Fliege trug, der Aufforderung Minnamarthas nach, beim Umzug zu helfen.
Zuerst wurden die Teppiche ausgelegt, die nun hier, in der neuen Umgebung, ein wenig fadenscheinig wirkten. Weil die Farbe klebte, befahl Minnamartha: »Legt Zeitungspapier unter! Da, wo man hintritt!«
Schließlich brachte ein Tempodreirad in mehreren Fahrten das übrige Umzugsgut aus der Laubenkolonie, Betten, Tische, Chaiselongues wurden auf die einzelnen Zimmer verteilt, nahmen sich kümmerlich aus, denn in einer Wohnlaube ist eben weniger Platz.
Schweigend schauten die Nachbarn aus ihren Häusern zu, wie die Laubenmenschen ihr Gerümpel in dem neuen Haus verstauten, und wünschten uns sicher zum Einzug allerlei Übles. Nur Herr Reh, der erst in ein paar Wochen mit seinem Umzug dran war, brachte ein Alpenveilchen und Salz und Brot, das Salz in einem Säckchen. Noch viele Jahre später, vor dem Ende der Hausbesitzerepoche, entdeckte ich beides in einer Schublade, das Brot steinhart.
Onkel Hubert und Onkel Adolar gestalteten den Umzug zu einem lustigen Fest. Schon am Tag zuvor hatte Onkel Hubert, mit seinem Bierfuhrwerk vor den hoch sich türmenden Aushubsandbergen parkend, ein Fässchen Bier abgeworfen. Onkel Adolar brachte eine große Flasche Korn, und Minnamartha hatte Puvogel aufgetragen, eine Speckseite zu liefern, wie ich dachte, um mit der Wurst danach zu werfen, aber sie wurde von den hungrigen Onkels und dem Tempodreiradfahrer vertilgt. Mathilde radelte einen Laib Brot herbei, der ein wenig nach Parfüm roch, und meinte: »Ach, Gotteken, seid ihr schon weit. Wo soll denn das Klavier hin?« Klavier hatten wir gar keins. Daran merkte man, wie dämlich Mathilde war.
Immerhin machte sie sich nützlich, indem sie Schallplatten auflegte, das Grammofon hatte sie gleich aus dem Umzugsgut ausgegraben. So wuchteten Ede, der Tempofahrer und die Onkels Möbel nach den schönen Klängen von Ännchen von Tharau. – »Hau ruck«, sagte Onkel Hubert (das Bierfass wurde schnell leerer), und brach ein Bein vom Vertiko ab. Das fanden alle ungeheuer witzig, nur Minnamartha nicht. Ännchen von Tharau hallte fürchterlich laut in den fast leeren Räumen. Herr Reh lud den Blumentopf und Brot und Salz ab und blieb auch, mit Dohle. Die Dohle mochte Bier.
Allmählich begann Unordnung sich auszubreiten, die Möbel blieben teils im Korridor stehen, teils trugen die Männer sie in falsche Zimmer. Mathildchen kurbelte wie wild und rief: »Männer, ran!«. Meine Mutter eilte wuchtig hin und her, um möglichst an allen Stellen zugleich Unheil zu verhüten. Schließlich saßen die Männer um den großen Tisch, auf Gartenstühlen, weil ihnen die zuerst in die Hände gekommen waren, zwischen sich mitten auf der Tischplatte das große Fass, den Speck noch auf dem durchgefetteten Papier, und erzählten sich anscheinend die witzigsten Geschichten ihres Lebens, denn manchmal war vor lauter Lachen das Grammofon nicht zu hören.
Onkel Adolar hatte eine ganz neue Platte drauf, er sagte dauernd: »Grüß Gott, Frau Berger, ’s wird immer ärger«, oder »das schmerzt im Schritt, aber nicht unangenehm«. Die anderen fanden das ungeheuer komisch und lachten. Minnamartha rief »aber, aber«, und Mathildchen sang laut und falsch: »Was kraucht dort in dem Busch herum? -Ich glaub, es ist Napolium!« und imitierte dazu einen orientalischen Bauchtanz. Onkel Adolars Fliege hing auf der heute gelieferten neuen Stehlampe, so was hatten wir nun also auch, sein weißes Hemd wies alle Sorten Flecken auf, vorn und hinten. Tante Linchen, schwarzhaarige Frisöse aus Lauenburg an der Elbe, mit der er seit zehn Jahren verheiratet war, würde schön schimpfen.
Auch Onkel Adolar war das klar. Trotzig trank er vier doppelte Schnäpse, sang »Heut’ ist Kaffeeklatsch bei Tante Linchen, heute meckern sich die Tanten satt«, und brach zusammen.
Sie schafften ihn ins Nebenzimmer, das Fest ging weiter. Die Kornflasche war bald leer, und Onkel Hubert warf eine Speckscheibe gegen die Tapete, wo sich ein Fettfleck bildete. Mit vereinten Kräften hängten die Umzieher jenes Kolossalgemälde über den Fleck, das bei uns aus Platzmangel nie einen Platz gefunden hatte: Reiter am Bodensee von Professor A. Müller, München. Ein nackter Reiter, von hinten gesehen, ritt bei aufziehendem Gewitter Ross und Handpferd in die Schwemme, während Möwen über der Gruppe kreisten. Dann gingen sie.
Ede schlief mit dem Kopf auf dem Tisch.
Minnamartha weinte.
Am nächsten Morgen betrachtete ich Professor A. Müllers Gemälde, haarscharf peilte ich am leeren Bierfass vorbei, sah den nackten Reiter, den ich lange, bei gelegentlicher Besichtigung des Kunstwerks im Laubenkeller, für eine Dame gehalten hatte, der Löckchen wegen, die sich in seinem Nacken kräuselten. Aber nun, im Frühlicht, das durch die großen Neubaufenster fiel, war mir klar: Ein männlicher Reiter war’s, der dem Unwetter auf dem Rücken seines Pferdes zu trotzen gewillt war.
Als ich an diesem Tag aus der Schule kam, zeigte sich das Haus in neuem Glanz und bewohnbar. Die meisten Möbel standen dort, wo sie hingehörten. Das Bierfass war weggeräumt, und kunstsinnig hatte Minnamartha weiteren Wandschmuck arrangiert. Im Nebenzimmer, das man durch einen Wanddurchbruch betrat, hatten bauliche Notwendigkeiten eine Nische geschaffen, in die haargenau eine Chaiselongue passte. Der Platz über der Chaiselongue schrie, wie meine Mutter sich ausdrückte, nach einem Wandbehang.
Nicht ungehört war dieser Schrei verhallt. Aus allerlei Laubenkellertrödel hatte Minnamartha eine maschinengewebte Tapisserie geborgen. Am rechten Rand des Textilkunstwerkes stand im inlettroten Kleid eine schöne, junge Schäferin, zwischen einer Herde von nur drei oder vier Schafen, die sich auf Felsbrocken um sie gruppierten. Die Schäferin bedeckte die Stirn mit ihrer Hand, um einen Nachen besser sehen zu können, der, zwanzig Zentimeter entfernt und mit drei Personen besetzt, dem Ufer eines grünlichen Sees zustrebte, eben jenem felsigen Rand, auf dessen Höhe Schäferin und Schafe sich befanden. Im Hintergrund erhoben sich Berggipfel bis zum oberen Rand des Wandteppichs. Das Verblüffende war, dass sich die Schäferin am linken Rand des Bildes noch einmal wiederholte. Auf verlorenem Posten stand sie, denn dort musste sie notgedrungen ins Nichts gucken, oder höchstens auf die golddurchwirkte Tapete, die Ede und Minnamartha mit feinem Sinn für Neubauluxus hier hatten kleben lassen. Der See war abgeschnitten, der Rand des Teppichs grün gesäumt. Es handelte sich um einen Wandbehang vom Meter, auf dessen Bahn sich die Motive wiederholten.
So war das neue Haus schnell in eine Stätte des Ästhetischen verwandelt, wo es sich leben lassen musste. Auch das mir zugewiesene Zimmer, zwar nach Norden gelegen und trotz des großen Fensters ein wenig dunkel, glänzte durch reiche Dekoration. Diesmal auf meine Veranlassung war das Kavalleriebild mit Ede hier aufgehängt worden, dazu noch einmal Ede im Buntdruck bei der Attacke mit eingelegter Lanze, und ein vernickelter Säbel, Scheide und Klinge gekreuzt.
Die Klinge reich ziseliert, ein Paradedegen also. Ich konnte zufrieden sein.
Ein anderes Zimmer im ersten Stock, klein, aber sonnig, war ganz anders eingerichtet als die übrigen Räume. Dort gruppierten sich neben einem Messingbett Alte-Damen-Möbel: ein Kommödchen, ein Vertiko, ein Lehnsessel mit vielen Schnörkeln. Ob Oma sich oben was kochen kann, -die Frage war nicht gelöst. Augenscheinlich aber war dieses Zimmer für Oma bestimmt, für meine Großmutter, die also anscheinend die Tante in Küstrin zu verlassen gewillt war, um hier Quartier zu nehmen.
Küstrin, jene Festung, in der Kronprinz Friedrichs Freund Katte hingerichtet worden war, lag an der Bahnstrecke von Schneidemühl, und aus jener Richtung war meine Großmutter ursprünglich gekommen. Jahrelang hatte sie sich polnischen Behörden widersetzt, die sie, nach verlorenem Krieg, von ihrem Wohnsitz im sogenannten Korridor, früher Westpreußen, später Generalgouvernement, zwischendurch und neuerdings wieder Polen, vertreiben wollten. Schließlich wurde die Angelegenheit lästig, die Polen mochten unter sich sein. Großmutter packte zwei Reisekörbe und eine Holzkiste, auf der Hoffman’s Reisstärke zu lesen sowie ein Katzenkopf abgebildet war, mit ihren Habseligkeiten und etlichen Dauerspeckseiten, beantragte eine Fahrkarte und bestieg den Dampfzug Richtung Westen. Küstrin war ihre erste Station, dort wurden – es waren wieder einmal schlechte Zeiten – die Speckseiten verzehrt. Dann hieß es, Großmutter würde zu uns ziehen.
Eines Tages war es so weit. Ede holte Großmutter mit einer seiner Taxen vom Bahnhof ab, er fuhr vor, eine mir uralt erscheinende Frau stieg aus, mit Dutt und runder Brille, beäugte das Haus und sagte: »Teufelnicheins.« Dann begrüßte sie uns. Die leere Kiste von Hoffman’s Reisstärke hatte sie mit.
Unsere Nachbarn zeigten sich, die neue Zeit betreffend, linientreuer als das Laubenvolk, das mit Ausnahme Herrn Gallerts der neudeutschen Bewegung ja misstrauisch und ablehnend gegenüberstand. Die halbfeinen Siedlungspinkel trugen Parteibonbons oder gar, an Sonn- und Feiertagen, sogenannte Goldfasanuniformen mit Breeches, und auch die Kinder liefen oft in Pimpf- und BDM-Uniformen herum. Auf uns waren alle sauer, die Kinder, wie ich vorausgesehen hatte, besonders auf mich, denn ihr schöner Spielplatz war hin. Die Laubenkinder hatten versucht, die Fenster unserer Laube einzuschmeißen, was Ede verhinderte, indem er Fensterläden und Türen mit schweren Vorhängeschlössern sicherte. Jetzt zogen sie, der stramme Siegfried an der Spitze, mit Stecken bewaffnet durch die Siedlung und verprügelten die feinen Kinder. Mich auch. Gegen Würfe mit Lehmklütern zeigten sie sich unempfindlich. Zwar saßen wir in der Schule in derselben Klasse, aber diese Gemeinschaft war bereits am Schultor aufgehoben. Schwere Zeiten.
Uns gegenüber wohnte Othmar, ein schöner, blond gelockter Knabe. Bald erwies Othmar mir herablassend die Ehre seiner Freundschaft, die etwa einem Herren-Diener-Verhältnis entsprach. Ich durfte seinen Ranzen tragen, und wenn wir mit Lineolsoldaten auf den Sandbergen vor unserem Haus spielten, wurden meine Linien bombardiert, seine nicht. Die Lazarette waren überfüllt. »Es macht dir doch nichts aus?«, fragte Othmar. Menschlein beeilte sich zu versichern: »Selbstverständlich nicht.« Von meinem Feldmarschall Blomberg ging der Grußarm verloren, den man zum Helmrand bewegen konnte. Da war ich ein bisschen traurig.
Othmar fand, ich sei wenig mutig. Deshalb band er mich manchmal nachmittags an einen Baum, mit dem Hinweis, ich müsse mich an diese Marter gewöhnen. Dabei hätte ich ihm mindestens fünf Akazien zeigen können, an die mich die Laubenkinder früher gefesselt hatten. Minnamartha suchte mich lange, befreite mich zuweilen, einige Male gelang es mir, die Fesseln selbst abzustreifen. Ich schob alles auf die Laubenkinder, denn ich wollte mir Othmars Freundschaft erhalten.
»Kind, was soll das noch werden«, sagte Minnamartha.
Einmal nahm ich Othmar mit zu Onkel Hubert und Mathilde. »Ach, diese süßen Löckchen«, piepste Mathilde, ungeheuere Crememengen auf ihrem Antlitz verreibend. Onkel Hubert drückte Othmar die Hand. Darauf behandelte Othmar mich drei Tage lang mit Hochachtung.
Auch Ede, mein Vater, war zuerst in der neuen Umgebung nicht sehr glücklich. Von den Nachbarn kamen wiederholt Beschwerden, weil Edes Lachtauben schon morgens um fünf zu gurren anfingen. Um die Zeit stand hier noch niemand auf. Außerdem kostete das Haus weiter Geld, Hypothek und Amortisation mussten zurückgezahlt werden, der Endausbau verschlang große Summen. Die Heiermänner rollten dahin. Großmutter schüttelte bedenklich den Kopf und murmelte:
»Das wird bös enden.«
»Nu macht mal nen Punkt«, sagte Ede eines Tages. »Wir lassen alles, wie es ist. Wenn die Zeiten so weitergehen, sind wir sowieso im Eimer. Diesen Sommer verreisen wir.«
»Ede, du bist verrückt?«, rief Minnamartha. Großmutter beschwichtigte: »Abwarten. Es ist ja erst Mai.«
Dieser Mai kam mit sengender Hitze. Auf dem Schulhof sprengte der Hausmeister den staubigen Kies. Ein erfrischender Geruch drang durch die offenen Fenster in die Klasse. Großmutter suchte im Garten nach den ersten reifen Erdbeeren, so lange sie denken konnte, hatte es so früh noch keine gegeben. Der Biermann kam jetzt jeden Donnerstag und lud ein kleines Fass Pupenbier ab. Der Eismann brachte eine Stange Eis. Die Posthornstifte, mit denen ich am Nachmittag nun erste vollständige Sätze ins Heft malte, schmierten.
Der Juni kam, und schließlich gab es große Ferien. Es wurde wieder einmal Geld gezählt, schließlich ging es um unsere Reise. Großmutter wollte daheimbleiben, sie hielt nicht viel davon, dass Leute ohne Sinn und Zweck in der Gegend umherfuhren. »Hier ist genug Gegend«, sagte sie. Gut, das kam billiger.
Trotzdem krachte Minnamartha verzweifelt aufs Sofa und murmelte: »Meingottmeingott, wir können uns das gar nicht leisten.« Ede lachte: »Wollt ihr warten, bis der Führer euch zwangsverschickt?«
Dann ging es los, wir wollten an die Ostsee. Ede hatte vor ein paar Monaten eine Taxe in einen Privatmietwagen umgewandelt, und in dieses Gefährt verstauten wir so ungefähr ein Drittel des Hausinhaltes. »Ede«, hatte Minnamartha gerufen, »glaubst du etwa, ich schlafe in fremden Betten? Wir nehmen doch unsere Federbetten mit!« Und: »Ede, die Handtücher. Stell dir vor, in einer Pension, wer sich schon alles mit den Handtüchern abgetrocknet hat. Ede, da wollen wir doch unsere eigenen Handtücher haben!«
Endlich war alles verstaut, wir wollten an die Ostsee. Um zehn fuhren wir los. Um neun hatte ich noch auf dem zum letzten Mal vor den Ferien gesprengten Schulhof gestanden, im Karree angetreten mit den anderen Jungen, und hatte heimlich mit der linken Hand meinen rechten Arm gestützt, den man zwei Lieder lang hochhalten musste. Aber jetzt rollten wir aus der großen Stadt hinaus, in deren Straßen die Hitze flimmerte, und Kornfelder waren da und Wälder und Sonne. Als wir zum Picknick hielten, fuhren ein paar Radler vorbei. Der eine sagte: »Kieck mal, der hat Berliner Luft in de Reifen.« Ede drückte auf die Tube, wir brausten durch jene Heide, auf der die Bisons des neuen Reichsjägermeisters weideten, eine Rückzüchtung. Bisons waren im Aussterben begriffen, seit Buffalo Bill und andere Amerikaner sie in der Prärie abgeknallt hatten, vom Fenster der Expresszüge aus zuletzt. Schließlich kamen die Dünen und das Meer und die Strandkörbe und der Anlegesteg für den kleinen Küstendampfer. Ede zog weiße Leinenhosen an, eine blaue Jacke, setzte eine Seglermütze auf.
Er sah zum ersten Mal genau so aus wie die Leute um ihn herum. Das gefiel mir.
Die Zimmer der kleinen Pension, in der wir lebten, unterschieden sich kaum von zu Hause, weil Minnamartha auch Sofakissen und Zierdeckchen eingepackt hatte, die sie überall ausbreitete. »Ist es nicht schöner so?«, fragte sie stolz, im Gesicht glühend. »Wunderbar«, sagte Ede. »Wie in der Bärlappstraße.«
Es fehlte nur der Wandbehang, der Reiter am Bodensee und der Husarenkrug.
Wie Ede und Minnamartha einander mehrmals täglich versicherten, erholten wir uns glänzend. An Großmutter schickten wir eine Postkarte: »Gruß aus Ahlbeck«. Ede zog seinen schwarzen Badeanzug mit fast knielangen Beinlingen an, trabte im Bademantel an den Strand und schwamm weit hinaus. Meine Mutter bezog den Strandkorb, der unter ihrem Gewicht jeden Tag ein bisschen weiter einsank, und versteckte sich hinter Strohhut und aufgespanntem Sonnenschirm, einem lieblichen Modell, weiß mit blauen Blümchen.
Ede stieg aus dem Meer, an dessen Rand ich stumm meine Kanäle in den nassen Sand grub, und zog mich mit sich zum Burgenbau. Denn es war hier eisernes Feriengesetz, den Strandkorb mit einem möglichst hohen Wall zu umgeben. Wir schaufelten. »Kinder, ich sehe nichts mehr«, rief Minnamartha, wenn sie ihre Mottenpost einmal zur Seite legte. Aber darauf konnten wir keine Rücksicht nehmen. Nur eines unterschied unsere Strandburg von den anderen: Bei uns wehten weißblaue Niveafähnchen. Überall sonst Hakenkreuzpapierfähnchen.
Am Nachmittag, wenn meine Mutter sich in der Pension auf ein ebenfalls mitgebrachtes Ziehharmonikabett zur Ruhe gelegt hatte, zog Ede seine weißen Hosen an und das dunkelblaue Jackett, und ich meinen Kieler Matrosenanzug mit blauer Mütze und der Inschrift SMS Tirpitz in Goldbuchstaben auf dem Mützenrand. Dann gingen wir auf die Strandpromenade.
In einer riesigen, weiß und golden bemalten Muschel schmetterte die seemännisch gekleidete Kurkapelle Märsche, mit golden funkelnden Instrumenten. Ede wusste für einige Melodien hübsche Texte, die er mir manchmal, zum Erstaunen der Umstehenden, leise vorsang. Etwa: »Wir wollen unsern Kaiser Friedrich Wilhelm wiederha’m, aber den – mit’m Bart, aber den – mit’m Bart.«
Oder: »Es lebe unser Herr und König, dreiundzwanzig Pfennig sind zu wenig, ’nen Taler woll’n wir haben, und den kriegen wir nicht, – und für dreiundzwanzig Pfennig präsentier’n wir nicht!«
Oder den allerschönsten vom Sanitätsgefreiten Neumann, der den neuen Büstenhalter erfunden und den Damen damit sehr geholfen hatte. Das konnte ich verstehen, wenn ich an Minnamarthas Doppelbehälter dachte, diese Lawinenbremsen aus starkem Gewebe. Ich war sicher, dass Minnamarthas Modelle aus Sanitätsgefreiter Neumanns Werkstatt stammten.
Einen Text konnte ich aber auch, doch ein Instinkt befahl mir, ihn besser für mich zu behalten. Vom starken Siegfried hatten wir gelernt, zu einer damals ebenfalls häufig gespielten Marschmelodie zu singen: »Pauline steht im Hemd, vier Finger in den Arsch geklemmt. Und Paul, der steht dabei – und schaukelt sich das linke Ei.«
Überhaupt entwickelte Ede in den Ferien Sangesfreude. Wir marschierten über die Dünen und sangen. Wir liefen am Strand entlang und sangen. Wir trampelten über die schmalen Sandpfade, die sich von den Dünen durch den Fichtenwald zogen, und sangen.
Ede wusste viele Lieder. Ganz andere als ich später lernte. Lieder von der Fischerin, der kleinen, vom treuen Husaren und vom Reiter, der drei Lilien umritt. Ich marschierte hinter Ede her, die Schuhe voll Sand. Der Kragen vom Matrosenanzug flatterte in der frischen Brise, die vom Meer herwehte.
So schön war es damals im letzten Sommer.
Ein frischer Nordwest wehte am letzten Ferientag. Der Küstendampfer tanzte an der Mole auf gut meterhohen Wellen, ein paar Passagiere, die nach Heringsdorf wollten, verzichteten auf die Reise. Menschlein und andere Nichtschwimmer plantschten in Strandnähe, Ede schwamm wie jeden Morgen hinaus. Minnamartha bemerkte nichts von den Gefahren, in die wir uns begaben. In der Pension packte sie unseren Kram zusammen. Keine leichte Arbeit. Inzwischen waren zwei Beutel original Seesand und etwa hundert Muscheln dazugekommen, auch ein paar Tigermuscheln und eine Große Flügelschnecke. Das Meer rauschte in ihr, wenn man sie ans Ohr hielt. Ich war froh, sie zu besitzen, denn immer hatte ich Gigi beneidet, bei der ein paar Exemplare der Flügelschnecke das Rosenrondell vor der Laube schmückten. Auch ein Segelboot aus dem Spielzeugkiosk an der Promenade kam ins Gepäck. Mit zwei Masten.
Wieder brausten wir über die Landstraßen, das Korn war noch gelber geworden, bald würden die Bauern anfangen, es zu mähen. Wir fuhren wieder an den Bisons vorbei, in die große Stadt zurück, die immer noch von der Hitze flimmerte und glühte. Großmutter stand vor der Tür und begrüßte uns. »Der Lümmel sieht ja endlich mal jesund aus«, sagte sie.
Ede bekam viel zu tun in den nächsten Tagen. Die Taxen hatten einen Service nötig und neue Zündkerzen, die Abrechnungen mussten geprüft werden, einige Wagen brauchten neue Reifen. Das hörte ich gerne, denn Ede brachte mir dann Jo-Jos mit. Jo-Jo-Spielen war damals fast eine Epidemie. Alle Welt spielte Jo-Jo, auch Damen mit Ponyfransen und langen Zigarettenspitzen wie meine Tante Lizzi, oder Männer wie Onkel Adolar, sogar Onkel Hubert, der Bierfahrer. Er hatte gerne ganz große Jo-Jos mit Holzscheiben.
Ein Jo-Jo besteht aus zwei eng aneinanderliegenden kreisrunden Scheiben beliebigen Materials. Um die Nut zwischen beiden Scheiben ist eine Schnur gewickelt, deren eines Ende der Spieler fest in der Hand hält. Durch rhythmische Auf- und Abwärtsbewegungen des Unterarms muss er die Doppelscheibe auf der Schnur tanzen lassen.
Das war Jo-Jo.
August. Nachmittags zog hinter den Funktürmen das Gewitter heran. Aber es dauerte nur eine Dreiviertelstunde. Abends war es im Garten angenehm kühl. Onkel Hubert, den das neue Haus nun interessierte, kam von seinem Kleingarten herübergeradelt, manchmal mit Mathilde, die ein neues Damenrad besaß. Der Eimer mit gekühlten Bierflaschen stand bereit, Großmutter knackte mit ihren restlichen Zähnen Kirschkerne und aß den Innenkern. Edes ewige Zigarre, Marke Boenicke Fehlfarben zu dreißig Pfennigen, glühte in der Dunkelheit. Mein Jo-Jo aus vernickeltem Blech fuhr glitzernd an der Schnur auf und ab. In der Nähe der Garage roch es nach Benzin und neuen Reifen. Schon Ende August fing die Schule wieder an.
Mich faszinierte, dass Mathilde winzig kleine Büstenhalter trug. Sie stopfte ihre Dessous in eine Badetasche, wenn sie im Strandanzug bei uns im Garten lag. Ich holte Othmar und gewann seine Gunst wieder, weil ich ihm heimlich diese Kleidungsstücke vorführte.
Unsere Eltern merkten wenig von dieser Neugier, obwohl ich regelmäßig aus der zweiten Reihe auf dem Vertiko ein Buch auslieh, das sie eigentlich hätte auf die richtige Fährte bringen müssen. Othmar und ich saßen in einem der abgeernteten Kirschbäume auf unserem Laubengrundstück. Den Platz hatten wir nur erreicht, indem wir vom Feld her über mehrere Zäune kletterten, um Siegfried und seinen Mannen zu entgehen. Im Grün verborgen lasen wir nun alles über die schädlichen Folgen der Selbstbefriedigung, über Beischlaf und Schwangerschaft. Als wir das Buch ausgelesen hatten, fühlten wir uns wissend.
Neuland und Fremde überall. Karl Kaiser aus der Laube hatte sich mit der Welt der Siedlungshausbesitzer abzufinden. In den Häusern der anderen Kinder sah es ein bisschen prächtiger aus als bei uns. Vieles, bildete ich mir ein, ließ bei uns zu wünschen übrig. Manchmal schlich ich mich in die Kolonie Tausendschön, zur Laube, öffnete mit dem Schlüssel, den ich heimlich an mich genommen hatte, das schon rostige Vorhängeschloss und setzte mich im leeren, dunklen Zimmer auf den Fußboden. Allein.
Dann zog es mich wieder in die anderen Häuser mit ihren bis zum Boden reichenden Vorhängen, den polierten Möbeln, den weichen Teppichen, kühlen Lederklubsesseln und den Blumenstillleben über der Esszimmeranrichte. Ich war nicht mehr Laubenkarl, aber Häuserkarl war ich auch nicht. Edes und Minnamarthas Einfamilienhaus war eine Schleuse, in der ich hängen blieb. Ein Vor oder Zurück schien es nicht zu geben. Wir besaßen das einzige Sofa mit Umrandung in der Siedlung, den einzigen Karnickelstall, den einzigen Kavalleristenbierkrug, den einzigen Schleppsäbel. Selbst Herr Reh, der Altkommunist im kleinsten Haustyp, hatte sich besser angepasst. Er freute sich über einen modernen Wohnzimmerschrank, Mittelteil flambiert Birke, eine wild gemusterte Couch und über einen Musikschrank in imitierter Eiche. Nur seine Fahne war noch kleiner als unsere, es musste sich also um eine andere Lieferung handeln als jene, die Puvogel für die Kolonie eingekauft hatte.
Herr Reh musste regelmäßig von einem Nachbarn in brauner Uniform ermahnt werden, sein Fahnentuch herauszuhängen. Zu diesem Zweck hatte er ans Küchenfenster, das zur Straße ging, einen Fahnenschuh geschraubt. Wurde die Fahne nicht gebraucht, stopfte Herr Reh sie in den Besenschrank.
An Herrn Reh probierte ich meinen deutschen Gruß aus, weil es mit dem Vorbeimarsch an Herrn Gallerts Flaggenmast ja aus war. Aber Herr Reh und seine Dohle sagten stets mit gleichbleibender Freundlichkeit »Guten Morgen« oder »Guten Tag«. Da Herr Reh, als einziges Laubenerbe, eine Milchziege auf der Terrasse hielt, holte ich bei ihm jeden Tag einen halben Liter frische Milch. Eine Anordnung von Großmutter, nicht zu umgehen, sie sollte zur Kräftigung meiner immer noch geschwächten Natur dienen. So hatte ich oft Gelegenheit, Herrn Reh herauszufordern. Ohne Erfolg.
Ich probierte es auch bei unserem alten Doktor Erdemann, der meine vielen Anginen und Masern samt Rückfall kuriert hatte. Mitten auf der Straße bedachte ich den Doktor mit dem neuen Gruß. Da hielt er mich an, schaute mir in den Hals, behauptete, meine Mandeln seien entzündet und schrieb mir auf der Stelle ein langes Rezept aus. Durch einen Anruf bei Ede erreichte er, dass ich alle sieben Medizinen, die er aufgeschrieben hatte, auch schlucken musste. Eine schmeckte bitterer als die andere. In Zukunft ließ ich es Dr. Erdemann gegenüber bei »Guten Tag«.
Minnamartha interessierte sich seit den Ferien immer weniger für den Alltag. Sie lag auf der Chaiselongue unter den beiden Hirtinnen, verzehrte Konfekt und ignorierte die heraufdämmernde neue Zeit. Wenn Ede über die Nazis schimpfte oder den Mann rausschmiss, der für die NS-Volkswohlfahrt sammeln kam, sagte sie:
»Ede, verbrenn dir nicht die Finger!«
Dann sank sie wieder auf die Chaiselongue zurück, ein Berg von Mensch, der zu Migräne neigte, und blätterte eine neue Seite der Berliner Hausfrau auf. Manchmal kamen Nachbarinnen, mit denen sie über Verdauungsbeschwerden tratschte.
Sie war uns allen, wie Ede es ausdrückte, keine rechte Stütze mehr. Nicht ganz auf dem Posten sei sie wohl, sagte sie von sich selbst. Eine Bemerkung, durch die ich Minnamartha mit Stahlhelm und Gewehr vor meinem geistigen Auge sah, wie sie im Schilderhäuschen Posten schob; an gesunden Tagen. Großmutter setzte ihre Tees an, die sonst immer halfen, hier versagte die Heilkraft der Kräuteraufgüsse. Der Schaden lag tiefer. Auch Minnamartha war ihr neues Dasein als Hausbesitzerin ein wenig unheimlich. Obwohl sie ihren Kuchen jetzt wieder zu Hause aß.
Mathilde füllte neuerdings auch einen gehobenen Posten aus, beim BDM. Aus dem Maisdschungel Onkel Huberts war sie herausgetreten, hatte sich abgeschminkt und als braune Amazone in BDM-Kluft geworfen, die Brennschere war in die Kommodenschublade verdammt. Blonde Zöpfe umwehten nun Mathilde, wenn sie zum Birkenwäldchen radelte, bei uns vorbei, um Dienst zu machen.
Wie liebten wir die neue Mathilde! Othmar und ich standen oft an der Straße, wenn sie vorbeisauste, in die Kurbel trat, so wundersam lächelte unter dem Blondhaar.
»Ist sie nicht herrlich?«, fragte ich.
»Bongfortzionös«, bestätigte Othmar.
So vorwitzige Knaben erhörte Mathilde selbstverständlich nicht, ihr Streben galt Höherem, dem Dienst am Volke. Auch vom Zerstörermatrosen, dem Verlobten, war nicht mehr die Rede. Mathilde trug weiße Söckchen. Immer strahlend weiß. Wie sie das schaffte, war eines ihrer Geheimrezepte. Onkel Hubert, auf die neue Richtung Mathildes angesprochen, blieb stumm: So weit reichte sein Bierfahrerhorizont nicht, dass er sich das erklären konnte. Oben auf einem Regal lag in seiner Laube Mathildes Sonnenbrille. Unauffällig schauten Othmar und ich uns einmal um, ob sie auch ihren Minibüstenhalter irgendwo abgestreift hatte, aber den trug sie anscheinend weiter, auch unter der weißen BDM-Bluse. Nie mehr drang ich bis zu Mathildes Jungmädchengemach in der Zweizimmerwohnung über der Brauerei vor, aber ich hätte gewettet, dass dieses Gemach jetzt mit Führerbild und Ährenkranz geschmückt war. Vielleicht stand neben dem Bett noch ein Spinnrad.
Wir legten Mathilde unsere Herzen zu Füßen, Othmar und ich. Sie rief: »Na, Jungs?«
So zurückgestoßen, beschlossen Othmar und ich, auf seiner alten Remington-Schreibmaschine einen Roman zu verfassen. Einen Roman, das hatten wir uns vorgenommen, in dem wir alles sagen wollten. Frei von der Leber weg, hätte Minnamartha gesagt. Wir wollten hineindichten, was wir über die Liebe und die Frauen wussten und die Geheimnisse, die den Erwachsenen vertraut waren, die wir aber nur aus Büchern kannten.
Wir kauften ganz dickes Papier, denn wir wollten auch sehen, dass die Arbeit voranging. An der Remington stellten wir den größtmöglichen Zeilenabstand ein und begannen. »Wie wäre es«, schlug Othmar vor, »wenn wir unsere Geschichte im Malermilieu spielen ließen?«
Ich war dafür. Hatten wir doch gehört, dass Maler, im Umgang mit Modellen erfahren, freien Sinnes waren.
»Kennst du denn einen Maler?«, fragte ich Othmar.
»Nööh.«
»Ich auch nicht.«
Othmar hatte eine Idee: »Im Schrank habe ich mal ein Buch gefunden. Bei meinem Vater. Das hieß Mutzenbecherin oder so ähnlich. Eine sitzt im Keller auf einem Fass, und dann kommt der Bierfahrer und holt die Nille raus …«
Das fand ich wieder nicht gut. Ich stellte mir Onkel Hubert im Keller vor, mit einer, die auf einem Fass sitzt. Vielleicht einer wie Mathilde. In BDM-Uniform und mit blonden Zöpfen. Dass Mathilde Onkel Huberts Tochter war, ließ ich unberücksichtigt.
»Lieber doch einen Maler«, meinte ich. »Er kann in einem Atelier wohnen, fünfter Stock. Eine steile Treppe führt hinauf. Vor ihm geht sein Modell. Er hinterher, und wie er schaut, merkt er, dass sie kein Höschen anhat.«
»Mann, dufte.« Othmar spannte den ersten Bogen ein, und dann hackten wir abwechselnd mit zwei Fingern auf die Remington ein.
Auf den nächsten sieben Seiten schilderten wir im Detail, was auf der Treppe alles geschah. Wir brauchten eine Woche dazu und stritten uns oft.
»Die Treppe ist mit einem Läufer belegt«, schlug Othmar vor. »Kokos. Sie krallt sich fest. Mit den Händen. Und den Stöckelabsätzen.«
»Und die Handtasche?«
»Die stellt sie neben sich ab. Oder sie purzelt herunter, alles fällt raus, und sie muss die ganze Zeit daran denken, ob sie alles wiederfinden wird. Kleingeld. Den Lippenstift.«
»Und die Kanten? Von den Stufen?«
»Wenn ein Läufer drauf ist, tut es vielleicht nicht so weh.«
Das leuchtete ein. Wir tippten die Passage. Othmar war plötzlich dafür, dass es ein roter Samtläufer war. »Das schmeichelt mehr als Kokos«, meinte er. »Und stell’ dir vor, die weißen Schenkel auf dem Rot. Das ist doch etwas für einen Maler. Oder?«
Wir überlegten, ob sich, dort auf der Treppe, vielleicht nur des Malers Hand unter den Rock verirren sollte. Der Rest könnte dann im Atelier stattfinden. Oben. Aber schließlich schilderten wir den ganzen Vorfall im Treppenhaus, wie zuerst beabsichtigt. Das füllte Seiten. Seite eins bis sieben versteckten wir in Harms Schulatlas. Leichtfertig ließen wir die zu zwei Dritteln beschriebene Seite acht in der Maschine. Othmars Vater fand sie, las sie mit Interesse, und spürte auch den Anfang im Schulatlas auf. Er rief uns, las uns unser Werk von Anfang bis zum vorläufigen Ende vor (wir fanden es gar nicht mehr so gut), drehte die Blätter zu einer Rolle zusammen und verdrosch uns damit, bis das Papier in Fetzen war. Die Remington schloss er weg.
Von Mathilde schnippisch abgewiesen, die Trümmer unseres ersten literarischen Werkes zu Füßen, beschlossen wir, uns vom Erotischen ab- und harmloseren Kinderspielen zuzuwenden. Die Neigung wurde gefördert, weil des blondlockigen Othmars Onkel Didi eintraf. Onkel Didi war pensionierter Handelskapitän, trank gerne Kümmel und sang Lieder von Kap Horn. Er bezog, anscheinend gewillt, längere Zeit zu bleiben, ein Zimmer im Dachgeschoss bei Othmars Eltern. Den Raum garnierte er mit einem teilweise enthaarten Zebrafell und einem Elefantenfuß, der als Papierkorb diente. Rudimente eines Abenteurerlebens, das Onkel Didi einst an viele fremde Küsten geführt hatte. Die Wände seiner Stube unter dem Dach waren mit Postkarten beklebt. Auf diesen Postkarten waren nackte Mädchen abgebildet, alle zart und weiß wie Marzipan. Eine sprang, Hände aufgestützt, über eine große Kugel und zeigte dabei ihr Hinterteil. Sie gefiel uns am besten. Onkel Didi nannte sie »Rio Rita«, aber er wusste nicht mehr, wo er diese Kugelspringerin in natura kennengelernt hatte. »Vielleicht in Tampico«, murmelte er.
Onkel Didi besaß viele Tabakspfeifen, die er reihum rauchte, wo er ging und stand. Die Asche verstreute er überall, besonders gerne aber auf Blattpflanzen.
Kapitän Didi war ein Bonvivant. Zu Minnamartha sagte er: »Gnädige Frau haben einen ganz reizenden Umfang.« Meine Mutter wusste nicht, ob sie erfreut oder beleidigt sein sollte. Großmutter, nach ihrer Meinung zu Kapitän Didis zweifelhaftem Kompliment befragt, sagte: »Es soll heißen friss nich so viel.«
Ein so ausgebuffter Fachmann in Marinefragen wie Kapitän Didi, Experte auch für Künstlerpostkarten, Zebrafelle und Elefantenfüße, wirkte anregend. Wir nahmen Skagerak noch einmal durch, nun aus der Perspektive des Brückenoffiziers auf einem schweren Kreuzer (denn in dieser Eigenschaft hatte Onkel Didi die Seeschlacht erlebt), und fühlten uns sicher, wenn Onkel Didi fragte:
»Wie viel Seemeilen lief das Linienschiff ›Zähringen‹?«
»Achtzehn Knoten, aye, aye, Sir«, hatten wir dann zu antworten.
Wir kannten uns aus mit den englischen Dreadnoughts, wussten, dass die Neptune unter französischer Flagge lief und dass die Yorck ein deutscher Panzerkreuzer war, neuntausendfünfhundert Tonnen, Geschwindigkeit einundzwanzig Seemeilen.
Othmar gliederte seinem Landcorps von Lineolsoldaten jetzt eine Marineeinheit an. Er kaufte von seinem Taschengeld zwei Admirale mit Zweispitz und gold verschnörkelter Uniform, drei Kapitäne zur See, die leider auch beim Dienst in der Kaserne ihren gezogenen, fest angelöteten Säbel nie ablegten, und zwei Dutzend Marinesoldaten. Durch einen glücklichen Zufall konnte ich nachziehen: Pfützenmarschierer Gustavchen, nun größer geworden und mit Turnhose, schlich neuerdings durch die Siedlung, um Geschäfte zu tätigen. Er besorgte mir billig einen gebrauchten Kapitän und acht Matrosen.
Othmar war wieder der Stärkere, und dazu war Kapitän Didi noch sein Onkel! Unter Absingen von Kapitän Didis Waterkantsongs paradierten unsere blauen Jungs auf dem Zebrafell. Der Elefantenfuß war das Marineehrenmal Laboe.
»Aloha he«, sang Kapitän Didi. »Jungs, ich denke schon die ganze Zeit nach. Hier fehlt was.«
»Was denn, Onkel Didi?«
»Schiffe.«
Wir waren beeindruckt. Da hatten wir all die Sailors und Teerjacken und Admirale, aber keine Schiffe.
»Mein Segelboot aus Ahlbeck«, fiel mir ein.
Onkel Didi winkte geringschätzig ab. »Panzerschiffe.«
»Woher sollen wir die kriegen?«
»Baut sie euch selbst.« Er krümelte Pfeifenasche über unsere Köpfe.
Wir konstruierten eine Plättbrettflottille. Ede erinnerte sich an Monitore, die er während des ersten Weltkrieges in den Donaustaaten gesehen hatte, flachgehende Flussoder Küstenmotorschiffe, sehr schnell, mit starker Bewaffnung. Zwar keine Schlachtschiffe, nicht einmal Kreuzer, wie sie Harry Busebergs Vater gefahren hatte, aber für unsere paar Teerjacken war es vielleicht richtig. Kapitän Didi schließlich plädierte für Hilfskreuzer, zu Kriegsschiffen umgebaute Handelsdampfer, aber das war uns auch zu hoch.
Wir bauten Monitore, indem wir von Bretterabfällen, die auf unserem Dachboden lagen, halbmeterlange Enden absägten, diese zuspitzten und mit Leisten eine Reling darumzimmerten. Die Aufbauten klebten wir aus Pappe.
Othmar hatte zwei Schiffe, selbstverständlich, ich nur eins. Onkel Didi blies Angriffssignale auf dem Kamm. Die Flotten liefen zur Seeschlacht auf Kapitän Didis Zebrateppich aus. Stolz wehten am Heck die Reichskriegsflaggen, selbst gemalt, auf Othmars Schiffen die deutsche, ich war der böse Engländer. Aus den Schornsteinen der angreifenden Schiffe quoll schwerer Watterauch, und schon flogen die ersten Geschosse, Mauersteine von Othmars Anker-Steinbaukasten.
»Halt«, kommandierte Onkel Didi. »Hier fehlt was.«
Othmar deutete, von Didi unbemerkt, leicht an seine lockenumwallte Stirn, um anzudeuten: »Jetzt hat er ’ne Meise.«
Laut sagte Othmar: »Was fehlt denn noch? Schiffe haben wir doch jetzt.«
Mit düsterer Miene sog Onkel Didi an seiner Pfeife. Dann sagte er:
»Wasser.«
Wir waren sprachlos. Wasser!
Während Onkel Didi im Kabinett seiner Postkartenschönheiten zurückblieb, transportierten wir die Monitore zu einem Teich gleich hinter dem Feld, in der Nähe des Zimmereiplatzes. Ein schwieriges Unternehmen, weil es unter den Augen der Laubenkinder durchgeführt werden musste. So rasten wir gebückt am Bahndamm entlang, wo uns der Lehrter D-Zug mit einem glühenden Aschenregen überschüttete. Aber wir kamen heil am Teich an und wasserten die Monitore.
»Mönsch, die haben ja Schlagseite«, stellte Othmar fest. In der Tat machten wir die Erfahrung, dass Bretter nicht immer waagerecht auf dem Wasser schwimmen, jedenfalls dann nicht, wenn sie mit allerlei Aufbauten versehen sind. Unsere blauen Jungs zogen Wasser, die Lineolmasse begann schnell von den Sockeln her aufzuweichen. Abwenden konnten wir ihr Schicksal nicht mehr, denn die Schiffe trieben schon weit draußen auf dem Teich. Wir sammelten Steine. Othmar bombardierte mein Schiff, ich seine zwei. Durch Schnellfeuer erhöhte ich die Trefferzahl. Es gab Verluste, als einige Mariner über Bord gingen. Andere fielen um und quollen ziemlich auf, weil an Deck Wasser stand.
Versenkt wurde diesmal kein Schiff. Ich knobelte mit Othmar, wer in den See waten sollte, um die Schiffe wieder an Land zu holen. Ich gewann. Aber Othmar zierte sich, und so zog ich mich aus und barg die Boote. Entengrützebedeckt stieg ich ans Gestade.
»Danke«, sagte Othmar.
Ede ließ mich die Seeschlacht schildern. »Macht das Spaß?«, fragte er.
»Oh ja.«
Die Folge war, dass Ede mir ein elegantes Mahagonispielboot mit Batterieantrieb schenkte. Damit war ich Othmars Flotte weit überlegen. Das nächste Mal machten wir einen noch größeren Umweg zum Teich, hinter dem Bahndamm entlang, weil wir verhüten wollten, dass mein Mahagoniboot etwa in Siegfrieds Hände fiele.
Wir setzten unsere Einheiten aus. Bald hatten wir eine Menge Publikum. Die Eigenbaumonitore dümpelten in Teichmitte, das Motorboot surrte davon und zeichnete Heckwasser. An Bord machten mein Kapitän mit dem Säbel und zwei Matrosen Dienst. »Steuerbord – mehr Steuerbord«, rief ich. »Erstes Torpedorohr – fertig!« – Die Zuschauer blickten ernst. Ich legte die rechte Hand an einen nicht vorhandenen Mützenschirm und kommandierte: »Erstes Rohr – los!«
Genau so führte sich Othmar zehn Meter weiter auf. Seine Monitore waren gefechtsklar. »Alle Mann auf Station«, schrie er. Und dann: »Salve, Feuer!«
Wir feuerten gleichzeitig. Ich warf eine Steinsalve in Richtung von Othmars Monitore. Othmar hatte einen halben Mauerstein erwischt. Wasserfontänen schlugen über den Schiffen zusammen, einen Augenblick war nichts zu sehen, auch das Motorboot nicht. Dann tauchten die Monitore wieder auf, sie dümpelten auf der schweren Dünung des Teiches. Nur das Motorboot blieb verschwunden. Innig sagte Othmar:
»Volltreffer, Herr Kaleun!«
Das Publikum bestätigte, wild durcheinanderredend, die Meldung. Der Mauerstein hatte das Motorboot voll getroffen. Und versenkt. Mit Mann und Maus und Pertrix-Batterie.
Das Publikum nahm Anteil. Einer hatte Othmar beim Ohr, und Othmar musste unter dem Arm des Mannes durchtauchen, um zu entkommen. »Lassen ’se doch den Jungen«, rief eine Frau mit Markttasche. Ein alter Herr murmelte ehrfürchtig: »Wie vor Tsingtau!«
Dann verliefen sich die Leute. Diesmal tauchte Othmar in die Entengrütze, um die schwer havarierten Monitore zu bergen. Es lohnte kaum mehr.
Vom Motorboot keine Spur.
Auch Onkel Didi zeigte Ehrfurcht, als wir ihm den Ausgang der Seeschlacht berichteten. Er half uns, einen Fahnenmast am Elefantenfuß zu befestigen. In Laboe gingen die Flaggen auf Halbmast. Ein Admiral und vier Seesoldaten (aus beiden Flotten zusammengerechnet) hatten das Massaker vom Dorfteich überlebt.
Ede fragte ein paar Tage später, wo denn das Boot sei. Ich sagte: »Ooch, bei Othmar.« Schließlich erfuhr Ede alles. Er schnallte seinen Leibriemen ab und zwang mich in eine Rolle, die für einen Oberbefehlshaber von Seestreitkräften höchst unwürdig ist.
Im Jahr darauf war Kapitän Didi aus unserem Leben verschwunden. Elefantenfuß und Zebrafell hatte er eingepackt und war abgedampft zu neuen Ufern, zu anderen Verwandten oder wieder nach Tampico, – wir wussten es nicht. Zurück blieben nur Rio Rita und die anderen Tänzerinnen auf den Postkarten an den Wänden seiner Dachstube. Sie hatten sich nicht mehr entfernen lassen. »So was Scheußliches«, zürnte Othmars Mutter. »Jetzt muss ich neu tapezieren lassen.«
Kurz vor Ostern verteilte der Lehrer in der Volksschule die letzten Fleißbildchen an uns. Aus einem SA-Kalender. Ich wollte sie einrahmen und verstand nicht, dass Ede was dagegen hatte. Dann verließen wir die Volksschule. Verließen endgültig auch die Laubenkinder, die immer noch ihre Bleyleanzüge trugen und Glatze mit Vorgarten geschnitten bekamen, zum alten Preis von vierzig Pfennigen. Sie blieben zurück, und wir gingen in die neue Schule, wo wieder einmal, wie unsere Eltern mahnten und versicherten, der Ernst des Lebens begann.
Würdig erwartete uns die neue Anstalt. Othmars Locken waren frisch geschnitten, er trug Knickerbocker. Neben ihm saß ich in der neu lackierten Bank und lauschte dem deutschen Diktat: »Der sterbende Löwe«. Ein Lehrer mit leichtem Sprachfehler gab es. Ich verwechselte ein paarmal m’s und n’s. Doch erschien unsere Intelligenz jenen, die darüber zu befinden hatten, ausreichend. Wieder standen wir, am Beginn des neuen Schuljahres, auf einem kiesbestreuten Schulhof. Die Kastanien an der Mauer hatten schon Knospen. Auf den hellroten Backsteingebäuden lag die Sonne. »Bismarckschule – stillgestanden!« Der Direktor schritt die Reihe der neuen Schüler ab und musterte uns mit klarem Kaiser-Wilhelm-Blick. Dann durften wir Deutschland über alles singen und die Fahne hoch, mit heimlich abgestütztem Arm.
Eines Tages kam ein Parteigoldfasan aus unserer Siedlung zu Ede, einer, der bisher von unserer Existenz wenig Kenntnis zu nehmen geruht hatte.
»Ich gratuliere Ihnen, Heil Hitler!«, sagte er.
»Wozu?«, fragte Ede.
»Ihr Sohn darf jetzt ins Jungvolk. Trotz der Schwierigkeiten, die es damals mit seiner arischen Abstammung gab.«
Ede blieb ganz ruhig. »Und?«, sagte er, »was geht Sie das an?«
»Wir haben alle dafür gestimmt, dass Ihr Karl in das Jungvolk kommt«, sagte der Goldfasan.
»Vielen Dank!« Ede drehte sich um und ließ den braunen Würdenträger auf dem Hof stehen.
»Wer war denn das?«, fragte Minnamartha.
»Ein Hosenscheißer. Karl muss Pimpf werden.«
»Dann müssen wir eine Uniform kaufen.«
»Es ist zum Kotzen«, sagte Ede. Minnamartha meinte wieder einmal: »Ede, verbrenn dir nicht die Finger.« Ede zog seine lederne Geldkatze heraus und zählte ein paar Scheine auf den Tisch. »Das muss reichen«, meinte er.
Ich bekam eine schwarze kurze Ribbelsamthose, Koppel, Schulterriemen, Braunhemd und Schlips. Der Schulterriemen war mit Ehre verbunden, den durften wir zuerst noch nicht tragen. Aber mein Auge glänzte. Braun war ich von klein auf gewöhnt. Durch Herrn Gallert. Und auch Othmar und meine anderen neuen Freunde und Schulkameraden trugen ja die Uniform.
Ich war ein kleiner Marschierer. Die Beine immer noch dünn und etwas krumm, rutschende Kniestrümpfe. Die Knie zerschunden. Die schwarze Hose war ein bisschen zu lang. Ziemlich viel Dreck saß unter den Fingernägeln. Die Goldfasane strahlten trotzdem. Wir schmissen den rechten Arm hoch, die Knotenschlipse flatterten, wir brüllten den neuen deutschen Gruß. Ede hielt sich die Ohren zu.
Bald wussten wir, wie wichtig es war, sich an die richtigen Traditionen zu halten. Joachim Hans von Ziethen, Reitergeneral, und der Alte Fritz mit Dreispitz und Windhunden genügten da nicht mehr. Auf andere Werte griffen unsere Führer zurück. Wir wurden Wikinger.
Großmutter schüttelte den Kopf. In Posen, Westpreußen, hatte sie von Wikingern nie etwas gehört. Wir Pimpfe aber stickten die Namen großer Wikingerhelden auf unsere schwarzen Wimpel. Ede sagte, mit dem Kopf schwebten wir in Walhalla und mit dem Arsch führen wir dritter Klasse. Das wollten wir nicht einsehen. Aki, der listige Jomswikinger, stach Odysseus, mit dem wir in der Schule oberflächlich in Berührung kamen, bei Weitem aus. Und die Schule schien wohl auch auf Odysseus und seine Genossen nicht so viel Wert zu legen. Denn in Erdkunde mussten wir nun manches über Raum im deutschen Osten lernen, und in Biologie die Mendel’schen Gesetze.
Jetzt ließen wir die Fahnen weit wehen und die morschen Knochen zittern, wir erkletterten die Mauern und zerschmetterten die Türme.
Der Ziegenmilchhandel mit Herrn Reh schlief ein. Er vermied es, uns zu treffen. Sahen wir ihn doch einmal mit seiner zahmen Dohle auf der Schulter, so radelten wir hochmütig an ihm vorbei, in rasendem Tempo, denn drei Uhr Birkenwäldchen war die Parole. Dort wartete schon Kulle Rosenbusch auf uns, der Jungenzugführer. Er holte die Klampfe aus dem Futteral. »Uns geht die Sonne nicht unter«, tönte es aus dem Gebüsch. Zweistimmig.
Zu Hause lasen wir zwar Karl May und Tom-Shark-Hefte. Doch im Birkenwäldchen wurden wir zu strammen Hoffnungen der Bewegung, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder. Zwischendurch wichsten wir unsere Koppel und putzten an den Schuhen sogar die Stege.
Ede polierte weiter seine Taxen, es wurden immer weniger, weil man seine Konzessionen an alte Nazis übertrug. Ede fuhr nun wieder eine Schicht selbst, jeden zweiten Tag. »Verbrenn’ dir nicht die Finger, Ede«, sagte die Mutter jetzt immer öfter. Sie schlug Ede allen Ernstes vor, er solle sich auch so einen Bonbon anstecken, damit er die übrigen Taxen behalten dürfe. Aber Ede, mein Vater, wollte nicht.