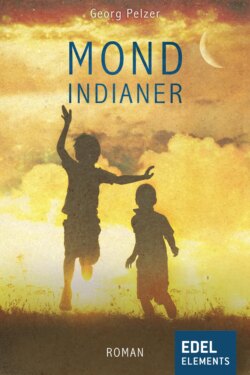Читать книгу Mondindianer - Georg Pelzer - Страница 7
Neun
ОглавлениеAufziehende Wolkenrippchen haben sich mit dem Mondlicht zu einem milchfarbenen Phantasiegebilde verschmolzen, aufgespießt vom Kirchturm, dessen Höhe wieder einmal unterschätzt worden ist. Das Ortsschild am Bahnsteig ist kaum zu entziffern zwischen Schlieren aus schwarzer Sprühfarbe, jetzt noch weniger als am Tag. Besonders schlecht aber unter diesem nur spärlich leuchtenden Waschbretthimmel.
Nieder-Enden ist kein Dorf, das einen Besuch lohnt, hervorzuheben ist höchstens die Qualität der Luft. Und seit meine Großmutter keine Wäsche mehr kocht, trifft dies auch auf die Montage zu. Man sagt, nirgends sei die Luft besser als hier. Es weht ein frischer strammer Westwind, angereichert mit einer Prise Meersalz. Alles Gute kommt von Westen, glauben die Leute hier zu wissen, und alles Schlechte immer aus der Fremde, aus dem fernen und dem nahen Osten, aus allen Gebieten, die jenseits des Rheins liegen.
Von hier aus fahren die Züge niemals weiter, höchstens zurück, und wenn man Pech hat, erst am nächsten Tag. Fahrkarten gibt es nur noch am Automaten, und wer das Geld nicht in passender Münze hat, muss sich etwas einfallen lassen.
Es hat sich anscheinend etwas verändert, in diesem Dorf, in dem man jedwede Veränderung immer mit großer Selbstverständlichkeit zu verhindern gewusst hat. Aber ich vermag nicht zu sagen, worin die Veränderung besteht. Vielleicht hängt das Gefühl auch mit der langen Zeit zusammen, die seit meinem letzten Besuch vergangen ist.
Das alte Schulhaus, in dem wir wohnten, ist keine zweihundert Meter von der Bahnstation entfernt. Gleich neben dem Zugang zum Schulhof befindet sich ein kleiner Schuppen, der früher als Waschküche diente. Hier unternahm meine Großmutter Montag für Montag größte Anstrengungen, die Welt von ihren Sünden und unsere Wäsche von jeglichen Schmutzresten zu befreien. Unsere Wäsche und die des Pastors.
Zerbröselter Mörtel rieselt mittlerweile zwischen den Backsteinen hervor, die Tür ist aus den Angeln gehoben und liegt halb verfault im Gras. Halb verfault und immer noch benommen wohl von jener Teufelslauge, die hier Woche für Woche gekocht wurde, aus der ätzende Dämpfe emporstiegen, vom Westwind weit über den Rhein hinweg in die Stahl produzierenden Regionen getragen, wo sie mit Sicherheit den unter Staublungen leidenden Menschen noch zusätzliche Bronchialleiden verschafften.
Dieser Geruch setzte sich in meiner Nase fest, reizte allwöchentlich meine Atemwege, und selbst Einstein hatte mir nicht erklären können, warum es so gottserbärmlich stank.
Muss eine Mischung aus Peroxyd und Rohrreiniger sein, vielleicht ist noch ein bisschen Schmierseife dabei, mutmaßte er, und mein Vater hatte scherzhaft behauptet, dass uns diese Dämpfe eines Tages noch alle umbrächten. Als er dann später tatsächlich krank wurde, war ich überzeugt, dass es alles andere als ein Scherz gewesen war.
Jeden Montagmorgen machten sich die Schwaden auf den Weg. Sie waberten von der Waschküche aus über den Pausenhof und ins Haus hinein, am Schulzimmer vorbei und die Treppe hinauf. Es gab für mich kein Entkommen, die Dämpfe schlichen unaufhaltsam in meine Nase, sie erwischten mich in meinem Zimmer, im Bad oder am Frühstückstisch. Sobald sie den brodelnden Zuber verließen, war ich chancenlos, dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Härchen in meiner Nase sträubten und ich minutenlang niesen musste. Bis meine Augen tränten, sich röteten und die Lider nach einer Weile anschwollen.
Manchmal machten die Dämpfe sich auch noch über meine Zunge her, der Geruch verwandelte sich in einen Geschmack und verdarb mir das Frühstück. Marmeladenbrot mit einem deutlichen Hauch von Seife. Und mit einem Schluck Caro-Kaffee hätte ich Blubberblasen machen können, wenn ich es darauf angelegt hätte. Und erst wenn die blütenweißen Laken auf der Leine hingen und die Sicht auf den Kirchplatz versperrten, ließen meine Beschwerden langsam wieder nach.
Es hatte von einem Tag auf den anderen angefangen, wie aus dem Nichts. Leider waren die Chancen, dass es ebenso schnell wieder verschwand, nicht sehr groß.
Ist wahrscheinlich eine Allergie, meinte der Doktor, nachdem er mich gründlich untersucht hatte. Alle Welt habe Allergien, das sei nicht so schlimm, ein ganz normaler Heuschnupfen halt.
Nur, dass mein Heuschnupfen nach meiner Auffassung ein Waschlaugenschnupfen war – eine Allergie gegen bestimmte Gerüche.
Und ich war weiß Gott nicht der Einzige, der diesen Gestank nicht ertrug. Außer Nieder-Enden gab es mit Sicherheit kein weiteres Dorf auf der Welt, in dem am Montag alle Fenster geschlossen blieben, sommers wie winters. Selbst bei Sonnenschein und Hitze. Was aber nur aufschiebende Wirkung hatte. Die unseligen Dämpfe kamen überallhin, selbst in die Kirche trauten sie sich hinein. Vertrieben die letzten Reste vom Sonntagsweihrauch, von dem ich ebenfalls niesen musste. Krochen draußen Ziegelstein für Ziegelstein am Turm empor bis zum Wetterhahn, den sie immer wieder zur Raserei brachten. Er drehte sich wie verrückt, ganz gleich, ob der Wind blies oder nicht, und manchmal glichen die Ausdünstungen feuchten Heiligenscheinen, wenn sie dort oben um die Spitze des Kirchturms kreisten. Kein Montag, an dem nicht irgendwo wütendes Geschimpfe zu hören war, bevor ein versehentlich offen gelassenes Fenster krachend zugeschlagen wurde.
All das ließ meine Großmutter vollkommen unbeeindruckt. Sie interessierte sich nicht für die Meinungen anderer Leute, nur Gottes Wille war für sie maßgeblich. Wenn sie andere Meinungen akzeptierte, dann nur die eines Gottesvertreters auf Erden. Mithin die unseres Pastors, der zu meinem Leidwesen nicht nur Gott, sondern während bestimmter Mahlzeiten auch noch meinen Vater vertrat, und das musste meiner Ansicht nach nun wirklich nicht sein. Aber wenn es irgendeine Meinung gab, die meine Großmutter am allerwenigsten interessierte, dann war es meine. Weswegen mir meine Meinung nicht viel nützte.
Mir blieb in vielen Fällen nur das Beten, und da ich nicht an Gebete glaubte, letztendlich nur die Hoffnung. Und die schiere Hoffnung auf Besserung war, so stellte ich mit der Zeit fest, kein guter Mitstreiter im Kampf gegen die Widrigkeiten des Lebens. Schon gar nicht im Kampf gegen eine Allergie. Kein Wunder, dass ich alle meine Hoffnungen auf das bevorstehende Jahrtausendereignis setzte, das meine Phantasie beflügelte, abenteuerliche Utopien nährte und einen Wendepunkt hin zu einer anderen, besseren Welt darstellen sollte. Und wie konnte es in einer anderen, besseren Welt noch Allergien geben?
Der Sommer 1969 hatte zwei dominante Gerüche. Zum einen den allwöchentlichen Laugengestank und zum anderen den Körpergeruch meiner Tante. Der Gestank war nicht zu verhindern, den Geruch suchte ich, sooft sich Gelegenheit dazu bot. Er war der Grund, warum ich mich am Sonntagmorgen, wenn meine Tante nicht auswärts geschlafen hatte, gerne in ihr Bett schlich.
Es handelte sich wohl um eine Mischung aus Vanille und Veilchen mit einem Hauch von Rosenöl, ohne dass sich eine der beteiligten Komponenten in den Vordergrund schob. Eine ausgewogene Geruchsmischung, der ich beruhigende Wirkung auf meine Schleimhäute zuschrieb. Ein Körperduft, der durch das aufziehende Licht, die zunehmende Wärme vielleicht noch verstärkt wurde. Ich wartete auf das morgendliche Sommerfarbenspiel im Gesicht meiner schlafenden Tante, wartete darauf, dass aus Grau Orange wurde, aus Orange Gelb und aus Gelb Gold.
Schlafend gefiel mir meine Tante am besten, schlafend, gold-gelb, gut riechend. Und still. Im Wachzustand gefiel mir ihre Lebhaftigkeit, ihr Lachen, aber nicht ihre Lautstärke. Egal, was sie gerade unternahm, sie tat es laut, viel lauter als nötig. Sie gehörte zu den Menschen, die es schafften, sogar beim Lesen Lärm zu machen. Das Umschlagen einer Buchseite klang wie das Zerreißen von Papier, und wenn sie Musik hörte, vibrierten die Holzdielen. Vielleicht hätte mir sogar ihre Musik gefallen, wenn sie nur halb so laut aus ihrem Plattenspieler gedröhnt wäre.
Oft schnupperte ich heimlich an ihren Schallplatten, glaubte, feine Geruchsunterschiede festzustellen, manchmal war es ein an Kerzen erinnernder Duft, ein anderes Mal glaubte ich, einen Hauch von Bohnerwachs wahrgenommen zu haben. Im Gegensatz zu diesen subtilen Gerüchen die vollen, satten Farben der Vinylplatten. Außer dem gewohnten Schwarz hin und wieder ein giftiges Grün, das ich draußen in der Natur noch nirgendwo gesehen hatte, ein tiefes Blau, das der Nieder-Endener Himmel selbst im Hochsommer so nicht hinbekam, ein fruchtiges Orange, das Appetit machte, herzhaft hineinzubeißen. Farben, die mir in dieser Intensität später kaum noch einmal begegnet sind, auf fünfundvierzig Umdrehungen pro Minute ausgerichtete Accessoires eines sich dem Ende zuneigenden bunten Jahrzehnts.
Ich erinnere mich weder an die Farbe noch an den Geruch von Wencke Myhres Schlager Er steht im Tor. Gut möglich, dass die Platte gar keinen Geruch mehr hatte, weil sie ununterbrochen auf dem Teller des Abspielgeräts lag. Und während die Musik lief, hätte man meinen können, man befände sich mitten in einem Fußballstadion. Das übertrieben laute Gelächter meiner Tante und das Geschrei Wencke Myhres ließen mich bisweilen befürchten, mir zu meiner Geruchsallergie auch noch eine Geräuschallergie einzuhandeln.
An jenem Morgen im Juli 1969, als ich darauf hoffte, dass die Astronauten es bis zum Mond schafften und dort nicht von Mondindianern erledigt wurden, betrachtete ich das noch blassgelbe Gesicht meiner Tante, das unfreiwillig verziert war von einer roten Spur verschmierten Lippenstifts, und ich fand, dass sie besonders gut roch. Ich wertete es als gutes Zeichen für den weiteren Verlauf des Tages. Ich hatte mir vorgenommen, mir alles, was an diesem Tag passierte, ganz genau einzuprägen. Schließlich wurde er im Fernsehen seit Wochen immer wieder als einer der wichtigsten Tage in der Geschichte der Menschheit angekündigt. An dem sich Möglichkeiten eröffnen würden, von denen die Menschen bisher nicht zu träumen gewagt hätten.
Um welche Möglichkeiten es sich hierbei handelte, wurde leider nicht konkret beschrieben, oder vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt, an dem ich längst zu Bett geschickt worden war. Wie immer, wenn es im Fernsehen spannend zu werden versprach. Kriminalfilme hatte ich bislang nur heimlich ansehen können und traumhafte Möglichkeiten wurden offenbar erst im Spätprogramm besprochen. Aber ich hatte ja Einstein, meinen Privat-Gelehrten, der über solcherlei Möglichkeiten bestens informiert war.
Eines Tages kann vielleicht jeder, der will, zum Mond fliegen, meinte er. In sechs bis sieben Jahren wird man aller Voraussicht nach schon die ersten Raumstationen und Mondbasen errichten. Dann kann man, wenn man eine Astronautenausbildung absolviert hat, vielleicht schon hinfliegen.
Wir nahmen uns fest vor, nach sechs, spätestens sieben Jahren zum Mond zu fliegen. Während der Sommerferien würden wir genug Zeit für eine Mondreise haben, vorausschauend dachten wir darüber nach, welche weitere Person unsere Besatzung komplettieren könnte. Da es in der Schule niemanden gab, der uns geeignet schien, schlug ich schließlich meine Tante vor. Einstein hatte erhebliche Bedenken.
Frauen hätten auf einem Raumschiff nichts verloren, würden nur für Komplikationen sorgen, schließlich handele es sich nicht um eine Kreuzfahrt oder einen Wochenendausflug.
Mag sein, entgegnete ich. Aber dafür ist sie schön und sie riecht gut.
Klar ist sie schön und sie riecht auch gut, aber meinst du, das reicht, um Astronaut zu werden?
Ich wusste nicht, wie man Astronaut wurde, mit dieser Frage hatte ich mich noch nicht beschäftigt.
Außerdem ist sie an Bord des Raumschiffs bestimmt genauso laut wie hier unten auf der Erde, vermutete Einstein. Stell dir vor, es gibt einen Streit. Da gerät dann leicht die ganze Technik durcheinander, und das kann unter Umständen verdammt unangenehm werden.
Die Technik auf einem Raumschiff schien sehr empfindlich zu sein, noch empfindlicher wohl als meine Nase, und ich nahm mir vor, erst einmal herauszufinden, ob meine Tante überhaupt an einem Mondflug interessiert war. Die Strapazen einer Astronautenausbildung würde sie wahrscheinlich erst gar nicht auf sich nehmen wollen, da konnte ich Einstein nicht ohne weiteres widersprechen. Und dass sie nicht besonders zuverlässig war, hatte ich ihm noch gar nicht erzählt. Sie sagte grundsätzlich immer erst einmal alles zu, und wenn es ernst wurde, kam ihr meistens kurzfristig etwas dazwischen. Zum Beispiel ein Krösken.
Wahrscheinlich hat sie wieder ein Krösken, ärgerte sich meine Großmutter jedes Mal, wenn meine Tante nicht zum Abendbrot erschien. Was es mit diesen Krösken auf sich hatte, wusste ich nicht. Vermutlich handelte es sich um etwas Verbotenes. Etwas Verbotenes oder eine Krankheit. Ich brachte dieses merkwürdige Wort mit einem langwierigen Leiden meiner Großmutter in Zusammenhang, das sie vor einiger Zeit gleichfalls bisweilen vom Abendbrot fern gehalten hatte.
Na, was macht das Gürtelrösken?, hatte sich mein Vater immer wieder mit aufheiternder Stimme erkundigt. Aber nichts war schwerer, als meine Großmutter aufzuheitern, wenn es ihr nicht gut ging. Sie war im Unterschied zu meinem Vater nicht in der Lage, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Er würde ihre Krankheit nicht ernst nehmen, schimpfte sie, und dass sie doch mal sehen wolle, wie es ihm erginge mit so einem Leiden.
Dieser Wunsch wurde ihr bald erfüllt, es dauerte nicht mehr sehr lange, bis mein Vater sich einen schlimmen Husten einhandelte, den ich damals auf die ätzenden Laugendämpfe zurückführte. Ich begriff seine Krankheit als Rache meiner Großmutter, als unerbittliche Antwort auf seine Aufheiterungsversuche, mit denen sie nichts anzufangen wusste.
Gürtelrösken, Krösken. Offensichtlich beides geheimnisvolle Erkrankungen, auf die man meiner Meinung nach gut verzichten konnte.
Ich betrachtete meine schlafende Tante hinsichtlich erster Anzeichen irgendwelcher Krankheiten. Lauerte Krösken-Symptomen auf. Aber da war nichts, sie schien mir kerngesund zu sein, und ich atmete möglichst flach und geräuschlos, um sie ja nicht zu wecken. Sah sie einfach nur an und sog ihren Duft ein. Ganz allmählich wurde sie etwas unruhig, die Atmung wurde unregelmäßig, sie drehte sich von einer Seite auf die andere, öffnete ein paarmal kurz die Augen. Lächelte ein bisschen. Auch das schien mir ein gutes Zeichen zu sein. Ich wartete noch ab, bis sie halbwegs ansprechbar war, und stellte eine Frage, die mir inzwischen schon eine ganze Weile unter den Nägeln brannte.
Hast du Lust, mit mir und Einstein zum Mond zu fliegen?
Sie öffnete endgültig die Augen, gähnte verschlafen und nickte. Die erste Hürde schien genommen.
Wann ist es denn so weit?, erkundigte sie sich.
In sechs oder sieben Jahren.
Ach so, sagte sie, ich dachte schon, heute noch. Und was wollen wir drei Hübschen dann so machen, da oben auf dem Mond, in sechs oder sieben Jahren?
Einfach nur hinfliegen und wieder zurück.
Oh, das ist keine schlechte Idee. Das ist sogar eine prima Idee, mit dir und Einstein zum Mond zu fliegen, sagte sie mit liebevollem Spott. Und was nehmen wir dann so alles mit auf den Mond?
Keine einfache Frage, schließlich wusste ich nicht, ob auf dem Mond gerade Sommer war, und ob man dort oben beispielsweise Sonnenbrillen benötigte. Mir wurde klar, wie viel Verantwortung Einstein schon vor Beginn unserer Mondreise würde übernehmen müssen. Schon solch banale Dinge wie Kofferpacken schienen ohne ihn nicht denkbar. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was man auf dem Mond brauchte, das Einzige, was ich mit Sicherheit nicht brauchen und mitnehmen würde, wäre mein Kommunionsanzug. Das, immerhin, stand vollkommen außer Frage.
Ich wechselte das Thema, wollte noch in Erfahrung bringen, warum meine Tante am Vortag wieder einmal nicht zum Abendbrot erschienen war, was meiner Großmutter denkbar schlechte Laune und mir das vorzeitige Ende des Fernsehabends beschert hatte.
Hast du gestern Abend wieder ein Krösken gehabt?
Meine Tante starrte mich entsetzt an.
Wie bitte?
Ob du ein Krösken gehabt hast! Tun sie sehr weh, diese Krösken?
Ich verstand nicht, warum meine Tante nun wieder einen dieser unerträglichen Lachanfälle bekam, die mir entschieden zu laut waren. Ich wusste weder, was man für eine Mondreise in den Koffer packen musste, noch wusste ich, was die Ursache für ihr Gelächter war. Meine weitere Frage, ob Krösken ansteckend seien, verkniff ich mir und machte, dass ich ins Bad kam. War sowieso besser, vor meiner Tante im Bad zu sein, da sie es gerne stundenlang besetzt hielt, da blieb dann kaum noch Gelegenheit zum Zähneputzen. Ausgerechnet an diesem Tag wollte ich keinen Verstoß gegen das zweite Großmuttergebot riskieren: Du sollst gekämmt und zähnegeputzt und sauber gekleidet in der Kirche erscheinen!
Und während ich mir einen feuchten Frotteelappen mit Kernseifenaroma durchs Gesicht rieb, legte ich insgeheim einen Termin für unsere Mondreise fest. 20. Juli 1975. Ich hoffte, dass meiner Tante an diesem Tag kein Krösken dazwischenkommen würde.