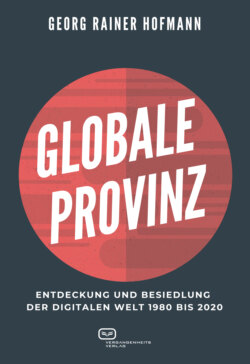Читать книгу GLOBALE PROVINZ - Georg Rainer Hofmann - Страница 9
Ein Computer in der Schule – am Gymnasium in Michelstadt (1980 – 1981)
ОглавлениеEs wird von der Akzeptanz und der Wertschätzung der ersten Computer im betrieblichen und schulischen Alltag berichtet und wie man damit begann, ein Fach »Programmieren« in der Schule anzubieten und zu lehren.
Zu Beginn der 1980er-Jahre wurde an einigen – allerdings noch sehr wenigen – Schulen ein neues, damals super-fortschrittliches Wahlfach angeboten. Man konnte als Schüler nun »das Programmieren« lernen. Am Gymnasium in Michelstadt im Odenwald, das ich damals besuchte, besaß man bereits einen Schulcomputer. Er war der zweite an einer Schule in Hessen überhaupt, nur ein Gymnasium in Darmstadt hatte bereits vor der Odenwälder Schule einen Computer beschafft. Dies ist ein erster der unglaublichen Zu- und Glücksfälle, von denen dieser Bericht mitunter handelt. Dieser Umstand rechtfertigt es, dass in diesem Bericht manchmal eine subjektive auf Erinnerungen basierende Perspektive »eingenommen werden muss«. Die damaligen Anfänge des Programmier-Unterrichts sind sehr schlecht bis gar nicht dokumentiert. »Das weiß niemand mehr«, war die Auskunft von befragten Fachkollegen der »Gesellschaft für Informatik e.V.« (GI). Im Regelfall war ein Schüler meines Alters in der Schule im Mathematik- und Physik-Unterricht noch mit Rechenstäben, auch »Rechenschieber« genannt, vertraut gemacht worden. Diese Geräte hatten ein Plastik-Etui, um ihre empfindliche Mechanik zu schonen.
Natürlich gab es Anfang der 1980er-Jahre in den größeren Unternehmen und Behörden schon eine Elektronische Datenverarbeitung (EDV) als eine eigene spezielle Abteilung. In diesen EDV-Abteilungen saßen die Jünger des Herman Hollerith und wandelten Handschriftliches in maschinenlesbare Lochkarten um. Sie ließen Programme auf riesigen und wahnsinnig teuren Rechnern laufen und produzierten damit Listen auf seitlich gelochtem grünlichem Endlos-Papier. Der Gebrauch von Computern war absolut nicht jedermanns Sache. In privaten Haushalten gab es einen – höchstens einen – Taschenrechner, aber darüber hinaus im Alltag praktisch überhaupt noch keine Computer. Sie waren noch eine echte »rocket science«. Nur Raumschiffe, wie die des Apollo-Programms, hatten seinerzeit einen Bordcomputer. An Bordcomputer in einem normalen PKW oder gar an Computer am Lenker eines Fahrrads – an so etwas dachte damals niemand. Solche Anwendungen waren noch Lichtjahre entfernt. Personen, wie Professor Thomas Wolf, waren aber schon zu Beginn der 1980er-Jahre echte »EDV-Profis«.
Professor Dr. Thomas Wolf, Berlin
Exkurs – Die IT-Abteilung und ihre Leitung im Wandel der Zeit. Der teure, aber kostenoptimierte Zentralrechner im Batch-Betrieb
Wenn man das liest, dann sollte der Bericht von Georg Rainer Hofmann durch einen Bericht vom Wandel der Funktion der Informationstechnik (IT) in den gewerblichen Betrieben ergänzt werden. In der entwickelten Informationsgesellschaft wird die betriebliche IT kaum noch bewusst wahrgenommen, obwohl sie von fast allen Berufstätigen intensiv genutzt wird. Aus meinen eigenen Erinnerungen kann ich diesen nicht unwichtigen Aspekt gerne erläutern.
Nach meiner Assistentenzeit an der Universität Freiburg begann ich im Jahr 1977 meine Berufslaufbahn in der Abteilung »Wissenschaftliche Datenverarbeitung« bei der Firma Merck KGaA in Darmstadt. Ich war als Biostatistiker ein Nutzer der IT und gleichzeitig ein Entwickler von Computerprogrammen für statistische Verfahren. Mein Mentor bei Merck war damals Prof. Dr. Wolffried Stucky, der spätere Gründer und langjährige Leiter des Instituts für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren (AiFB) an der Universität Karlsruhe. Im Jahr 2009 sollte ein »Karlsruhe Institut für Technologie« (KIT) als Fusion der Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe gegründet werden. Später war ich selbst lange Jahre am AiFB des KIT als Honorarprofessor tätig.
Die Gesamtheit der IT bestand damals bei Merck aus einem Zentralrechner für primär kommerzielle Anwendungen. Er war aber auch für wissenschaftliche Anwendungen, wie meine Statistik, der einzige verfügbare Rechner. Diese Art »Statistik« umfasste dabei sowohl die statistische Auswertung von Tierversuchen und klinischen Studien als auch frühe »Big Data« Anwendungen, wie Untersuchungen zur Effektivität des Einsatzes von Ärztebesuchen. Mit dem Rechner kommunizierte man mittels Lochkarten – als Eingabemedium – und grüngestreifter 132-stelliger Listen, gedruckt auf dem sogenannten »Schlafanzugpapier« als Ausgabemedium.
Mit dem Rechner gab es also keinen isochronen Dialogbetrieb in Echtzeit, das war damals noch nicht möglich. Der Rechner wurde im sogenannten »Batch« betrieben. Ein Batch ist auf Englisch ein »Stapel«. Und die Daten hatten ja in der Tat die Form von Lochkarten- oder Papier-Stapeln. Die Eingaben als Lochkartenstapel arbeitete der Rechner pro Auftrag vollständig und sequenziell ab. Der Begriff der »Stapelverarbeitung« wurde noch viele Jahre später generell für nicht-interaktive Systeme benutzt. Die Logistik für beide Batch-Medien, also der Weg von meinem Schreibtisch über das Werksgelände zum Rechenzentrum und zurück, wurde per PKW abgewickelt.
Dem eigentlichen Management der IT kam ich erst gegen Ende der 1970er-Jahre näher. Der Grund dafür war meine Unzufriedenheit mit der IT. Mit der Möglichkeit der dezentralen Eingabe von Lochkarten und dezentralem Ausdruck wurden mir als Nutzer die unsagbar langen Brutto-Rechenzeiten transparent. Es war ein ziemlicher »waste of time«, an meinem Schreibtisch auf die Antwort des Zentralrechners auf einen Rechenauftrag zu warten. Zugegebenermaßen stellten meine statistischen Verfahren eine gewisse Herausforderung für die damalige IT dar. Auf jeden Fall wollte ich als Anwender wissen, warum IT so arbeitet, wie sie arbeitet.
Ziemlich schnell lernte ich, dass der Fokus der verantwortlichen Leitung der IT – »narrow minded« – nur auf den Kosten des Großrechners lag. Mehr als ein Jahr lang wurde etwa diskutiert, ob man den Hauptspeicher des Zentralrechners von 800 KB auf 1,5 MB aufrüsten sollte. Die Wartezeiten der Nutzer spielten in diesen Überlegungen kaum eine Rolle, die Kosten von deren Leerlaufzeiten auch nicht. Man versuchte damals, um das Jahr 1980 herum, stattdessen durch ein eigenes quasi »Datenbanksystem« die Plattenumdrehungen und damit Zugriffszeiten auf den Speicher zu optimieren.
Sogenannte »Strategische Überlegungen« zur IT-Entwicklung fanden im Gespräch mit Vertretern des Hauptlieferanten »International Business Machines« (IBM) statt – die Frage, welche neue technische Rechnergeneration wann beschafft werden sollte. Ab dieser Zeit – und noch weitere Jahrzehnte lang – vertrat ich die Position: »Wenn man die IT-Kosten ohne Rücksicht auf den Nutzen der Anwender optimieren will, dann sollte man besser gleich die gesamte IT abschaffen.« Das wäre die konsequenteste und gleichzeitig sparsamste Lösung. Denn unabhängig von der zu erbringenden Leistung nur »sparen zu wollen«, das ist ein sehr triviales Ziel.¶
Das Paradigma »die Schüler müssen das Programmieren lernen« war einer der ersten Funken des Urknalls der Informationsgesellschaft. Denn damit begann die »Popularisierung der Informationstechnologie« außerhalb der gewerblichen Wirtschaft. Mein Gymnasium in Michelstadt hatte mithilfe von Spenden einen Computer des Fabrikats WANG beschaffen können. Freilich gab es im Lehrerkollegium Bedenken – die Ausbildung an einem solchen neumodischen, technischen Gerät hätte an einem ordentlichen Gymnasium einfach nichts verloren. Dieses ganze Computer-Zeug werde derzeit ja offenbar maßlos überbewertet und gefährde den Stellenwert der wahren, klassischen Bildung. Der Computer galt als das Zeichen einer schrecklichen, neuen Zeit. Die Computer-Befürworter unter den Lehrern argumentierten mit dem unglaublichen Nutzwert der Maschine. Sie könne sogar bei der Verwaltung der Schule helfen, so bei der leidigen und aufwändigen Aufstellung der Stunden- und Raumpläne. Der WANG-Computer galt als ein alleskönnendes »Elektronengehirn«, dessen Möglichkeiten damals aber völlig überschätzt worden sind.
Einer der befürwortenden Lehrer hatte sogar eine elektronische Quarz-Armbanduhr am Handgelenk. Diese Uhr hatte eine rot leuchtende, digitale Vier-Ziffern-LED-Anzeige, die aber nur per Druck auf einen seitlichen Knopf am Gehäuse sichtbar wurde. In der Auslage eines Uhrengeschäfts in Michelstadt stand eine Quarz-Armbanduhr, die hatte eine damals hochmoderne, »permanent sichtbare« LCD-Anzeige mit sechs Ziffern – Stunden, Minuten, Sekunden. Diese Quarzuhr war – für einen Schüler unerschwinglich – sehr teuer, sie kostete um die 650 D-Mark. Wir Schüler standen fasziniert und quasi »ewig« vor dem Schaufenster und beobachteten das Umschalten der Sekunden in diskreten Schritten auf dem kleinen Liquid Crystal Display – im Gegensatz zu den bekannten analogen Zeigerbewegungen der normalen mechanischen Uhren. Besonders interessant sah die Uhrzeitanzeige »11:11:11« aus – auf einem analogen Ziffernblatt ist diese Uhrzeit ja nichts Besonderes. Das war vor über 40 Jahren für uns so faszinierend, weil es im normalen Alltag einfach noch gar keine digitalen Displays gab. Auf den Bahnsteigen der größeren Bahnhöfe gab es – beispielsweise – analoge Anzeigen mit mechanischen Klappbuchstaben. Auf den kleineren Bahnhöfen wurden die Zugverbindungen per Lautsprecher »live« angesagt. Ein digitales Display als Bandenwerbung in einem Stadion war technisch noch völlig undenkbar.
Exkurs – Musik-Erleben in der Globalen Provinz zu Beginn der 1980er-Jahre
Wenn man das liest, dann können wir uns die Entwicklung der Informationsgesellschaft nicht zuletzt daran verdeutlichen, mit welchen Medien man »Große Welt-Musik« in der südhessischen Provinz etwa im Jahr 1980 konsumiert hat. In der Nacht vom 19. auf den 20. April 1980 trat in der Grugahalle in Essen im Rahmen einer »Rockpalast«-Veranstaltung des WDR die US-amerikanische Band »ZZ Top« auf. Die Band aus Texas war in Deutschland noch relativ unbekannt und zum ersten Mal in Europa. Natürlich konnte man im südhessischen Odenwald den WDR nicht direkt per Antenne empfangen. Die Sendung wurde aber vom Hessischen Fernsehen im Rahmen der »Eurovision« übernommen und war daher regional verfügbar. Am damaligen Schwarzweiß-Fernseher gab es keinen Stereo-Ton. Deshalb wurde die Musik zur Fernsehsendung parallel per UKW-Radio in Stereo gehört. Musik zum Mit-Nachhause-Nehmen konnte man stückweise im Plattenladen auf Vinyl-LPs kaufen. Nicht unüblich war der Mitschnitt von Radiomusik per Tonband-Kassettenrekorder. Die Audio-Qualität dieser privaten »bootlegs« war allerdings lausig.
Die Musik von ZZ Top war in der Odenwälder »Szene« allerdings doch schon ein wenig bekannt geworden. In dieser Zeit, das mag ebenfalls etwa im Jahr 1980 gewesen sein, trat im Saal des eigentlich recht biederen Odenwälder Gasthauses »Zur Spreng« eine Band »Rodgau Monotones« auf. Und diese Leute – »crazy enough« – spielten auch Stücke von ZZ Top. Nach einem ersten Auftritt der Rodgau Monotones fragten die Gasthaus-Inhaber, ob diese Musik »denn soweit OK« wäre. Nachdem dies durchweg bejaht wurde, hatten die Rodgau Monotones sogar einen zweiten Auftritt in der »Spreng«. Im April 1980 in der Grugahalle in Essen war – nach einem Kameraschwenk – im Rockpalast-Publikum ein Transparent zu sehen, auf das die Worte »RODGAU MONOTONES grüssen ZZTOP« gepinselt waren. Das war schon »more crazy«, aber »most crazy« war, dass eben diese Rodgau Monotones – »Die Hesse komme!« – im Oktober 1985 selbst auf der Bühne des Rockpalast in Essen stehen sollten. Spaßvögel im Publikum in der Grugahalle schwenkten nun ein Transparent mit »ZZ Top grüßt die Rodgau Monotones«. Diese Dialektik der »Weltklasse der Provinz« und der »Provinz der Weltklasse« ist faszinierend – und sie ist für die Besiedlung der Digitalen Welt und der »Globalen Provinz« nicht untypisch.¶
Der WANG-Computer am Gymnasium in Michelstadt war ein Kasten von ungefähr der Größe eines Pilotenkoffers und er verfügte über vier Kilobyte Hauptspeicher. Ein ausrangierter Fernschreiber, ein Telex-Gerät, stand für die Ein- und Ausgabe von Daten am WANG zur Verfügung. Das Telex hatte eine Tastatur, einen Zylinderkopf-Drucker sowie einen Schreiber und Leser für fünf-kanalige Lochstreifen. Die Lochstreifen waren die einzige Möglichkeit, größere Datenmengen, und damit auch Programm-Quellcode, dauerhaft zu speichern. Der Schulcomputer hatte notabene noch keine Festplatte oder andere elektromagnetische oder gar optische Speichermedien. Ein altes Fernsehgerät, dessen Empfangsteil kaputt war, diente als zusätzlicher Monitor.
Man musste sparsam sein, denn man war für den Betrieb des WANG auf Spenden angewiesen. Öffentliche Mittel gab es für einen Computer an einer Schule natürlich noch nicht. Der Computer hatte immerhin etwa 20 000 D-Mark gekostet, was im Jahr 2020 etwa 25 000 EURO entspräche. Der teure Computer erhielt einen eigenen »Computerraum«. Solche Spezialräume gab es bislang nur für den Musikunterricht, mit einem Klavier darin, oder für die Naturwissenschaften, mit Sammlungen und Geräten für diverse Experimente. In seinem »Computerraum« hatte es der Computer gemütlich, dort konnte er nachts schlafen und sich am Wochenende ausruhen. Er konnte ja nicht ahnen, dass für Computer sehr bald eine 7-Tage-24-Stunden-Arbeitszeit üblich sein würde.
Die Schüler, die das nagelneue Fach »Programmieren« belegten und damit, wie man sagte, »an den Computer durften«, trugen die zusammengewickelten Lochstreifenrollen der von ihnen erstellten Programme mit sich herum. Es war das »Statussymbol« der einschlägig Inaugurierten. Im Fach Programmieren wurde man als Schüler unterrichtet, was ein Programm ist und macht, und man lernte die Programmiersprache BASIC kennen. Algorithmen wurden als Daten-Flussdiagramme und Programm-Ablaufpläne in die Schulhefte gemalt. Wir Schüler hatten übungshalber Programmieraufgaben zu lösen. Ich realisierte damals ein Programm, das zu einer gegebenen Wertetabelle als Input feststellte, ob diese Wertetabelle, also die Elemente und ihre Verknüpfung in der Tabelle, eine sogenannte »Abelsche Gruppe« darstellte – oder eben nicht, »Ja« oder »Nein«. Der Output meines Programms war also ein einziges Bit. Aber auch so ein einziges Bit kann eine wertvolle Information darstellen.
Als eine zusätzliche Möglichkeit der Dateneingabe verfügte der Schulcomputer noch über einen Markierungskartenleser. Einer der Physiklehrer ließ uns – von ihm sogenannte – »Computerklausuren« schreiben. Die Ergebnisse der Aufgaben wurden von uns Schülern kodiert mit Bleistift auf eine Markierungskarte übertragen und vom WANG-Schulcomputer ausgewertet. Innerhalb weniger Minuten lagen die Noten vor – ein Vorgang, der bei einer regulären Korrektur durch den Lehrer einige Tage gedauert hätte. Ich hatte mich mit den Markierungen auf meiner Karte vertan und erhielt in einer Physikklausur die – nun gar nicht so gute – Note 3. Natürlich habe ich gegen das skandalöse und offensichtliche Fehlurteil protestiert. Der Lehrer wiegelte ab, er könne da leider nichts mehr machen. Das Verfahren sei nun einmal so »programmiert«. Ich war zum Opfer eines starr programmierten und daher inhumanen Prozesses geworden. Dieser Kartenmarkierungs-Fehler ist mir unvergesslich – und nur(!) deshalb kann an dieser Stelle davon berichtet werden.
Ein Original-Computer WANG mit Peripherie vom Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre. Er ist ein Exponat des »technikum29 Computermuseum« in Kelkheim (Taunus). Abgebildet ist eine funktionsfähige Computer-Anlage WANG 2200B mit umfangreicher Peripherie, wie Monitor (mit einem niedlichen Bildschirm, ohne eine Tastatur, aber mit einem Kassettenlaufwerk als Speicher), separater Tastatur, Kartenlesern – das alles steht im oberen Regal. Der eigentliche Computer steht unten in der Mitte. Neben dem riesigen dreifachen 8-Zoll Diskettenlaufwerk – unten links – ist insbesondere das Plattensystem – unten rechts – bemerkenswert. Es ist gigantisch und hat eine Masse von circa 100 kg und kann – damals sehr komfortable – 5 Megabyte an Daten speichern. Am Gymnasium in Michelstadt hingegen wurde der Schulcomputer WANG fast 40 Jahre im Magazin auf dem Dachboden aufbewahrt. Dann verliert sich seine Spur. Ein banales Ende eines verdienstvollen Lebens – um es anthropomorph auszudrücken.
Nichtsdestoweniger stellte es für die Schüler einen absoluten Glücksfall dar, dass sie schon so früh mit dem Metier »Computer« in Kontakt gekommen waren. Noch Jahre später hat man bei den diversen Abitur-Ehemaligen-Jubiläen Personen treffen können, die in diversen Bereichen der Informationstechnologie sehr erfolgreich tätig waren. Das Fach »Programmieren« in der Schule hatte schon einen Nutzen für den späteren Berufsweg. Allerdings gab es unter Absolventen auch den Geschäftsführer eines erfolgreichen IT-Unternehmens, der am Gymnasium seinerzeit in »Programmieren« die Note 5 geerntet hatte – und damit gerne kokettierte. Ein einfacher Kausalzusammenhang zwischen Programmierunterricht und beruflichem Erfolg in der IT scheint also auch nicht unbedingt gegeben zu sein.
Der WANG-Schulcomputer hatte ausgesprochene Verehrer. Typischerweise waren das solche Mitschüler, die dem Taxon der Schlaumeier-Artigen zuzurechnen waren. Diese jungen Leute waren das, was man viele Jahre später als »Nerds« bezeichnen sollte. Sie hatten Lochstreifenrollen mit riesigem Durchmesser bei sich und erheischten, damit auftretend, schon einigen Respekt. Einer hatte sogar ein BASIC-Programm geschrieben, mit dem man das Brettspiel »Dame« spielen konnte. Nicht nur mir war völlig unverständlich, was das sollte. Einerseits war der Computer nicht in der Lage, die interessanten, menschlichen Regungen kundzutun, die mit einem Gewinnen oder Verlieren des Spiels verbunden waren. Andererseits kam mir das so vor, als wolle man in einem Hundertmeterlauf gegen ein Motorrad antreten. Das mag ja zu Gottfried Daimlers Zeiten gerade noch lustig gewesen sein. Aber eines Tages würden die Programme und Maschinen formale Spiele, wie »Dame« oder auch »Schach«, sowieso immer gewinnen. Ein Spielen mit einem Computer kann zu einem gigantischen »waste of time« werden. Und so wurde ich in Sachen Computerspiele quasi ein »Abstinenzler« – was sich im Laufe der Jahre als sehr nutzbringend erwiesen hat. Aus der Sicht der Schulleitung schildert an dieser Stelle nun Richard Knapp, was aus der Computerbenutzung an der Schule zu Beginn der 2020er-Jahre geworden ist.
Studiendirektor Richard Knapp, Leiter des Gymnasiums Michelstadt
Exkurs – Computer in der Schule
Wenn man das so liest, so erinnert man sich zurück an die ersten Schulcomputer zu Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre als die damaligen Vorboten einer neuen Zeit. Es war Ende der 1970-er-, Anfang der 1980-er- Jahre, als die ersten Computer ihren Weg in die Schulen fanden. Das waren keine wirklichen Arbeitsgeräte, sondern eher Maschinen, an denen sich kleine Gruppen von mathematisch Interessierten in Sachen Logik und Programmierung ausprobierten. Diese ersten Computer verschwanden irgendwann auf den Dachböden der Schulgebäude, denn sie wurden schnell von der nächsten Generation der Informationstechnik verdrängt, die leistungsfähiger und günstiger waren, das Betriebssystem war nutzerfreundlicher. Die PCs hielten langsam Einzug in die Schulen und zwar in zwei Bereichen. In der Verwaltung ersetzte der PC zunächst die Schreibmaschine. Es folgte eine einfache Datenverarbeitung, die zur Stundenplanerstellung genutzt werden konnte. Von dort führte ein direkter, aber langsamer Weg zur weitgehenden Digitalisierung der Verwaltung. Parallel dazu nutzten immer mehr Lehrkräfte den PC zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien. Auch hier nahmen die Möglichkeiten mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Geräte zu, ohne dass diese jedoch wirklich den Weg in die Klassenzimmer gefunden hätten. Eine Ausnahme bildeten die sogenannten »Computerräume«, in denen den Lernenden informationstechnische Grundkompetenzen beigebracht wurden.
Zwei Neuerungen leiteten dann – so ab dem Jahr 2010 – einen fundamentalen Wandel ein. Die erste Neuerung war die zunehmende Bedeutung des Internets für die Lernenden. Es war zunächst als Informationsquelle wichtig, aber auch als Kommunikationsmedium über soziale Plattformen, wie zunächst Schüler-VZ und später Facebook und Instagram. Letztlich kamen die Schülerinnen und Schüler damit erst so richtig »ins Boot« der Informationsgesellschaft. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch eine zweite Neuerung. Die Verbreitung von Smartphones ermöglichte die Nutzung des Internets – vor allem für diese genannten Zwecke – auch mobil, immer und überall. Die Schulen arbeiteten an Regelungen, wie mit diesen Handheld-Computern umgegangen werden soll, ob sie im Unterricht und auf dem Pausenhof erlaubt oder verboten sein sollten. Für Schülerinnen und Schüler waren und sind Computer zuallererst Geräte für die Kommunikation und Unterhaltung. Es muss ihnen – zum Teil recht mühsam – erst noch beigebracht werden, dass man damit auch arbeiten kann.
Die Informationsgesellschaft hat in den Jahren von 2015 bis 2020 den Unterricht in der Schule gewandelt. Im Schulunterricht kamen leistungsfähige Präsentationsgeräte, wie das interaktive Whiteboard auf. Ein weiterer Wandel wurde vor allem durch die Corona-Pandemie des Jahres 2020 beschleunigt. Bessere Endgeräte und Internetanbindungen ermöglichen die Nutzung von Online-Lernplattformen, Cloud-Lösungen und Videokonferenzsystemen im schulischen Alltag. Damit ergibt sich aktuell eine Situation mit großem Potenzial, aber auch nicht zu unterschätzenden Risiken.
Durch finanzielle Unterstützungsprojekte, wie den sogenannten »Digitalpakt«, werden Schulen nach und nach in allen Räumen mit digitaler Infrastruktur, von Computern über Anzeigegeräte bis hin zu WLAN, ausgestattet. Gleichzeitig verfügen fast alle Schülerinnen und Schüler über private und portable Endgeräte, wie Smartphones, Tablets, Laptops. Der Ausdruck »bring your own device« kennzeichnet diese Situation. Es gibt Leihgeräte, um eventuelle Ausstattungslücken zu decken, und je nach Konzept, »Tablet-Koffer« oder Ähnliches zur Arbeit mit digitalen Medien im Klassenraum. So verlieren die ehedem modernen »Computerräume« paradoxerweise wieder ihre Bedeutung, da viele Nutzungen nun in den regulären Klassenräumen stattfinden können.
Das Strategiepapier »Bildung in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz aus den Jahren 2016 und 2017 legt sehr detailliert fest, über welche Kompetenzen in Bezug auf digitale Medien die Lernenden heute verfügen sollen. Spätestens seitdem stehen Schulen vor der Herausforderung, in Konzepten zu präzisieren, wie sie sich die »Bildung mit digitalen Medien«, aber auch die »Bildung über digitale Medien« vorstellen. Von der Architektur des Internets über soziale Aspekte, Medienkritik, Spielsucht bis zum Datenschutz ist dies eine gewaltige, aber eminent wichtige Bildungsaufgabe, die Schulen bewältigen müssen. Bedauerlicherweise stehen dafür kein eigenes Fach »Informationsund Medienkompetenz« oder zusätzliche Unterrichtsstunden zur Verfügung.
Die Nutzung von digitalen Medien für den Unterricht vor Ort oder auch zu Hause ermöglicht völlig neue, auch individuelle Lernzugänge, die das Lernen bereichern und effizienter machen können. Den sozialen Kontakt jedoch können digitale Medien weder zur Lehrperson noch zu Mitschüler*innen dauerhaft ersetzen und ihre extensive Nutzung birgt sehr wohl ernsthafte Gefahren für die psychische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Hier eine gute Balance zu finden, ist eine der großen Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben der Schulen.¶
Am 12. Mai 1941 hatte Konrad Zuse seinen Z3, den ersten »echten«, programmierbaren, elektronischen Computer, der Öffentlichkeit vorgestellt. Das war im Frühjahr des Jahres 1981 gerade erst 40 Jahre her. Die Bedeutung dieser Erfindung sollte in den kommenden(!) 40 Jahren eine ungleich größere als in den vergangenen(!) 40 Jahren werden. Für Schüler wie mich war im Frühjahr 1981 vor allem das Ablegen der diversen Abiturprüfungen wichtig. Zum Schluss der Schulzeit war eine große Feierstunde anberaumt, bei der die frischen Abiturienten der Schule – es waren immerhin über 150 – ihre Zeugnisse erhielten. Die Jahrgangsbesten wurden gewürdigt. Vertreter der Lehrer, der Elternschaft und der Schüler hielten jeweils eine kleine Rede. Ich sprach für die Schüler, denn man meinte, diese Aufgabe fiele dem »Schüler Hofmann« ja sicher ganz leicht. Das Thema meines Vortrags war »Vermassung, Vereinsamung und Entfremdung«. Ich erläuterte, dass die – damals noch relativ neue – Struktur des Kurssystems, das die alten Schulklassen abgelöst hatte, die von Karl Marx für die Lohnarbeiter geschilderten Entfremdungsphänomene fördert. »Der Schüler ist in der Schule außer sich und außer der Schule bei sich« – so eine meiner Formulierungen. In den quasi »kontextfreien« Kursen wurde der übergreifende Sinn der Lerninhalte nicht mehr in dem Maß wie früher vermittelt, als die Lehrpersonen eine Schulklasse über Jahre hinweg »kontextsensitiv« begleiteten und prägten. Der Dreikampf »Lernen, Prüfen, Vergessen« konnte bei vom Lehrgegenstand quasi »entfremdeten« Schülern verstärkt beobachtet werden. In der zuhörenden Elternschaft gab es einige reaktionäre Elemente, die allein schon die Erwähnung von Karl Marx in meiner Rede zum Anlass nahmen, meine Ausführungen in Grund und Boden zu verdammen. Verstanden hatten sie zwar relativ wenig, aber zu einem diskreditierenden Protest sahen sie sich allemal qualifiziert.
Auf den philosophischen Weg – und damit auch zu Karl Marx – war ich damals gelangt, weil ein – weiteres – Wahlfach »Philosophie« am Gymnasium angeboten wurde. Es wurde vom späteren Direktor der Schule, Ernst Ruppert, angeboten. Wir Schüler hatten als Basislektüre das Buch von Wilhelm Weischedel »Die philosophische Hintertreppe: Die großen Philosophen in Alltag und Denken« erhalten. Im Unterricht von Ernst Ruppert wurden wir auch mit dem von Karl Raimund Popper geprägten Kritischen Rationalismus bekannt gemacht. Die Frage ist – nach Popper – nicht die absolute Korrektheit einer wissenschaftlichen Theorie, sondern was zu tun sei, wenn man eventuell Fehler in einer Theorie findet. Dieser Ansatz des Kritischen Rationalismus sollte viele Jahre später im Metier der Digitalen Ethik und der Ethik der Automatisierung eine wichtige Rolle spielen. Der kritische Rationalismus fragt danach, wie fehlerhafte Automaten als solche erkannt und verbessert werden können.
Einige Monate nach dem Abitur passierte etwas, was viele Jahre später ein »Posting« genannt werden sollte. Eine Mitschülerin hatte das Manuskript meiner Abiturrede, das ich ihr im Entwurf zwecks Kommentierung überlassen hatte, ohne Rücksprache an die Wochenzeitung »Die Zeit« geschickt. Der Zeit-Redakteur Michael Schwelien bereitete gerade die Herausgabe des Buches »Vorbereitet fürs Leben? Deutsche Abiturreden heute« vor – und meine Rede wurde darin abgedruckt. Ohne mein weiteres Zutun war das (m)eine erste echte Publikation. Zu Beginn der 2020er-Jahre würde ein Abiturient einen solchen Text einfach in ein Netzwerk stellen – dann wäre er auch von quasi »allen Leuten« lesbar.
Im Sommer 1981 war die Schule dann aus – die Schulzeit vorbei. Von bleibendem Wert waren ausgerechnet die zwei – damals eigentlich ganz nebensächlichen – Wahlfächer »Programmieren« und »Philosophie«. Sie spielten für das Arbeiten und Zurechtfinden in der kommenden Informationsgesellschaft eine wichtige Rolle.