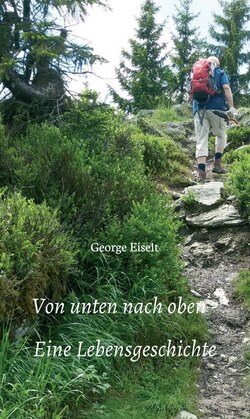Читать книгу Von unten nach oben - Eine Lebensgeschichte - George Eiselt - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKindheit und Jugend
Wie eingangs bereits erwähnt, starb meine Mutter, als ich knapp ein Jahr alt war. Mein Vater ließ sie zur Beerdigung in ihre Heimat nach Großläswitz, bei Liegnitz, in Schlesien überführen, wo sie sich auch kennengelernt hatten und wo auch noch meine Großeltern wohnten. Er ging damals noch von der irrigen Annahme aus, dass Deutschland den Krieg siegreich beenden und er mitsamt der gesamten Familie dorthin zurückkehren würde, obwohl er wehrmachtsbedingt als Berufssoldat 1939 schon in Halle/Saale eine für die damalige Zeit sehr schöne Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad, in dem sogar ein Badeofen stand, bezogen hatte.
Nach dem Tod meiner Mutter musste sich nun jemand um uns drei Kinder kümmern, da, wie bereits erwähnt, mein Vater wieder zu seiner Einheit zurückkehren musste. Nun ergab es sich, dass meine Mutter, neben etlichen anderen Geschwistern, noch eine Schwester hatte, die zwar ca. sieben Jahre jünger als sie war, aber schon immer, während ihrer reiferen Jugendzeit einen schmachtenden Blick auf meinen Vater geworfen hatte. Sie zog kurz nach dem Umzug meiner Mutter ebenfalls nach Halle und nahm eine Stellung in einem Kinderheim an. Infolge des plötzlichen Ablebens meiner Mutter löste sie kurzerhand eine zwischenzeitlich eingegangene Verlobung auf, übernahm selbstlos die Aufsicht und Erziehung von uns drei Kindern und bewahrte uns damit auch vor dem Schicksal der Einweisung in irgendwelche Erziehungsheime. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal knapp 20 Jahre alt. Um den Status des Erziehungsberechtigten zu erlangen, ging sie eine sogenannte Fernehe mit meinem Vater ein, der, wie bereits erwähnt, in Amerika in der Gefangenschaft war. Damit war auch gleichzeitig sichergestellt, dass sie die zum Erhalt bestimmter Grundnahrungsmittel für uns Kinder, wie z.B. Milch, Butter, Brot, notwendigen Lebensmittelmarken zugeteilt bekam. Nach der Rückkehr meines Vaters aus der Gefangenschaft wurde dann die Eheschließung richtig standesamtlich vollzogen, so dass wir nun wieder eine richtige Mutter hatten, aber das war sie für uns ohnehin schon von Anfang an.
Zwischenzeitlich mussten wir unsere Wohnung wegen immer wiederkehrender Bombenalarme verlassen und zogen in ein kleines Dorf nahe Halle, Nietleben, zu einer Cousine meiner Mutter. Als wir nach ca. 6 Wochen zurückkehrten, war tatsächlich unser linkes Nachbarhaus nur noch eine Schutthalde, während alle anderen Häuser in unserer Straße unbehelligt waren. Wahrscheinlich hatte sich eine Bombe unbeabsichtigt gelöst, denn Halle selbst war nie das Ziel gezielter Bombenangriffe, sondern wurde lediglich von den Bomberstaffeln überflogen.
Diese Ruine war für mich und die Nachbarskinder später, als ich im schulfähigen Alter war, der ideale Spielplatz. Wir bauten zum Beispiel aus den Steinen im Schutt des zerbombten Hauses kleine Bunker, in die wir je 5 Hölzchen von ungefähr fünf Zentimeter Länge aufrecht steckten und anschließend den Bunker wieder mit Ziegelsteinen verschlossen. Nunmehr ließen wir auf den gegnerischen Bunker dreimal einen Ziegelstein niedersausen. Danach wurden die Bunker vorsichtig geöffnet und derjenige, bei dem noch die meisten Hölzchen aufrecht standen, war der Sieger dieses Wettkampfes. Dieses Spiel nannten wir Bunkerschmeißen.
Anfang 1945 zogen in unsere Wohnung auch noch meine Großeltern ein, die aus Großläswitz in Schlesien flüchten mussten unter Aufgabe ihres Grundstücks sowie des gesamten Hab und Gutes. Mein Opa war zu dieser Zeit 57 und meine Oma 54 Jahre alt. Bis zur Rückkehr meines Vaters aus der Gefangenschaft lag die Erziehung von mir und meinen Brüdern somit auch teilweise in den Händen unserer Oma und unseres Opas, wobei gesagt werden muss, dass letzterer erziehungsmäßig keinen großen Einfluss auf uns ausübte, da er eine ausgesprochen gutmütige Natur war.
Kurz nach der Rückkehr meines Vaters aus der Gefangenschaft bekamen meine Großeltern ebenfalls in Halle eine eigene kleine Wohnung zugewiesen, so dass wir drei Kinder jetzt ein eigenes Kinderzimmer hatten. Die Einrichtung war entsprechend den damaligen Gegebenheiten spartanisch. An einer Wand standen zwei Betten, an der anderen Wand stand ein Bett und ein selbstgezimmertes einfaches Regal und in der Mitte ein Tisch mit vier Stühlen.
In diesem Zimmer mussten meine Brüder und ich Punkt 17: 00 Uhr, das war die Zeit, wenn mein Vater täglich von der Arbeit kam, mit unseren Schulheften und natürlich den unserer Meinung nach gewissenhaft erledigten Hausaufgaben zur Kontrolle derselben am besagten Tisch sitzen. Für mich war das immer eine Tortour, denn im Gegensatz zu meinen Brüdern hatte ich es nicht so mit der Schule. Besonders meine selbst für mich schwer lesbare Schrift hatte es meinem Vater immer wieder angetan, so dass er mir laufend seine Aufzeichnungen, die er während seiner Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten auf der Abendschule machte, als lobenswertes Beispiel vorlegte. Er hatte nämlich jede Mitschrift zu Hause noch einmal ins Reine geschrieben und zwar in solch einer akkuraten Art und Weise, so wie die Mönche früher die einzelnen Bibelseiten abgeschrieben hatten.
Aber nicht nur, was die Schrift betraf, war mein Vater oft nicht von mir angetan, sondern meine schulischen Leistungen insgesamt wurden meistens nicht so recht von ihm gewürdigt. Zum Beispiel gab es zu unserer Zeit in der Grundschule bis zur vierten Klasse noch die sogenannten Verhaltensnoten, die da waren Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung. Bei den ersteren drei Noten kam ich nie über ein „Genügend“, das war damals eine Drei, hinaus. In jedem Zeugnis wurde mir schriftlich vorgeworfen, dass ich laufend unruhig und abgelenkt bin, dass ich immer schwatze und damit den Unterricht störe und somit bei besserer Konzentration wesentlich bessere Leistungen erzielen könnte. Der einzige Lichtblick war die Ordnungsnote, wo ich immer eine Zwei erhielt, aber der ehrlichkeitshalber muss ich zugeben, dass das wohl mehr das Verdienst meines Vaters war, da er immer sehr auf die Vollständigkeit meiner schulischen Unterlagen achtete. Ansonsten waren meine schulischen Leistungen wie man sagt „so la la“, das heißt, ich hatte immer ziemlich durchschnittliche Noten auf den Zeugnissen. Einen krassen Ausrutscher gab es lediglich einmal auf einem Zwischenzeugnis in der siebenten Klasse, da erschienen plötzlich vier Vieren, aber diesmal nicht in den allgemeinen Verhaltensnoten, sondern in ziemlich wichtigen Fächern. Weil mir das nun aber doch ein bisschen zu viel der schlechten Zensuren war, hatte ich den heroischen Einfall, wenigstens eine Vier durch eine Drei zu ersetzen. Das bewerkstelligte ich, indem mir „aus Versehen“ ein Tropfen aus meinem Füllfederhalter auf eine Vier fiel, den ich meiner Meinung nach geschickt mit einer Rasierklinge entfernte und an diese Stelle eine Drei schrieb. Meinem Vater konnte ich das glaubwürdig darstellen, aber nachdem ich das von ihm unterschriebene Zeugnis der Klassenlehrerin nach den Schulferien zurückgab, natürlich hatte ich die gefälschte Drei wieder in eine Vier verwandelt, flog der ganze Schwindel auf. An dem Tag der Zeugnisrückgabe war das jedoch nicht das einzige Fiasko, was mir widerfuhr. Denn in der großen Hofpause, das ist die Pause, wo das Mittagessen ausgegeben wird, veranstalteten wir, also einige Schüler, regelmäßig sogenannte Reiterkämpfe. Ich, der ich immer schon in der Körpergröße relativ kurz geraten war, saß dabei bei meinem an Wuchs größeren Partner auf der Schulter und musste nun versuchen, meinen Gegner, der ebenfalls auf der Schulter eines Schülers saß, zu Boden zu werfen. Ich möchte mich hier nicht rühmen, aber meistens ging ich als Sieger hervor, was mir, nebenbei bemerkt, höchste Sympathiewerte in der Klasse einbrachte. An diesem Tag jedoch fiel mein Gegner so unglücklich auf den Boden, dass ein Arm von ihm nicht mehr so war, wie er eigentlich sein müsste, er zog sich dabei nämlich einen Bruch zu. Wegen dieses Vorkommnisses wurde ich in der darauffolgenden Unterrichtsstunde zum Schuldirektor beordert, um dort noch einmal den genauen Sachverhalt zu schildern. Nun war es zu jener Zeit so, dass es in der großen Pause zum damals nicht gerade sehr üppigen Mittagessen immer ein trockenes Brötchen dazugab. In besagter Unterrichtsstunde war ich jedenfalls gerade dabei, dieses Brötchen zu mir zu nehmen, hatte also den Mund in dem Moment richtig mit Selbigem gefüllt, als ich zum Direktor musste. Bevor ich ihm nun Rede und Antwort stehen konnte, war ich nun gezwungen, in seinem Beisein erst einmal meinen Mundinhalt in Richtung Magen zu leeren, was bei ihm natürlich nicht gerade zur Erheiterung beitrug. Ich musste also an diesem einen Tag drei für mich negative Ereignisse verkraften, die letztendlich auch noch in einem persönlichen Schülertagebuch festgehalten wurden, welches wöchentlich von den Eltern gegengezeichnet werden musste. In dieser Woche standen demzufolge die zuvor von mir noch nie erreichte Rekordanzahl von drei Tadeln im besagten Tagebuch. Da die Klassenlehrerin mir nicht zutraute, dass ich es in unverfälschter Form meinen Eltern zur Unterschrift vorlegte, wurde es in solchen Fällen immer einer Musterschülerin mitgegeben, die den gleichen Nachhauseweg wie ich hatte. Sie übergab es immer meiner Mutter und abends folgte dann die Standpauke seitens meines Vaters, einhergehend mit der Verkündung gewisser für mich einschneidender erzieherischer Maßnahmen. In diesem Fall zum Beispiel bekam ich drei Monate Stubenarrest, durfte also nicht mehr allein raus zum Spielen, sondern nur im Auftrag meiner Eltern Einkäufe tätigen. Meine Mutter jedoch, die dieses Strafmaß ihrer Meinung nach für unangemessen hoch empfand, gewährte mir trotzdem einige Strafmaßerleichterungen, ohne, dass mein Vater davon erfuhr.
Im Großen und Ganzen kann ich aber sagen, dass ich eine relativ ausgeglichene Kindheit erleben durfte, die nur ab und wann vom scherzhaft boshaften Treiben meiner Brüder getrübt wurde. Sie trieben nämlich des Öfteren ihren Schabernack mit mir, der mich teilweise seelisch sehr belastete. Ein Beispiel möchte ich an dieser Stelle kurz ansprechen.
Da ich als das jüngste Kind immer zuerst ins Bett musste und meine Eltern auch nicht immer anwesend waren, dachten sich meine Brüder, dass es doch lustig wäre, mich mal auf gruselige Art richtig zu erschrecken. Sie steckten sich jeder eine kleine Taschenlampe in den Mund, beugten sich in dem verdunkelten Zimmer über mich und gaben dabei laute gespenstige Töne von sich. Dass ich dadurch einen tüchtigen Schreck bekam, kann wohl jeder nachvollziehen. Das hatte bei mir teilweise solche tiefgründigen Nachwirkungen, dass ich immer mit schaurig ängstlichem Gemüt in den Keller ging, wenn ich den Auftrag bekam, etwas hochzuholen.
Im Allgemeinen aber war das Zusammenleben mit meinen Brüdern schon in Ordnung und ich konnte in vielerlei Hinsicht von ihnen profitieren. Zum Beispiel hatten wir Kinder in den fünfziger Jahren aus finanziellen Gründen noch kein eigenes Radio in unserem Zimmer. Mein ältester Bruder, der den Beruf des Elektrikers absolviert hatte, bastelte für uns Kinder einen sogenannten Behelfsradioempfänger auf der Basis eines Detektors. Er bestand aus einem streichholzschachtelgroßen Gehäuse, indem ein kleiner Siliziumkristallstein befestigt war, auf den wiederum eine Feder, so groß wie die in einem Kugelschreiber, drückte. Diese Feder war außen mit einem Drehgriff verbunden, so dass man damit auf dem Kristall herumkratzen konnte. Der Kristall war außerdem noch mit einer Spule mit einem kleinen Magneten verbunden, an dem ein langer Draht befestigt war, der als Antenne fungierte. Um die Antennenwirkung noch zu vergrößern, wurde der Draht zusätzlich noch an die Spiralfedern eines Bettes angeschlossen. An der Spule schließlich war noch ein kleiner Kopfhörer angeschlossen, den man ans Ohr drücken konnte. Wenn man jetzt mittels des Drehgriffes an dem Kristall herumkratzte, so ertönte bei bestimmten Stellungen Musik von irgendwelchen undefinierbaren Sendern, die natürlich qualitätsmäßig nicht das größte Klangerlebnis darstellte, aber für uns ein großartiges Erlebnis war.
Ein Ereignis in meiner Kindheit verdient im Zusammenhang mit meinen Brüdern noch besondere Erwähnung. Am Heilig Abend wurde bei uns immer vor der Bescherung erst in der Küche Abendbrot gegessen. In den ersten Jahren nach dem Krieg, wo noch keine speisemäßige Üppigkeit herrschte, kam an diesen Abenden regelmäßig ein Gericht auf den Tisch, was aus übereinander geschichteten und in Milch eingeweichten Weißbrotscheiben bestand, jede Schicht wurde außerdem mit Zucker und Mohnsamen bestreut. Es nannte sich Schlesische Mohn-Kließla. Diese Speise wurde dann auf die Teller verteilt und mit einem Löffel gegessen. In den späteren Jahren, wo es uns finanziell schon besser ging, gab es an Stelle der erstgenannten Speise prinzipiell pro Kopf zwei Knackwürste mit Kartoffelsalat. Solchermaßen gesättigt ging es dann zur Bescherung über den Korridor ins Wohnzimmer, wobei auf diesem Weg immer zusammen ein Weihnachtslied geträllert wurde. Im Wohnzimmer bestaunten wir zuerst den von unseren Eltern in totaler Abgeschiedenheit geschmückten Weihnachtsbaum und stürzten uns dann natürlich auf unsere Geschenke. Die fielen natürlich damals nicht so üppig aus, wie es heute üblich ist, aber wir erfreuten uns auch an kleineren Sachen. Als ich schon in die Schule ging und unsere finanzielle Situation schon besser war, bekam ich einmal einen Stabil-Baukasten ganz für mich allein, vorher waren es immer Geschenke, die für alle Verwendung hatten, wie z.B. Gesellschaftsspiele, sowie irgendwelche selbstgestrickten Sachen zum Anziehen. Nebenbei gesagt, sah unser Tannenbaum auch nicht so aus, wie man es heute so gewohnt ist. Wir hatten in der DDR immer nur Fichten als Weihnachtsbaum, die meistens schon beim Schmücken so viele Nadeln verloren, dass sie regelrecht gerupft aussahen. Als wir das erste Weihnachten in der BRD feierten, kauften wir uns eine Edeltanne für 35 DM, obwohl unser finanzieller Rahmen damals noch sehr eng gestrickt war. Aber wenn man die Photographien mit denen von früher vergleicht, fällt einem der Unterschied erst so richtig ins Auge. So einen Baum, wie wir ihn früher hatten, würden sich heute noch nicht einmal die Ärmsten von den Armen in die Wohnung stellen.
An dem für mich besonderem Weihnachtsabend jedoch traute ich kaum meinen Augen, denn unter dem Weihnachtsbaum war ein kreisförmiger Schienenstrang aufgebaut mit einer elektrischen Eisenbahn einschließlich einigen Anhängern. Diese Anlage hatte mein mittlerer Bruder mit Hilfe eines kleinen Zuschusses meiner Eltern gekauft, der zu dieser Zeit schon seine Ausbildung als Fernmeldebaumonteur absolviert hatte und sein eigenes Geld verdiente.
Diese kleine Eisenbahnanlage zog eine mehrere Monate dauernde Bastelzeit nach sich, denn wir schufen aus diesen Anfängen eine Anlage, die ca. 2,00 m in der Länge sowie 1,50 m in der Tiefe maß. Die Grundlage hierfür bildete eine Spanplatte, die über das Bett unseres inzwischen aus der Wohnung ausgezogenen älteren Bruders gelegt wurde. Sämtliche Aufbauten, wie zum Beispiel Landschaft mit Gebirge und Tunnel, Straßenzüge, Bäume, Sträucher und Häuser wurden von uns selbst gebastelt. Lediglich das Bahnhofsgebäude mit Bahnsteig sowie Ampelanlagen und Schranken, die entsprechend der Notwendigkeit automatisch gesteuert wurden, hatten wir käuflich erworben. Ich war hierbei für die Aufbauten zuständig und mein Bruder für die komplette Elektrik. Auf dieser Anlage befanden sich zwei durch fünf Weichen miteinander verbundene Schienenstränge sowie ein einzelner gerader Strang für einen Sackbahnhof. Wir hatten darauf einen Personentriebwagen mit zwei
Anhängern sowie eine Dampflokomotive, natürlich in diesem Fall elektrisch betrieben, mit mehreren Anhängern im Einsatz. Gesteuert wurde das alles über ein von meinem Bruder geschaffenes Schaltpult, man konnte sogar zwei Züge gleichzeitig auf getrennten Schienensträngen gegenläufig fahren lassen.
Ich möchte ja nicht prahlen, aber mit dieser Anlage hätten wir heutzutage bei Ausstellungen bestimmt deftige Preise eingeheimst. Ca. ein halbes Jahr lang hatten wir an den Wochenenden immer viele Freunde zum Spielen bei uns, bis dann allmählich das Interesse abnahm. Die Anlage wurde dann nach einiger Zeit bei uns auf dem Dachboden in unserer Dachkammer deponiert und ich glaube, meine Eltern waren auch froh, dass an den Wochenenden wieder Ruhe bei uns einkehrte.
Während der Grundschulzeit gehörte ich einer Gruppe, man kann schon fast sagen „Gang“, an, die aus vier Köpfen bestand. Einer davon lebte fast gegenüber unserer Grundschule in einem Wohnhaus auf einem großen Betriebsgelände, das Tag und Nacht von einem Pförtner in einem Pförtnerhäuschen bewacht wurde. Die anderen beiden stammten aus für die damalige Zeit relativ wohlhabenden Familien. Ich war in dieser Gruppe nicht nur der Kleinste, sondern in gewisser Hinsicht auch der Mittelloseste. Das kam besonders an den Kindergeburtstagsfeiern zum Ausdruck, bei welchen ich natürlich immer meine besten Kleidungsstücke am Körper trug, die aber nicht so salopp aussahen, wie die Sachen meiner Schulkameraden. Das lag vor allem daran, dass ich als das drittgeborene Kind immer die nicht mehr ganz so neuen Sachen meiner Brüder tragen musste und mich speziell zu den vorgenannten Anlässen immer sehr unwohl darin fühlte. Dazu kam noch, dass mein Geschenk sich gegenüber den anderen auch als sehr mickerig ausmachte. Dass die Eltern meiner Schulfreunde darüber ganz anders dachten, begriff ich damals mit meinem kindlichen Gemüt noch nicht so richtig.
Aber das sei nur nebenbei erwähnt. Auf diesem Betriebsgelände nunmehr befand sich neben einer Wäschemangel, wo meine Mutter immer die Bettwäsche von uns mangelte, eine Metallfabrik und eine Holzverarbeitungsfabrik, zu denen jeweils ein großer Lagerplatz gehörte. In der Metallfabrik wurden unter anderem große Aluminiumtöpfe mit Deckel mit einem Durchmesser von ungefähr 80 cm hergestellt und in der Holzfabrik wurden Paletten gefertigt. Auf dem Holzlagerplatz wiederum befanden sich zwei nebeneinanderliegende Schienenstränge, die in etwa 100 m lang und auf denen einfache Eisenloren abgestellt waren, womit die Paletten transportiert wurden. Diese Loren beluden wir mit handlichen Holzklötzen und mit jeweils zwei Mann Besatzung fuhren wir jeder auf seinem Schienenstrang aufeinander zu und bewarfen uns dabei mit den Holzstücken. Als Schutzschilde dienten uns dabei die mit einem Griff versehenen Aluminiumdeckel. Diesen Wettkampf betrieben wir in der Regel so lange, bis wir total erschöpft waren, denn das dauernde Schieben der Loren war ziemlich kraftanstrengend. Im Nachhinein wundere ich mich jetzt noch, dass wir dabei bis auf kleinere Blessuren keine schwerwiegenderen Verletzungen erlitten haben.
Anschließend erholten wir uns von den Strapazen in einem zweigeschossigen budenähnlichen Anbau, der sich mit einem separaten Eingang auf der Rückseite des Wohnhauses meines Schulfreundes befand und den er ganz allein für sich selbst nutzen durfte. Die Räume waren für unser Empfinden ziemlich komfortabel ausgestattet mit einer alten Couch, mehreren alten ausgedienten Autositzen sowie einem Tisch mit einigen Stühlen. Das Besondere an diesen Räumen war jedoch, dass wir in der oberen Etage, die nur mit einer einfachen Sprossenleiter zu erreichen war, diverse Sachen lagerten, die eigentlich noch nicht für unsere kindlichen Gemüter bestimmt waren, nämlich alkoholische Getränke verschiedenster Art sowie Zigaretten. Nun wird sich manch einer fragen, woher denn das Geld für diese Artikel stammte, denn unser sehr schmal bemessenes Taschengeld hätte dafür bei weitem nicht ausgereicht. Die Lösung dafür ist ganz einfach zu erläutern, denn wir haben diese Einkäufe bargeldlos getätigt. Bezugnehmend auf die Zeit, in der dieses hier vorliegende Werk geschrieben wurde, nämlich im Jahr 2020, kann man also getrost sagen, dass wir mit unserer bargeldlosen Zahlungsweise schon als Vorreiter des heute üblichen Geldverkehrs angesehen werden konnten.
Damals gab es noch nicht diese großen Kaufhallen wie heutzutage, sondern fast ausschließlich kleine Tante-Emma-Läden. Das waren also Läden, wo einige Regale mit den angebotenen Artikeln ringsherum an den Wänden standen und der Verkäufer hinter einer Ladentheke mit Registrierkasse stand. Unsere Vorgehensweise war im Prinzip immer die gleiche. Während zwei von uns den Verkäufer in ein Gespräch verwickelten und ihn nach irgendwelchen Artikeln befragten, die er nach unseren vorherigen Auskundschaftungen garantiert nicht im Sortiment hatte, tätigten die beiden anderen die sogenannten bargeldlosen Einkäufe. Dabei kam es natürlich öfter vor, dass der Verkäufer uns dabei erwischte, wenn wir etwas still und leise in unseren Taschen verschwinden ließen. Einmal z.B. fiel ein ca. ein Meter hoher pyramidenähnlicher Aufbau mit Süßigkeiten in sich zusammen, als wir davon etwas in unseren Taschen verschwinden lassen wollten. Bevor er aber hinter seiner Ladentheke hervorkam, um uns sozusagen dingfest zu machen, rannten wir wie die Wiesel in vier verschiedenen Richtungen aus dem Laden und trafen uns kurz darauf an einem vorher vereinbarten Ort. Danach bezogen wir wieder unsere gemütliche Bude, um unsere heroischen Erfolge mit Alkohol zu begießen und dabei natürlich auch eine oder mehrere Zigaretten inhalierten. Mir ist bis heute noch nicht so richtig klar, wie ich das alles vor meinen Eltern verheimlichen konnte, denn irgendwie müsste ja ein gewisser Mundgeruch von unserem Tun am Abend vorhanden gewesen sein.
Im Zusammenhang mit oben genanntem Holzplatz wäre noch erwähnenswert, dass sich darauf auch ein künstlich angelegter Feuerlöschteich befand, der eine Abmessung von ca. 20 x 20 m hatte und an seiner tiefsten Stelle so ca. 4 m Tiefe aufwies. Dieser Teich fror in den damaligen Wintern regelmäßig zu, so dass wir ihn privat für uns für Eishockeywettkämpfe nutzen konnten. Die Schläger fertigten wir uns aus den Holzteilen des Holzplatzes und als Schlittschuhe hatten wir solche, die man mit einer kleinen Kurbel an den Schuhen befestigen musste. Hierbei passierte es schon manchmal, dass, wenn man mal stolperte, sich der Schlittschuh löste und dabei ein Stück Untersohle von der Hacke des Schuhes mit daran hing. Dieser Schaden konnte jedoch von meinem Vater problemlos behoben werden, denn er besaß einen sogenannten Schusterdreifuß, mittels dem er die Sohle wieder befestigte. Dies erfolgte sogar ohne jegliche Rüge, denn der Schaden war ja bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung entstanden.
Nach Beendigung der Grundschule, also nach der achten Klasse, wollte ich die Schule verlassen und eine Lehre als Dreher beginnen in den Pumpenwerken Halle/Saale. Irgendwer muss mir diesen Beruf als sehr erstrebenswert eingeredet haben, jedoch dachte mein Vater völlig anders darüber. Obwohl ich schon einen unterschriebenen Lehrvertrag in der Tasche hatte, musste ich mich dem Willen meines Vaters beugen und selbigen wieder auflösen. Dafür meldete er mich in der Mittelschule an, mit dem Ziel des Erlangens des mittleren Reifezeugnisses nach der 10. Klasse. Dem musste ich mich letztendlich fügen und wechselte auf die Johannesschule, da in meiner bisherigen Schule ein höherer Abschluss nicht möglich war. Diese Schule war zu Fuß etwa 30 Minuten von unserer Wohnung entfernt, also völlig problemlos zu erreichen. Aus heutiger Sicht müsste ich meinem Vater für diese Schulentscheidung mehr als dankbar sein, aber zur damaligen Zeit hatte ich eben noch nicht den dafür erforderlichen Weisheitsgrad.
In den zwei Jahren des Besuches der Mittelschule jedoch musste mein Vater wiederum Ereignisse meinerseits verkraften, die sich einerseits aus dem Umgang mit dem von mir ausgewählten neuen Freundeskreis an der neuen Schule sowie andererseits aus einem neuerdings von mir neu endeckten experimentellem Tatendrang ergaben. Die erwähnten Ereignisse betrafen hier ausnahmsweise mal nicht die schulnotenbezogene Seite, denn die ließ meiner Meinung nach nichts zu wünschen übrig. Ich hatte während dieser Zeit durchgängig gute bis durchschnittliche Noten, was sich wahrscheinlich damit begründen lässt, dass bei mir schon ein gewisser Reifeprozess einsetzte. Sie hingen vielmehr mit dem schulwechselbedingten neuen Freundeskreis zusammen, den ich mir zulegte. Ich muss hierzu erwähnen, dass ich mich komischerweise immer mit solchen Freunden umgab, die eigentlich nicht dem von meinen Eltern gewünschten Umgang entsprachen. Diese seltsame Tatsache begleitete mich im Prinzip fast bis zum Ende meines 25. Lebensjahres. Das war zufälligerweise auch das Jahr, als ich meine jetzige Frau kennenlernte, also der Lebensabschnitt, der auf den folgte, wo man sich, wie man so sagt, schon die Hörner abgestoßen haben sollte. Sie behauptet heute noch, dass ich nur durch sie auf den rechten Weg geleitet worden bin, was sich allerdings nicht ganz mit meiner Meinung deckt.
Nun zu dem von mir neu entdeckten experimentellem Tatendrang, der sich während der Mittelschulzeit meiner bemächtigte. Der Auslöser dieses Umstandes war eigentlich mein Vater, obwohl er davon nichts ahnte. Wir hatten nämlich einen Garten in einer Kleingartenanlage, in der meine Eltern und natürlich in den jüngeren Jahren auch ich sehr viele Stunden verbrachten. Hierzu ist zu bemerken, dass meine Brüder und ich, auch als wir schon das jugendliche Alter hinter uns gelassen hatten, sehr oft spontan zu Tätigkeiten für diesen Garten herangezogen wurden, die uns nicht gerade die größte Freude bereiteten. Damit meine ich nicht nur die im Garten notwendigen allgemeinen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Obst und Erdbeeren ernten sowie Unkrautjäten usw., sondern größere Vorhaben, wo mein Vater unser Erscheinen als bedingungslose Pflicht ansah. Bei diesen Vorhaben galt keine Entschuldigung, unser Erscheinen war unabdingbare Pflicht. Ein Ereignis dieser Art möchte ich hier kurz einfügen.
Ich ging, als ich so ca. 18 Jahre alt war, unter anderem öfter immer mit Freunden nach Merseburg tanzen, das heißt, wir mussten mit der Straßenbahn dorthin fahren, denn das Tanzlokal lag ca.10 km von unserem Wohngebiet entfernt. Nebenbei bemerkt, war das damals gerade die Zeit, wo der Rock and Roll „in“ war. Einmal samstags brachte ich ein Mädel nach Hause, die in Merseburg wohnte, und wo bei den Verrichtungen, die das nach Hause bringen so allgemein nach sich zog, die Zeit dermaßen schnell verging, so dass ich die letzte Bahn nach Hause verpasste. Ich musste also ca. 10 km Fußweg bewältigen, um nach Hause zu kommen. Nun hatte mein Vater meinen mittleren Bruder und mich schon vorher in Kenntnis gesetzt, dass er am Sonntag früh gegen acht Uhr ein Pferdefuhrwerk mit einer Ladung Pferdemist in den Garten geliefert bekommen sollte. Diese Ladung wurde vor dem Eingang der Gartenanlage abgekippt und musste mit der Schubkarre so ca. 200 m bis zu unserem Garten transportiert werden. Nun kam ich bedingt durch den langen Fußweg von Merseburg total erschöpft so gegen sechs Uhr in der Früh zu Hause an, wollte mich gerade in unser Zimmer schleichen, um eventuell noch ein wenig zu schlafen, aber mein Vater vereitelte dieses Ansinnen von mir und mahnte zum Aufbruch in den Garten. Da gab es dann kein Wenn und Aber, sondern ich musste sofort nach einem kurzen Frühstück in den Garten und zwar zu Fuß, denn ich hatte damals noch kein Fahrrad, lediglich meine Brüder und meine Eltern hatten eines. Das war dann nochmals eine Strecke von ungefähr einer dreiviertel Stunde.
Im Zusammenhang mit unserem Garten muss auch erwähnt werden, dass in der Erntezeit der verschiedensten Früchte auch betreffs der Verarbeitungsphase derselben von uns Kindern ein zeitlich hohes Quantum an Mitwirkung gefordert wurde. Die beträchtlichen Mengen der geernteten Johannisbeeren und Stachelbeeren wurden nämlich in zweierlei Hinsicht weiterverarbeitet. Zum ersten wurden sie in Einweckgläsern eingekocht. Dazu mussten sie aber vorher von den Stielen befreit werden, was eine sehr zeitaufwendige Arbeit war, und sich über mehrere Tage hinzog. Danach wurden sie in Einweckgläser gefüllt unter Hinzugabe von Zucker und anschließend in einem speziellen Einwecktopf eingekocht. So ca. 50 Gläser lagerten bei uns immer im Keller.
Zum zweiten machte mein Vater aus den genannten Früchten jedes Jahr 120 Liter Wein mit den verschiedensten Fruchtmischungen. Dabei brauchte man zwar die Beeren nicht von ihren Stielen befreien, aber sie mussten dafür in einem fleischwolfartigen Gerät mit gehörigem Kraftaufwand so ausgequetscht werden, dass im Ergebnis zum Schluss der Fruchtsaft und eine trockene Maische übrigblieb. Damit die Fruchtsaftausbeute so hoch als möglich war, konnte man mittels einer Stellschraube den Pressdruck so erhöhen, dass man die Handkurbel des Gerätes gerade noch so drehen konnte. Mein Vater stellte den Pressdruck jedenfalls immer so hoch ein, dass sich zwei von uns auf den Küchentisch setzen mussten, damit sich dieser beim Drehen der Kurbel nicht von der Stelle bewegte. Die ganze Prozedur zog sich über mehrere Tage hin und im Ergebnis standen dann immer 5 bis 6 Gallonen von 10 bis 20 Litern Wein zum Gären auf unserer Küchenanrichte. Nach mehrmaligen Filterprozessen, die ich hier nicht näher beschreiben möchte, entstanden so ca. 150 Flaschen Wein, die im Keller in einem alten Küchenschrank gelagert wurden. Dazu wurden von meinem Vater mit der Schreibmaschine kleine Schildchen gefertigt, woraus die Weinzusammensetzung und das Abfülldatum ersichtlich waren. Zum Schluss wurde an die Innenseite der Tür noch eine Bestandstabelle angebracht, wo jede Entnahme unter Angabe des Entnahmedatums vermerkt wurde, so dass immer der Restbestand der jeweiligen Sorte ersichtlich war. Als ich jedoch im Jahr 1963, als ich mit 20 Jahren ein Studium an der Technischen Universität Dresden begann, ab und wann zu Besuch bei meinen Eltern war, entnahm ich immer heimlich zwei bis drei Flaschen aus den hinteren Reihen, um damit in Dresden mit meinen Freunden unseren Durst zu stillen. Damit brachte ich diese Bestandsführung tüchtig durcheinander, aber das fiel meinem Vater erst viele Monate später auf, als nämlich die hinteren Leerreihen zum Vorschein kamen.
Nun aber wieder zum Auslöser meines experimentellen Tatendranges. Im Garten selbst war ein ungefähr 30 m langer Fußweg, der die angelegten Beete in zwei Hälften teilte. Um diesen Weg unkrautfrei zu halten, hatte mein Vater in der Gartenlaube eine kleine Tonne mit Unkraut Ex, auch „Wegerein“ genannt, gelagert. Es war ein Herbizid auf der Basis von Natriumchlorat, welches einen hohen Anteil von gebundenem Sauerstoff aufwies. Es war von der Bestimmung her dafür gedacht, dass man es in einem bestimmten Verhältnis im Wasser auflöste, damit die Wege mit einer Gießkanne begoss und somit das Unkraut vernichtete. Durch meine Brüder lernte ich, dass man damit auch gezielte Sprengungen durchführen konnte, indem man ein wenig davon in eine verschließbare Flasche tat, Wasser hineinfüllte und die verschlossene Flasche unverzüglich ablegte. Durch die starke Sauerstoffentwicklung, die in der Flasche nun begann, wurde der Überdruck so groß, dass die Flasche schließlich mit einem ohrenbetäubenden Knall explodierte. Dadurch angeregt, begann ich nun selbst, mit dem für mich wunderbaren Mittel namens Unkraut Ex zu experimentieren und entdeckte dabei viele interessante Anwendungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass ich, inspiriert durch den experimentellen Teil des Chemieunterrichtes in der 10. Klasse, mir zu Hause schon eine gewisse Grundausstattung an Chemikalien einschließlich bestimmter notwendiger einfacher Laborgeräte zugelegt hatte. Dazu gehörten beispielsweise Reagenzgläser einschließlich der dazugehörigen Abstellständer, kleine Glastrichter und Glaskolben sowie auch bestimmte chemische Grundsubstanzen, wie zum Beispiel Schwefelblüte und Salpeter. Da ich nun finanziell nicht in der Lage war, mir diese Sachen offiziell zu besorgen, zweigte ich die von mir benötigten geringen Mengen nach und nach vom Laborbestand der Schule ab. Die Sachen lagerte ich in einer Kiste in meinem Schrank und meine Mutter, die ja in unserem Zimmer immer für Ordnung sorgte, machte sich über den Inhalt derselben keine beunruhigenden Gedanken.
Am Anfang meiner Experimente standen, wie gesagt, die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten von dem Mittel Unkraut Ex, die ich zusammen mit zwei Freunden bei uns zu Hause ausprobierte. Dazu tränkten wir zuerst Zeitungsbögen und manchmal auch von alten Diktatheften die Blätter mit einer Unkraut Ex Lösung und hängten diese zum Trocknen in unserem Bad auf. Das konnten wir immer dann machen, wenn meine Mutter am Montag und Dienstag in einer Lottoauswertungsstelle arbeiten war. Diese Blätter zerschnitten wir in eine für unseren Zweck handliche Größe und falteten sie ziehharmonikaförmig zusammen. Die beiden Enden legten wir dabei so übereinander, dass die ursprüngliche Länge auf ein Drittel schrumpfte. Dieses Bündel mit der nunmehr erreichten Abmessung von ca. 5cm x 2cm x 1cm umwickelten wir kräftig mit Kordelschnur, wobei eine mehrere cm lange Zündschnur mit eingebunden wurde. Ein paar von diesen selbstgebauten Knallkörpern warfen wir gleich mal aus unserem Kinderzimmerfenster in den Vorgarten und waren sehr positiv von der Wirkung beeindruckt. Nun wollten wir die Anwohner in anderen Wohnblocks ebenfalls mit unserer Erfindung beglücken und suchten uns zu diesem Zweck mehrgeschossige Wohnhäuser aus, wo die Haustür tagsüber nicht verschlossen war. Dort hängten wir dann einen Knallkörper an eine Wohnungstürklinke im Erdgeschoss, zündeten die Zündschnur an, betätigten den Klingelknopf und suchten schleunigst das Weite. Wenn die Bewohner dann die Tür öffneten, wurden sie nun von einem lauten Knall überrascht, da fast immer im selben Moment der Knallkörper explodierte. Im Gegensatz zu den Bewohnern fanden wir das immer sehr lustig.
In einem anderen Fall bastelten wir einmal eine sogenannte Rauchbombe, indem wir das Unkraut Ex in einem vorher ausprobierten Verhältnis mit Sägemehl mischten und alles in eine kleine Tüte schütteten, die dann angezündet werden musste. Um die Wirkung hautnah mitzuerleben, losten wir aus, in wessen Wohnhaus es ausprobiert werden sollte. Das Los bestimmte unglücklicherweise mich und die Sache sollte in den Abendstunden ausprobiert werden. Natürlich musste ich selbst zu dieser Zeit zu Hause sein, damit ich die Wirkung auch genau beschreiben konnte. Am besagten Abend war ich also zu Hause, während meine Kumpels die Tüte bei uns in den Abendstunden auf der Steintreppe zum Keller platzierten und sie entzündeten. Kurze Zeit später klingelte es an unserer Wohnungstür, denn das Treppenhaus war dicht vernebelt und man vermutete, dass ein Schornsteinbrand die Ursache war. Man klingelte deshalb bei uns, da mein Vater der von der Wohnungsgesellschaft bevollmächtigte sogenannte Hausvertrauensmann war und in dieser Eigenschaft auch den Schlüssel zum Wäscheboden verwahrte. Mein Vater schloss also die Tür zum Wäscheboden auf, aber dort war kein Rauch zu sehen. Nachdem sich im Treppenhaus mittlerweile der Rauch ein wenig verzogen hatte, fand er die Ursache desselben heraus. Irgendwie kam er dahinter, dass ich und meine zwei Freunde mit dieser Sache zu tun hatten, ich kann mich heute nicht mehr so genau an die Beweggründe seiner Vermutung erinnern. Jedenfalls suchte er mit mir an der Hand die Eltern der beiden anderen Schulkameraden auf und wertete den Vorfall aus. Bis auf eine gehörige Standpauke seitens meines Vaters hatte dieses Ereignis aber keine allzu schwerwiegenden disziplinarischen Folgen für mich.
Weil ich bei dem soeben geschilderten Ereignis die Funktion des Hausvertrauensmannes erwähnte, möchte ich dazu erläuternd noch erwähnen, dass seine Hauptaufgabe darin bestand, das Hausbuch zu führen. Hier musste sich jede Person eintragen, die länger als einen Tag bei jemand im Haus zu Besuch war und zwar unter Angabe der Wohnanschrift, Ausweis-Nr. und der geplanten Aufenthaltsdauer. Bei Besuch aus dem kapitalistischen Ausland, der BRD z.B., musste sogar die polizeiliche Meldestelle des jeweiligen Stadtbezirkes informiert werden.
Weil wir gerade beim Hausvertrauensmann sind, möchte ich ein weiteres Aufgabengebiet, was er innehatte, aufführen. Er musste unter anderem eine Anmeldeliste für die Nutzung der Waschküche führen, die auf der Rückseite des Wohngebäudes in einem separaten kellerähnlichen Raum lag, wo die sogenannte große Kochwäsche durchgeführt wurde, da es ja in der ersten Zeit nach dem Krieg noch keine Waschmaschinen gab. Kleinere Wäschestücke wurden in der Wohnung mittels eines Waschbretts, aber die größeren Teile, wie z.B. Bettwäsche oder ölverschmutzte Arbeitskleidung, wurden in der Waschküche gewaschen. Wer also dort Wäsche waschen wollte, musste sich in diese Liste eintragen, meistens wurde sie immer für zwei Tage benutzt. In der Waschküche befand sich ein Kohleofen mit einem Durchmesser von ca. einem Meter, indem ein ebenso großer Kessel eingelassen war. In diesem Kessel wurde die Wäsche gekocht, gespült und anschließend mit einer Handwäschemangel soweit ausgepresst, dass sie danach zum Trocknen aufgehängt werden konnte. Immer, wenn ich an den Tagen, wo wir große Wäsche hatten, nach der Schule nach Hause kam, hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, zwei bis drei Stunden die Kurbel der Handmangel zu drehen, was bei mir verständlicher Weise keine Freudensprünge verursachte.
Nun aber weiter mit einem positiven Nebenaspekt als Hausvertrauensmann, der nicht unerwähnt bleiben soll, nämlich, dass sich mein Vater als einziger hinter dem Haus vom Wäschetrocknungsplatz ein kleines Stück Garten von ca. 10 m x 5 m abgezweigt hatte, das von ihm für den Anbau von Gemüse genutzt wurde und wo auch ein Karnickelstall mit drei Kaninchen stand. Weitere 4 Kaninchen hatten wir noch in einem unserer zwei Keller, so dass wir Kinder des Öfteren mit einer Sichel bewaffnet den notwendigen Grasvorrat heranschaffen mussten, damit die Tiere schlachtreif heranwachsen konnten. Weil ich zwei sich in unserem Besitz befindliche Keller erwähnte, so war das auch wieder ein Privileg des Hausvertrauensmannes, denn alle anderen Hausbewohner hatten nur einen Keller. Der zweite Keller war unser Kohlenkeller, wo die Braunkohle, die Briketts und das Feuerholz gelagert wurde. Zur Braunkohle muss in diesem Zusammenhang gesagt werden, dass diese Kohle einen sehr geringen Heizwert hatte, aber Steinkohle gab es damals für die normalen Bürger nicht. Die Briketts wiederum hatten einen wesentlich höheren Heizwert und deshalb erfuhren sie bei der Lagerung auch eine besondere Würdigung. Sie wurden nämlich nicht nur in den Keller geschüttet, sondern wir mussten sie exakt in Reih und Glied nach einem von unserem Vater vorgegebenen System an der Wand stapeln.
So, nun aber zurück zu meinen Experimenten. Ich erwähnte bereits, dass ich durch den praktischen Anschauungsunterricht im Labor im Zusammenhang mit dem Chemieunterricht unter anderem auch in den Besitz von Schwefelblühte und Salpeter gelangt war. Durch tiefgründiges Literaturstudium, was mir in diesem Fall sogar große Freude bereitete, kam mir die Idee, dass man ja mal versuchen könnte, ein effektiveres Mittel, als das mit Unkraut Ex getränkte Papier, nämlich Schwarzpulver, herzustellen. Zu diesem Zweck mischte ich Schwefelblühte, Salpeter und klein zerstoßenes Kaliumpermanganat, in einem bestimmten Verhältnis, bis sich das von mir erwünschte Ergebnis einstellte. Kaliumpermanganat ist ein stark sauerstoffhaltiges Kristall, das damals in jedem vernünftigen Haushalt vorhanden war, denn es wurde bei Halsbeschwerden zum Gurgeln benutzt. Zum Ausprobieren nutzte ich einen kleinen gusseisernen Kanonenofen, der in unserem Kinderzimmer stand. Vor ihm war auf dem Holzfußboden ein ca. 50 cm x 50 cm großes Blech angebracht, damit eventuell herausfallende Glut nicht den Boden beschädigte. Dieses Blech verwendete ich, um die Mischungen so lange zu testen, bis sich das von mir gewünschte Ergebnis einstellte. Nun wollte ich natürlich auch das nunmehr vorliegende Gemisch in praktischer Anwendung testen. Dazu kam mir zugute, dass sich in meinem Besitz noch ein kleines zylindrisches Aluminiumfeuerzeug aus der aktiven Raucherzeit meines Vaters befand. Dieses hatte unten einen Schraubverschluss, war innen mit benzingetränkter Watte gefüllt, die einen Docht umhüllte, der oben aus einem Loch herausragte. Oben war noch ein kleines geriffeltes Rädchen angebracht, auf welches ein Feuerstein mit einer Feder gepresst wurde. Wenn man jetzt mittels Daumen das Rädchen kräftig drehte, entstand durch den Feuerstein ein Funke, der wiederum den benzingetränkten Docht entzündete. In diesem Feuerzeug ersetzte ich nun die Watte durch mein Schwarzpulver und den Docht durch eine mit der Unkraut EX-Lösung getränkten Zündschnur. Um die ganze Sache auszuprobieren, hatte ich den genialen Einfall, in den späten Abendstunden die Zündschnur anzuzünden und das Ding einfach auf unserer Straßenseite aus dem Fenster zu werfen. Da aber der von mir erwartete explosionsartige Knall ausblieb, machte ich mir keine großartigen Gedanken und ließ es so auf sich beruhen. Als ich am nächsten Tag aus der Schule kam, wurde ich zu meiner Verwunderung von meiner Mutter mit einer kräftigen Backpfeife empfangen, was sie ansonsten nie tat. Es hatte sich nämlich ergeben, dass das Feuerzeug am Vorabend im Erdgeschoss ein Fenster mitsamt Leinewandrollo durchschlagen hatte, wobei die Scheibe nicht zu Bruch ging, sondern lediglich ein Loch zu sehen war. Deswegen hatte ich am Vorabend auch nichts gehört. Das Feuerzeug hingegen lag in diesem Zimmer hinten unter dem Bett. Ich hatte in diesem Zusammenhang riesiges Glück, denn vor dem Fenster stand ein Schreibtisch, an dem ein Schüler aus einer höheren Klasse meiner Schule normalerweise seine Hausaufgaben machte. Als die Eltern desjenigen am nächsten Morgen die Bescherung sahen und unter dem Bett in einer dunklen Ecke etwas liegen sahen, was sie nicht so richtig identifizieren konnten, informierten sie die Polizei und im Ergebnis dessen wurde ich das erste Mal in meinem Leben mit einem negativen Artikel in der Tageszeitung erwähnt. Dass ich der Verursacher dieses Ereignisses war, ließ sich übrigens ganz leicht herausfinden, denn ein paar Tage vorher hatte ich ja zum Ausprobieren einige der schon anfangs erwähnten Knallkörper aus dem Unkraut Ex getränkten Papier aus dem Fenster geworfen, wo unglücklicherweise auch einer dabei war, den ich aus dem Papier eines alten Diktatheftes hergestellt hatte. Im Ergebnis der Untersuchungen durch die Polizei fand man ein Rest Papier eines explodierten Knallkörpers, wo die Unterschrift meines Vaters zu sehen war. Mit diesem Vorfall schließlich wurde meine eingangs erwähnte experimentelle Phase beendet, denn mein Vater nahm meine Kiste mit den mühsam zusammengetragenen Chemikalien und schmiss sie in den Aschenkübel vor dem Haus. Dass es dabei nicht auch noch zu ungeplanten explosiven Reaktionen gekommen ist, wundert mich heute noch.
Wenn ich nun meine weitere Entwicklung darlege, so gab es in meiner Jugendzeit aber nicht nur solche negativ geprägten Perioden, sondern den größten Teil meiner Freizeit verbrachte ich schon mit sinnvollen Beschäftigungen.
Gegen Ende der Mittelschulzeit bis fast zum Ende der Berufsausbildung zum Beispiel war ich ca. drei Jahre lang Mitglied in einem Kanusportverein. Mein mittlerer Bruder war dort schon länger sportlich engagiert und er überredete mich, auch dort einzutreten, damit ich meine Freizeit sinnvoll nutzte. Rückblickend war diese Zeit mit sehr viel schönen Erlebnissen verbunden. Wir waren dort eine Gemeinschaft von Sportlern, sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtes, wobei sich das Alter von 10 Jahren bis hin zu reiferen Erwachsenenjahrgängen bewegte. Unser Sportclub nannte sich Kanusport Post Halle, da die Deutsche Post der Trägerbetrieb war, das heißt, er wurde von diesem Betrieb finanziert. Das war in der ehemaligen DDR früher allgemein so üblich, dass Sport- und andere Vereine einen Trägerbetrieb hatten, der die finanzielle Grundlage bildete. Die Mitglieder selbst brauchten lediglich einen geringen Monatsbeitrag leisten, der aber fast gar keine finanzielle Belastung darstellte. Ebenso war es ganz normale Praxis, dass herausragende Sportler, die z.B. für den Nationalmannschaftskader nominiert wurden, teilweise bzw. ganz von der Arbeit freigestellt wurden, natürlich bei Weiterzahlung der Löhne und Gehälter. Nebenbei bemerkt, lag zur damaligen Zeit darin auch der Grund, dass in bestimmten Sportarten, wie z.B. Leichtathletik, Schwimmen, Eiskunstlauf usw., also in Sportarten, die im sogenannten kapitalistischem Ausland damals nicht als reine Profisportarten betrieben wurden, die DDR-Sportler bei internationalen Wettkämpfen immer vordere Plätze belegten. Denn, während die Sportler aus dem Kapitalistischen Ausland neben dem Training auch noch ihrem Beruf nachgehen mussten, konnten die Auswahlkader der DDR, unterstützt von einem ausgewählten Trainerteam, unbeschwert trainieren.
Mein Bruder selbst belegte während seiner aktiven Sportlaufbahn bei DDR-Meisterschaften einmal im Endlauf über 500 m im Einer-Kajak den 9. Platz, aber um zu den geförderten Kadern zu gehören, langte diese Platzierung nicht, dazu hätte er die Plätze 1 bis 3 belegen müssen. Er musste also immer ganz normal seiner beruflichen Tätigkeit nachgehen und die war in seinem Fall nicht die leichteste. Er war zu dieser Zeit nämlich Fernmeldebaumonteur, das waren diejenigen, die bei irgendwelchen Störungen mit sogenannten Steigeisen die hölzernen Telegraphenmasten erklimmen mussten, um die Fehlerquelle zu beheben.
Aber nun zurück zum Kanusportverein. Das Vereinsgelände lag an der Saale so ziemlich gegenüber einer von der Saale und einem Nebenarm der Saale umflossenen Insel, die sich Rabeninsel nannte. Sie konnte man zur damaligen Zeit mit einer manuell betriebenen Drahtseilfähre erreichen und war für die Einwohner von Halle ein beliebtes Ausflugsziel, da man dort schön spazieren gehen und zum Abschluss in einem Biergarten einkehren konnte.
Auf dem Vereinsgelände befand sich das Bootshaus mit den verschiedensten Kajaks und Kanadiern, sowie ein Vereinsgebäude mit einem großen Saal, der mit Tischen, Stühlen und einer Theke ausgestattet war. Von der Straße aus führte ein serpentinenartiger Weg hinunter, der mit einem metallenen Handlauf gesichert war. An dieser Stelle möchte ich ein für mich damals nicht gerade lustiges Ereignis zwischenfügen. In den ersten Berufsjahren meines Bruders hatte er von seiner Dienststelle ein Moped zur Verfügung gestellt bekommen. Mit diesem Moped fuhr er natürlich auch öfters zum Training. Nach dem Training musste er es immer die Serpentine hoch zur Straße schieben, da die Motorleistung des Mopeds zu schwach war, um mit ihm die Steigung zu bewältigen. Eines Tages hatte ich den grandiosen Einfall, zu testen, ob das Fahrzeug es schaffen würde, mich bis hoch zum Eingangspodest zu transportieren, da ich ja leichter als mein Bruder war. Da der Zündschlüssel immer steckte, war es für mich ein Leichtes, den ersten Gang einzulegen und loszufahren. Als mich das Gefährt problemlos bis hoch auf das Podest transportierte, war ich oben in einem dermaßen euphorischen Zustand, dass mir nicht mehr einfiel, wie man den Gang wieder herausbekam. So setzte ich meine Füße ab und versuchte, das Moped manuell anzuhalten, was mir natürlich nicht gelang, sondern es hielt erst an, als der Scheinwerfer desselben mit dem oberen Handlauf des Podestes kollidierte. Die Folge war natürlich ein total deformierter Scheinwerfer, der von meinem Bruder ersetzt werden musste.
Während der Kanusportzeit wurden in meinem Körper hinsichtlich Kraft und Ausdauer die Grundlagen gelegt, von denen ich heute noch profitiere. Wir trainierten dreimal in der Woche ca. 1 – 2 Stunden auf dem Wasser und anschließend zur Auflockerung, wie unser Trainer uns einzureden versuchte, absolvierten wir immer noch einen Dauerlauf von ca. einer dreiviertel Stunde. Dieser Dauerlauf war manchmal härter, als das eigentliche Training, denn er wurde wie ein Wettrennen durchgeführt und keiner wollte als letzter im Bootshaus ankommen. Im Winter, wenn es auf dem Wasser zu kalt war, ging es in einer Sporthalle mit Kraftsport der verschiedensten Art weiter. Alle zwei bis drei Wochen fuhren wir zu Wettkämpfen, die teilweise mehrere Autostunden von Halle entfernt lagen. Dazu beluden wir unseren Bootsanhänger mit den notwendigen Booten, der von einem LKW mit einer überdachten Ladefläche gezogen wurde, auf dem einfache Holzbänke längs zur Fahrtrichtung standen. Da die Regatten sich oft über zwei bis drei Tage erstreckten, dienten die Holzbänke für diejenigen, die über kein Zelt verfügten, gleichzeitig als Nachtlager. Die Übernachtung war also eine sehr spartanische Angelegenheit und am nächsten Morgen standen wir oftmals ganz schön steif und durchgefroren auf.
Ich selbst fuhr meistens Rennen im Einer- oder Zweierkajak, aber bis auf einige mittelmäßigen Platzierungen hatte ich eigentlich nie größere Erfolge zu verzeichnen. Ich möchte hier keine Ausrede gebrauchen, aber der Grund lag wahrscheinlich an der gleich am Anfang erwähnten Tatsache, dass ich von der Größe her relativ kurz geraten und damit für den Kanusport von vorn herein benachteiligt war.
Deshalb wechselte ich die Sportart und trat dem Box-Club Chemie Halle bei. Der Boxsport hatte mich schon immer interessiert, aber allein traute ich mich nicht in die Boxschule, sondern erst als ich einen Freund von mir überreden konnte, mit zu kommen. Diese Boxschule war übrigens im DDR-Maßstab sehr bekannt, da aus ihr schon mehrere DDR- Meister in den verschiedensten Gewichtsklassen hervor gegangen waren. Ich fing zuerst im Leichtgewicht an, das war die Gewichtsklasse, die bis 60 kg ging. Gegen Ende meiner Laufbahn, wenn man das als solche bezeichnen darf, denn sie erstreckte sich nur über ein reichliches Jahr, wechselte ich dann ins Halbweltergewicht, die bis 65 kg reichte. Mein Vater war von dieser von mir ausgewählten Sportart sehr begeistert, aber von den Ergebnissen, die ich erzielte, weniger. Er hatte nämlich während seiner Wehrmachtszeit auch im Soldatenverband geboxt und hatte laut seiner Aussage nie einen Kampf verloren. Ich weiß zwar nicht, wie viele Kämpfe er absolviert hatte, aber irgendwie glaubte ich ihm sogar. Er war tatsächlich von der Statur und sportlichen Veranlagung her betrachtet eine absolute Kämpfernatur. Als wir Kinder einmal mit ihm zusammen in der Küche waren, also ich als Jüngster war gerade dem Jugendalter entwachsen, wollte er einmal unsere Sprungkraft testen. Er sprang aus dem Stand mit einem Schlusssprung auf den Küchentisch und verlangte von uns das Gleiche. Es muss erwähnt werden, dass er damals bereits ein Alter von fast 45 Jahren erreicht hatte. Es kostete uns einige Überwindung, aber selbst ich bewältigte die Aufgabe, so dass unsere Ehre wieder gerettet war. Solche Vergleichswettkämpfe veranstaltete er oft mit uns, z.B. wer die meisten Liegestütze oder Klimmzüge schafft und vieles andere mehr.
Um auf meine Boxkarriere zurückzukommen, muss ich sagen, dass sie deshalb nur gut ein Jahr währte, da ich mit Beginn meines Studiums in Dresden davon abgekommen bin. Aber auf jeden Fall war für mich diese Zeit nicht umsonst, denn die dort erworbenen Grundtechniken konnte ich in meinem späteren Leben des Öfteren bei Auseinandersetzungen mit mir nicht gewogenen Menschen gebrauchen. Ich absolvierte während dieser Zeit einige Kämpfe, die man von der technischen Ausführung her als wüste Schlägereien unter Ringrichteraufsicht bezeichnen würde, da man in dieser kurzen Zeit das technisch saubere Boxen nicht erlernen konnte. Demzufolge lief ich auch öfters mit blau gefärbten Augen und geschwollenen Lippen umher.
Da ich jetzt einiges zum besseren Verständnis der Zusammenhänge vorweggenommen habe, muss ich nun aber zurückkehren in den Lebensabschnitt, der auf die Mittelschule folgte.
Mit Erlangen der Mittleren Reife, so nannte man damals den Abschluss der Mittelschule, wollte ich wieder den Beruf des Drehers erlernen, da dieser Berufswunsch noch immer in mir tief verwurzelt war. Wie schon einmal nach Abschluss der 8. Klasse hatte ich wieder einen unterzeichneten Lehrvertrag mit den Pumpenwerken Halle/Saale. Nun erfuhr mein Vater, dass es eine in der DDR völlig neu eingeführte Ausbildungsart gab, die sich Berufsausbildung mit Abitur nannte. Er überredete mich natürlich wieder, meinen Ausbildungsvertrag zugunsten der neueren Ausbildungsrichtung zu ändern. Die Lehrzeit verlängerte sich jetzt, bedingt durch die hinzukommenden Abiturfächer, von 2,5 auf 3 Jahre. Die Ausbildungszeit pro Woche setzte sich zusammen aus 2 Tagen Abiturausbildung, 2 Tagen praktische Berufsausbildung und 1,5 Tagen theoretische Berufsausbildung.
Den abiturbezogenen Teil absolvierte ich in einer Erweiterten Oberschule, EOS, so hieß damals jede zum Abitur führende höhere Schule in der DDR. Der berufsbezogene Ausbildungsabschnitt fand in der zum VEB Pumpenwerke Halle/Saale gehörenden Ausbildungswerkstatt mit angrenzender Berufsschule statt. Hier konnte man außer dem Beruf des Drehers noch viele andere Berufe erlernen, wie zum Beispiel Werkzeugmacher, Schlosser, Gießereifacharbeiter usw. In dieser Schule waren wir so ca. 200 Lehrlinge und für den praktischen Teil der Ausbildung hatten wir speziell für jeden Beruf ausgebildete Lehrmeister. Das gesamte System der Berufsausbildung konnte man an sich nur als vorbildlich beschreiben, es wurde nur immer wieder getrübt durch die im Sinne des sozialistischen Staates vorgeschriebene politische Beeinflussung der Auszubildenden. Das betraf übrigens nicht nur die Berufsschule, sondern diese von der SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschland, vorgegebene laufende politische Beeinflussung begann mit Eintritt in den Kindergarten und wurde im gesamten weiteren Ausbildungsweg bis zum Eintritt in das Rentenalter praktiziert.
Mit Beginn der Grundschule musste man zum Beispiel in die Pionierorganisation, Junge Pioniere, eintreten. Hierfür wurde man mit einer speziellen Kleidung ausgestattet, die natürlich von den Eltern zu bezahlen war. Das war ein weißes Hemd mit einem handtellergroßen Pionierzeichen am Ärmel, wozu man sich bis zur vierten Schulklasse ein blaues Halstuch und ab der fünften bis zur achten Klasse ein rotes Halstuch umbinden musste. Ab der 9. Klasse trat man gewöhnlich der FDJ, Freie Deutsche Jugend, bei, nun bekam man ein blaues Hemd mit einem handtellergroßem FDJ-Aufnäher am Ärmel. Diese Kleidungstücke musste man immer zu bestimmten politische Feiertagen, wie zum Beispiel am 1. Mai, Internationaler Kampftag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus, oder am 8. Mai, Tag der Befreiung, tragen. Natürlich gab es auch Eltern, die ihren Kindern diese Mitgliedschaft untersagten, aber für diese Kinder war der weitere Bildungsweg nach Abschluss der Mittelschule beendet, bis dahin war ja der Schulbesuch Pflicht. Selbst den gewünschten Beruf konnte man mit solch einer staatsfeindlichen Vorgeschichte oftmals nicht erlernen.
Im selben Zusammenhang stand auch eine wichtige Entscheidung, die nach Abschluss der der 7. Klasse von den Eltern getroffen werden musste und die gewaltiges politisches Konfliktpotenzial in sich barg. Hier ging es nämlich darum, ob man außerschulisch am Konfirmationsunterricht teilnahm, was von den DDR-Oberen natürlich nicht gewünscht wurde, oder ob man den sozialistisch geprägten Jugendweiheunterricht besuchte, der mit einer Jugendweihefeier endete, wo man eine Urkunde und ein Buch überreicht bekam. Mein Vater entschied sich natürlich stellvertretend für mich für die Konfirmation. Dadurch stand ich in politischer Hinsicht in der Schule schon unter kritischer Beobachtung, aber mich selbst interessierte das weniger, da ich für die Erfassung der damit verbundenen Zusammenhänge viel zu jung war. Der Konfirmationsunterricht fand generell vor Schulbeginn im Gemeindehaus der Kirche statt und wir benutzten den Hin- und Rückweg immer für Klingelpartien an allen Häusern, die auf der Wegstrecke lagen. Klingelpartie bedeutet nichts weiter, als dass man an jedem Haus alle Klingelknöpfe drückte, was die Hausbewohner wahrscheinlich nicht gerade sehr erfreute. Jedenfalls wurde ich nach einem Jahr Konfirmationsunterricht im Alter von 14 Jahren konfirmiert, wobei dieser Tag feierlich gewürdigt wurde. Ich musste sogar einen Anzug samt weißem Hemd und Binder anziehen, was mir eigentlich nicht sehr behagte. Dazu kommt natürlich noch, dass mein Anzug ein von meiner Mutter aufgearbeitetes Kleidungsstück war, das zuvor schon von meinen beiden Brüdern getragen wurde. Aber so war das nun mal damals. Zur Feier selbst war die gesamte Verwandtschaft anwesend und zum Mittagessen gab es immer Kaninchenbraten aus unserem eigenen Bestand. Die Kaninchen schlachtete mein Vater selbst, indem er sie mit einem gezielten Handkantenschlag vom Leben in den Tod beförderte, anschließend das Fell fachmännisch abzog und das Tier bratfertig ausnahm. Das Fell selbst wurde auf einer eigens dafür angefertigten Holzvorrichtung gespannt und nach einer gewissen Trocknungszeit für 50 Pfennige an einen Händler verkauft.
Nach der kleinen Abschweifung nun weiter mit der Berufsschulzeit.
In dieser Berufsschule war es für einen dem Sozialismus treu ergebenen Bürger fast pathologische Pflicht, dass er der Gesellschaft für Sport und Technik, GST, beitrat. Mit Sport und Technik hatte dies weniger zu tun, sondern der tiefere Sinn lag mehr auf einer tiefgründigen vormilitärischen Ausbildung. Na ja gut, das Auseinandernehmen und anschließende wieder Zusammenbauen eines Gewehres hat schon etwas mit Technik zu tun, aber hauptsächlich wurde dort unter Absingen von Sozialistischem Liedgut und dabei im Gleichschritt marschieren das Kriegshandwerk geübt. Natürlich immer nur mit dem Ziel, den Sozialismus vor den aggressiven Machenschaften des kapitalistischen Lagers verteidigen zu können. Aber ich möchte nicht nur immer das Negative aufführen, sondern die Mitgliedschaft in der GST hatte auch einen positiven Aspekt. Man konnte dort nämlich den Motorradführerschein machen und zwar völlig umsonst, also ohne etwas zu bezahlen. Das war schon nicht zu verachten, denn es handelte sich hier um Beträge, die so bei mehreren hundert Mark lagen, wenn man den Schein in einer offiziellen Fahrschule machte. Mein Vater wiederum war jedoch der Meinung, dass ich dort nicht hingehöre und verbot mir, dort einzutreten. Er hatte dabei aber nicht in Betracht gezogen, dass diese Entscheidung mir politisch negativ angelastet werden würde, da ich ja damit den sozialistischen Klassenstandpunkt unseres Arbeiter- und Bauernstaates auf das tiefste verletzte. Ich befand mich aber nicht ganz allein in dieser Situation, denn ein Freund von mir aus meiner Lehrlingsgruppe weigerte sich auch, dort mitzumachen. Nun gab es in unserer Berufsschule ein sogenanntes schwarzes Brett, wo neben irgendwelchen Mitteilungen schulischer Art auch Verfehlungen von Auszubildenden für jeden sichtbar angezeigt wurden. Auf dieser Tafel wurden wir beide nun auch verewigt als negatives Beispiel für Jugendliche, die nicht bereit waren, die Errungenschaften unseres sozialistischen Staates zu würdigen und zu verteidigen.
Aber diese Zeit war auch geprägt von allerlei Ereignissen, an die ich mich gern erinnere und die in gewisser Hinsicht für die Entwicklung meiner Persönlichkeit prägend waren. Beispielsweise kann ich, ohne zu übertreiben, von mir behaupten, dass in mir gewisse musikalische Talente schlummern, die jedoch in meinem Elternhaus nie erkannt und somit auch nie gefördert wurden. Mein Vater schenkte uns Kindern zwar einmal zu Weihnachten ein ziemlich großes Schifferklavier, aber den dazugehörigen Unterricht für uns zu organisieren und vor allem zu bezahlen, fand er nicht vonnöten. Weil wir als Kinder nicht die notwendige Eigendisziplin aufbrachten, um durch tägliches Üben das Instrument beherrschen zu lernen, lag es demzufolge ungenutzt in unserem Kinderzimmer und war gelinde gesagt eine Fehlinvestition. Für mich selbst war das Akkordeon schon von der Größe her kein Thema, denn ich war damals gerade mal acht oder neun Jahre alt. Hätte ich es mir umgelegt, wäre ich unweigerlich nach vorn auf den Boden gezogen worden.
Meine meiner Meinung nach musikalischen Fähigkeiten konnte ich aber in der Berufsschule anderweitig zum Tragen bringen. Wir hatten dort nämlich einen großen Kultursaal, der normalerweise für Versammlungen genutzt wurde, aber in dem auch monatlich einmal Tanzveranstaltungen für uns Lehrlinge stattfanden. Dazu wurden Stühle und Tische so angeordnet, dass in der Mitte Platz für eine Tanzfläche entstand und die erhöhte Bühne wurde für die Tanzkapelle genutzt. Die Band wiederum setzte sich aus unseren Lehrlingen zusammen, die mehrmals im Monat zusammen probten. Hier muss wieder erwähnt werden, dass man nicht einfach spielen konnte, was man wollte, sondern erstens mussten 60 % der Titel aus dem sozialistischen Lager sein und der Rest durfte aus den kapitalistischen Ländern kommen. Zum Zweiten mussten diese Stücke getrennt nach den 40 % bzw. 60 % aufgelistet und im jeweiligen Stadtbezirk in der Abteilung Kultur zur Genehmigung eingereicht werden. Dabei kam es immer wieder vor, dass Lieder aus dem sogenannten Westen von der Liste gestrichen wurden, weil sie nicht der sozialistischen Ethik und Moral entsprachen. Mit dem nunmehr abgesegneten Dokument konnte der Tanzabend nun durchgeführt werden.
An einem dieser Abende ergab es sich anlässlich einer größeren Pause, dass ich mich dazu berufen fühlte, die Bühne zu erklimmen, um auf dem Schlagzeug ein paar Trommelwirbel erklingen zu lassen.
Ich hatte dies an und für sich nur aus lauter Übermut getan und mir nichts Besonderes dabei gedacht. Seltsamerweise fanden die Bandmitglieder das dabei von mir an den Tag gelegte Rhythmusgefühl so bemerkenswert, dass der Bandleiter mich nach der Veranstaltung beiseite nahm und mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, mal an einer Übungseinheit teilzunehmen. Ich muss hierbei erwähnen, dass sie mit ihrem Schlagzeuger nicht so ganz zufrieden waren, weil er eben das erforderliche Rhythmusgefühl nicht hatte, sondern immer mit den Takten ein wenig vorneweg war. Um es klar auszusprechen, sie wollten den Schlagzeuger eigentlich so schnell wie möglich los werden. Es wurde vereinbart, dass wir beide zusammen mit der Band ein Probetraining absolvieren und danach sollte unter Hinzuziehung des kulturverantwortlichen Leiters der Berufsschule abgestimmt werden, wer weiterhin am Schlagzeug sitzen durfte. Da ihre Sympathien aber nun mal mehr bei mir lagen, übten sie heimlich vorher mit mir einige Stücke ein, die anlässlich des Vergleiches gespielt werden sollten. Na ja, so war es für mich ein Leichtes, den armen Burschen aus seiner Position zu verdrängen und ab sofort in der Band als Schlagzeuger mitzuwirken.
Ich kann mich noch genau an meine ersten offiziellen Auftritte bei den Lehrlingsveranstaltungen erinnern, denn da stand mir mehr als einmal der Angstschweiß auf der Stirn. Bei den Übungsabenden mit der Band wurde man ja durch nichts abgelenkt, sondern man konnte sich ausschließlich auf die Bewegungsabläufe der verschiedenen einbezogenen Körperteile, die auf das Gerät einwirkten, konzentrieren. Wer schon einmal bei einer Musikveranstaltung einem Schlagzeuger zugesehen hat, weiß, dass er nicht nur mit allen vier ihm zur Verfügung stehenden Gliedmaßen verschiedene Geräte bedienen, sondern auch sehr oft mit den Händen völlig unterschiedliche Bewegungsabläufe zu absolvieren hatte. Und all die dabei fabrizierten Klänge müssen sich harmonisch in das von der übrigen Band gespielte Stück einfügen, wobei die Taktvorgabe die wichtigste Voraussetzung für das Abspielen eines Stückes darstellt.
Bei den ersten Tanzabenden, wo ich mich noch sehr stark auf meine Instrumente konzentrieren musste, da mir die Bewegungsabläufe noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen waren, durfte mich keiner meiner Freunde, die mit ihrer Partnerin in meiner Nähe vorbeitanzten, ansprechen. Da kam es schon öfters vor, dass ich aus dem Takt kam, was meine Bandmitglieder nicht so prickelnd fanden. Mit der Zeit legte sich die ganze Aufregung und ich brauchte nicht zwischendurch das vor Angst schweißnasse Hemd zu wechseln.
Mit Erlangung des Facharbeiterabschlusses endete auch meine sogenannte musikalische Laufbahn, da ich anschließend vor dem Beginn eines Studiums an der TU Dresden für ein Jahr als Dreher im Dreischichtbetrieb meine Brötchen verdienen musste und sich andere Interessengebiete auftaten.
Die Zeit der Berufsausbildung war jedoch nicht nur in musikalischer Hinsicht bedeutsam für mich, sondern bedingt durch die in dieser Zeit praktizierte laufende politische Beeinflussung wurde bei mir eine immer tiefersitzende Abneigung gegen unseren sogenannten sozialistischen Staat geweckt. Irgendwie fühlte ich mich sogar dazu berufen, etwas gegen die von unserem Staat durchgeführten Drangsalierungen des Volkes zu unternehmen.
In diesem Zusammenhang soll erwähnt sein, dass in mir nicht nur musikalische, sondern auch poetische Talente schlummerten. Ein lyrisches Werk, wie ich es nennen möchte, habe ich sogar einmal an die Redaktion eines größeren Tagesblattes geschickt, um damit eventuell den Grundstein für eine finanziell abgesicherte poetische Laufbahn zu legen. Leider aber hatten die Verantwortlichen mein Talent nicht erkannt, sondern ich bekam mein Werk mit der Bemerkung zurückgeschickt, dass dem Gedicht der tiefere Sinn fehlt und ich sollte mir als Beispiel doch bitte die Werke der Herren Becher, Brecht und Weinert zu Gemüte ziehen. Um dem Leser selbst ein Urteil zu ermöglichen, möchte ich mein poetisches Werk an dieser Stelle wiedergeben.
Heidespaziergang
Ich ging am frühen Morgen in die Heide und lauschte in den Wald hinein
Die Vöglein sangen fröhlich ihre Weise und luden mich zum Träumen ein
Ich setzte mich auf einen Baumstumpf und dachte über vieles nach
Worüber in vergangenen Zeiten ich mir schon oft den Kopf zerbrach
Doch die Natur mit ihrem bunten Treiben riss mich sanft aus meinen Träumen raus
Und ich nahm das viele Schöne wieder tief in meinem Herzen auf.
Dieses poetische Talent wollte ich nunmehr auch anwenden, um mit politischen Versen die Bevölkerung zu Aktionen gegen den sozialistischen Willkürstaat aufzurufen. Hierzu verfasste ich einige Vierzeiler, die ich vervielfältigte und in den Abendstunden an den verschiedensten Stellen in unserem Stadtgebiet auslegte. Die Vervielfältigung wiederum wurde mir durch einen Ormigraum in der Berufsschule ermöglicht, in dem sonst die Schüler im Auftrag der Lehrkräfte bestimmte Lehrunterlagen kopierten. Erläuternd soll erwähnt werden, dass der Ormigdruck ein Spiritus-Umdruckverfahren ist, wo eine seitenverkehrte Kopie auf einem sogenannten Ormigblatt hergestellt wurde, mit dem man dann je nach Qualität zwischen 30 bis 100 Abzüge herstellen konnte.
Auf dieser Basis nunmehr stellte ich heimlich einige hundert Flugblätter mit den gegen den Staat gerichteten Versen her und verteilte sie im Wohngebiet in Telefonzellen und Hauseingängen. Falls sich jemand wundern sollte, warum ich gerade die Telefonzellen als Auslageort auswählte, so soll angemerkt sein, dass dieser Ort damals sehr stark frequentiert war, da in der DDR zu dieser Zeit nur ganz wenige Bürger ein eigenes Telefon besaßen.
Mich wundert es aus heutiger Sicht immer noch, wie sorglos ich damals die Sache durchgezogen habe, denn wenn man mich dabei erwischt hätte, wäre mein Leben garantiert anders verlaufen. Aber wie man sieht, ist ja alles gut gegangen. Lediglich mit meinem Vater hatte ich diesbezüglich wieder Differenzen, denn irgendwann bekam er mal meine politische Gedichtsammlung in die Hände und vernichtete sie, was ich aus heutiger Sicht sogar verstehen kann.
Ich meine, dass ich den Zeitabschnitt der Berufsausbildung mit Abitur damit hinreichend geschildert habe, denn weitere tiefgreifende Ereignisse fanden nicht mehr statt. Im Alter von 19 Jahren erhielt ich im August 1962 das Abschlusszeugnis der Berufsausbildung mit Abitur und damit begann ein völlig neuer Lebensabschnitt für mich.