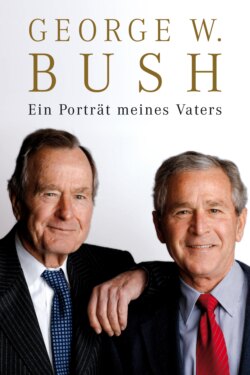Читать книгу Ein Porträt meines Vaters - George W. Bush - Страница 10
ОглавлениеWESTWÄRTS
EINST FRAGTE ICH MEINE MUTTER, wie sie und mein Vater es fertiggebracht hätten, beinahe 70 Jahre lang eine glückliche Ehe zu führen. »Wir beide waren stets bereit, dem anderen drei Viertel des Weges entgegenzukommen«, sagte sie. Sie meinte damit, dass ihnen ihre Ehe wichtiger war, als sie sich selbst es waren. Sie waren willens, ihre eigenen Bedürfnisse hinter denen des jeweils anderen hintanzustellen.
Mein ganzes Leben lang legten Mutter und Dad diese selbstlose Liebe an den Tag. Immerhin durchquerte sie ja für ihn auch drei Viertel des Landes …
Die Entscheidung, von New Haven in Connecticut, wo mein Vater 1948 seinen Abschluss in Yale machte, in den Westen von Texas zu übersiedeln, sollte das Leben meiner Eltern maßgeblich beeinflussen. Indem er sich mit seinem roten Studebaker von den Möglichkeiten, die ihn an der Wall Street erwartet hätten, räumlich entfernte, ging George H.W. Bush seinen ganz eigenen, unkonventionellen Weg, ließ sich auf ein Risiko ein und folgte seinen nach Unabhängigkeit strebenden Instinkten. Meine Eltern lernten, dass sie auch in einem schwierigen Klima und unter fremden Menschen überleben und sogar aufblühen konnten. Sie ließen sich auf ein Geschäft ein, das für seine Aufs und Abs berüchtigt war, und legten das Fundament für eine starke Ehe – eine dauerhafte, lebenslange Partnerschaft, die profunde Prüfungen überstand, viel Freude bereitete und ein inspirierendes Beispiel für mich und meine Geschwister abgab. Und sie machten mir noch ein weiteres Geschenk: Mein ganzes Leben war ich George und Barbara Bush dankbar dafür, dass sie mich im Westen von Texas aufzogen.
IM NOVEMBER 1945 legte George H.W. Bush also seine Uniform ab und schrieb sich in Yale ein. Wie bei vielen Vertretern seiner Generation hatte das College aufgrund des Krieges warten müssen. Viele der neuen Studenten waren bereits Eltern, und ab dem 6. Juli 1946, als ich im Grace-New Haven Hospital zur Welt kam, gehörten auch Mutter und Dad dazu. Sie nannten mich George Walker Bush, nach meinem Vater und meinem Urgroßvater – aber unter Verzicht auf das »Herbert«. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Mutter einst fragte, warum ich denn kein lupenreiner »Junior« sei. »Sohn, die meisten Formulare haben nicht genug Platz für fünf Namen«, meinte sie. Ich ließ mir mit meiner Niederkunft jedenfalls Zeit und betrat diese Welt erst, nachdem meine Großmutter Dorothy Walker Bush meiner Mutter eine ordentliche Dosis Rizinusöl verabreicht hatte – was somit auch mein erster Kontakt mit dem Ölgeschäft war.
Mutter und Dad lebten weniger als eine Stunde von seinen Eltern in Greenwich entfernt, doch muss sich New Haven wie Welten entfernt von Prescott und Dorothy Bushs Haus in der Grove Lane angefühlt haben. Meine Eltern mieteten zuerst ein winziges Apartment in der Chapel Street. Außerdem hatten sie auch noch einen schwarzen Pudel, der auf den Namen Turbo hörte. Als ich schließlich geboren wurde, mussten sie jedoch ausziehen, da der Vermieter zwar Hunde, allerdings keine Babys gestattete. Sie fanden daraufhin eine Bleibe in der Edwards Street. Dieses Mal erlaubte der Besitzer seinen Mietern, ein Baby zu haben, doch war es nun der Hund, der unerwünscht war. Zum Glück fand Turbo ein neues Zuhause in der Grove Lane. In ihrem letzten Jahr in New Haven zogen meine Eltern in ein großes Haus in der Hillhouse Avenue, das von ungefähr einem Dutzend Familien bewohnt wurde. Mutter lacht immer noch darüber, wie sie meine Stoffwindeln in Sichtweite des Yale-Präsidenten, der nebenan wohnte, auf die Wäscheleine hängte.
Meine Eltern genossen ihre Jahre in New Haven. Jeglicher College-Stress verblasste neben den Erfahrungen, die mein Vater im Krieg hatte durchleben müssen. Das heißt aber nicht, dass er die Sache auf die leichte Schulter genommen hätte. Wie üblich nahm George Bush die Aufgabe mit vollem Einsatz in Angriff. Er arbeitete hart in den Unterrichtsräumen, wurde mit der Aufnahme in die akademische Ehrengesellschaft Phi Beta Kappa ausgezeichnet und schaffte innerhalb von zweieinhalb Jahren seinen Abschluss. Außerdem war er Mitglied der Studentenverbindung Delta Kappa Epsilon. Er war sehr kontaktfreudig und gewann viele neue Freunde. An ihrem ersten Thanksgiving in Yale fand Dad heraus, dass einige seiner Kameraden nicht nach Hause reisen konnten, um mit ihren Familien zu feiern, weshalb er gleich zehn von ihnen zu uns zum traditionellen Mahl einlud. Mutter erinnerte ihn zwar daran, dass wir keinen Speisesaal zur Verfügung hätten, aber das war egal. Meine Eltern und ihre Freunde verteilten sich stattdessen auf die Sofas und auf dem Boden und ließen sich den ersten Thanksgiving-Truthahn, den meine Mutter je zubereitete, schmecken. Dieses spontane Festmahl sollte indes bloß eine Vorschau sein auf das, was alles noch folgen sollte. Über die Jahre hinweg standen die vielen Eigenheime meiner Eltern für Freunde und Familie stets offen. Obwohl sie sich mitunter ein wenig über den nie abreißenden Strom an Gästen mokierte, war Mutter dennoch immer eine freundliche Gastgeberin.
Mein Dad schloss nicht nur Freundschaften, er pflegte sie auch. Noch Jahrzehnte später stand er im regelmäßigen Kontakt mit seinen alten College-Freunden. Einer dieser alten Kommilitonen hieß Lud Ashley und stammte aus Toledo, Ohio. Wie Dad ging auch Lud irgendwann in die Politik. Im Gegensatz zu meinem Vater war er allerdings ein liberal ausgerichteter Demokrat. In Washington standen sie sich bei einigen der hitzigsten Diskussionen ihrer Zeit gegenüber. Jedoch wirkte sich das nie negativ auf ihre Beziehung aus. Sie verbrachten immer noch Zeit miteinander und amüsierten sich zusammen wie seinerzeit in den Neunzehnvierzigern, als sie in Yale studierten. Wer einmal ein Freund von George Bush war, der genoss diesen Status sein Leben lang.
Die Lieblingsbeschäftigung meines Dads, der er im Rahmen seines Studiums nachgehen konnte, fand jeweils an Frühlingsnachmittagen auf dem Yale Field statt. Wie er später formulierte, belegte er als Hauptfach Wirtschaft und als Nebenfach Baseball. Er war Kapitän seines Teams und spielte so wie schon sein Vater vor ihm auf der ersten Base. Mutter und ich besuchten fast alle seine Heimspiele. Während ihrer Schwangerschaft saß sie in einem extrabreiten Sitz, der für den ehemaligen Rechtswissenschaftsprofessor William Howard Taft entworfen worden war. Sie liebte es, selbst Statistiken zu führen, und es gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen als kleiner Junge, diese tabellarischen Spielberichte von den Matches meines Vaters zu studieren. Die Yale-Mannschaft erreichte 1947 und 1948 die College World Series, die Endspiele um die Meisterschaft der College-Auswahlen. Im ersten Jahr unterlagen sie dabei der University of California-Berkeley und im Jahr darauf dem Team der University of Southern California, den Trojans. (Für echte Baseball-Feinschmecker: die Cal Bears, so der Name des gegnerischen Teams von 1947, wurden von Jackie Jensen angeführt, der 1958 zum wertvollsten Spieler der American League gewählt wurde, und die USC Trojans wurden im Jahr darauf, 1948, vom legendären Rod Dedeaux betreut.)
Der spektakulärste Moment meines Dads als Baseballspieler am College trug sich auf dem Wurfhügel zu. Dort traf er nämlich im Frühling seines Abschlussjahres auf Baseball-Ikone Babe Ruth, der ihm ein signiertes Exemplar seiner Autobiografie für die Bibliothek von Yale überreichte. Einem Fotografen gelang dabei ein Schnappschuss mit Symbolcharakter: Ein großer Mann, der auf das Ende seines Lebens zusteuerte, traf auf einen anderen, dessen Leben gerade erst so richtig losging.
Es ist schwer vorstellbar, wie es meinem Vater gelang, alles unter einen Hut zu bringen – er war ein ausgezeichneter Student, ein herausragender Athlet, ein Mann mit einem großen Freundeskreis sowie ein hingebungsvoller Ehemann und Vater. Meine Mutter formulierte es so: »Er war ein harter Arbeiter.« Das stimmt. George Bush verschwendete keine Zeit und füllte jede Minute des Tages mit Aktivitäten aus.
OBWOHL DER WICHTIGSTE Augenblick meines Vaters auf dem Spielfeld die Gesellschaft Babe Ruths einschloss, hieß sein wahrer Baseball-Held Lou Gehrig. Dad bewunderte sein Geschick, seine Beständigkeit und seine Bescheidenheit und träumte davon, in Gehrigs Fußstapfen treten zu können und in der Major League als Profi zu spielen. Nach einem Spiel für das Team von Yale streckten tatsächlich ein paar interessierte Spielerbeobachter ihre Fühler nach ihm aus. Mein Dad war ein exzellenter Feldspieler, jedoch verhinderte seine Schlagstatistik schließlich eine Karriere bei den Profis. Sein Trainer Ethan Allen brachte es auf den Punkt: »Gutes Feldspiel, schlechter Schläger.«
Eine andere Option schlug er wiederum selbst aus. Im Juni 1948 erhielt er einen überraschenden Brief von Gerry Bemiss, einem Freund aus Kindertagen. Offenkundig war ihm zu Ohren gekommen, dass mein Vater das Priesteramt anstrebe. Obwohl mein Vater seit jeher ein religiöser Mann gewesen war, schwebte ihm jedoch keine Laufbahn in den Reihen des Klerus vor. »Nie habe ich auch nur daran gedacht, ein ›Mann des Tuches‹ zu werden – allerhöchstens einer des Tisch- oder Lendentuches«, schrieb er.
Eine Möglichkeit wäre sicher gewesen, für seinen Onkel George Herbert Walker Jr., genannt Herbie, zu arbeiten. Herbie vergötterte meinen Vater. In späteren Jahren beschlich mich das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit, die er meinem Vater zuteilwerden ließ, auf Kosten der Zuneigung ging, die er seinen eigenen Söhnen hätte entgegenbringen sollen. Auf jeden Fall versicherte er ihm, dass er ihm eine verlockende Stelle in seiner Wall-Street-Firma reserviert habe. Ebenso machte auch Brown Brothers Harriman, die Firma Prescott Bushs, meinem Vater ein ernsthaftes Angebot.
Es war keine große Überraschung, dass George H.W. Bush ein gefragter Mann war. Wenige konnten sich gleichzeitig mit den drei Attributen Kriegsheld, Phi Beta Kappa und Kapitän des Baseballteams schmücken. Dad wog die Angebote von der Wall Street mit gebührendem Ernst ab, schließlich respektierte er die Arbeit seines Vaters und hätte auch gerne seinen Wirtschaftsabschluss beruflich genutzt. Außerdem wäre ein Job in der Finanzwelt lukrativ genug gewesen, um Mutter und mich mit einem soliden Einkommen versorgen zu können.
Doch irgendetwas veranlasste ihn letztlich dazu, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Wall Street stand für eine konventionelle Karriere. Aber nachdem er Bomber geflogen, auf Flugzeugträgern gelandet und dabei mit Menschen aus allen Schichten gearbeitet hatte, erschien die Aussicht darauf, jeden Tag mit dem Zug zwischen Connecticut und einem Schreibtischjob in New York hin und her zu pendeln, nicht sonderlich reizvoll. Statt mit Wertpapieren zu handeln, wollte er lieber etwas aufbauen. Er gedachte etwas anderes mit seinem Leben anzustellen und scheute nicht davor zurück, ein Risiko einzugehen.
Dad wollte außerdem beweisen, dass er nicht auf die Hilfe seiner Familie angewiesen war. Dieses Streben nach Unabhängigkeit lag ihm im Blut. Schon sein Ururgroßvater, Obadiah Bush, war mit den sogenannten Forty-Niners während des Goldrausches westwärts gezogen. Auch sein Großvater G.H. Walker hatte sich vom Familiengeschäft in St. Louis losgesagt, um in New York sein Glück zu suchen. Und sein Vater, Prescott Bush, war stolz darauf, dass er es ohne einen Cent seiner Eltern geschafft hatte.
Trotzdem stellte sich nach wie vor die Frage, was er konkret tun sollte. Meine Eltern hatten das Buch The Farm von Louis Bromfield gelesen, in dem dieser die klassische amerikanische Erfahrung, sein eigenes Land zu bestellen, beschrieb. Sie flirteten eine Zeitlang mit dieser Idee, entschieden sich jedoch letztlich dagegen. Ich kann mir übrigens meine Mutter richtig gut beim Melken einer Kuh vorstellen …
Im Februar 1948 starb S.P. Bush, Dads Großvater, und mein Vater flog mit der Familie nach Columbus zum Begräbnis. Auf dem Weg dorthin unterhielt er sich mit Neil Mallon, einem engen Freund Prescott Bushs aus gemeinsamen Yale-Zeiten. Neil besaß eine Firma namens Dresser Industries, die Bohrausrüstung und sonstiges Zubehör an Öl fördernde Unternehmen verkaufte. Neil schlug Dad jedenfalls vor, in Erwägung zu ziehen, für ihn zu arbeiten: Er könne dort von Grund auf lernen, wie ein Betrieb funktioniere, wie man das Inventar verwalte, Verkäufe tätige und Produkte auf den Markt bringe. Er könne dort aus nächster Nähe eine faszinierende Industrie, die Ölbranche, erleben. Es gab nur einen Haken an der Sache: Er müsse vor Ort an den Ölfeldern des Permian Basin leben – dabei handelte es sich um eine isolierte, staubige, glühend heiße Ecke im Westen von Texas, die in erster Linie von Ranchern und Ölarbeitern bewohnt wurde. Dort war es, wo das Öl sprudelte.
Diese Chance weckte das Interesse meines Dads. Er hatte Artikel zum texanischen Ölboom gelesen und schillernde Persönlichkeiten wie H.L. Hunt und Clint Murchison verdienten sich dort eine goldene Nase. Er hatte seinen kurzen Aufenthalt in Corpus Christi während der Pilotenausbildung genossen. Und eines war auch sicher: Er wäre dort ganz auf sich gestellt. Prescott Bush und G.H. Walker warfen zwar lange Schatten, aber nicht bis nach Odessa, Texas.
Kurze Zeit nach seinem Abschluss bot Neil Dad einen Job bei einem Tochterunternehmen von Dresser namens Ideco an. Ideco stand dabei für International Derrick and Equipment Company. Dad nahm die Offerte an. Es besteht kein Zweifel daran, dass mein Vater diese Stelle aufgrund der Kontakte seiner Familie erhielt. Und auch ich sollte in meinem Leben von solchen Verbindungen profitieren und hatte das Glück, dass großzügige Familienmitglieder und Freunde mir diese Chancen ermöglichten. Aber auch der Einfluss solcher Beziehungen kennt Grenzen. Zwar können sie Türen öffnen, trotzdem sind sie keine Erfolgsgarantie.
Im Falle meines Vaters öffnete Neil Mallon die Türe zu einem Job als Angestellter in einem Ideco-Depot in Odessa, für den er ein Gehalt von 375 Dollar im Monat erhielt. Seine Pflichten umfassten das Wischen von Böden, das Ordnen des Inventars und das Anstreichen von Tiefpumpen. Er traf außerdem auch auf interessante Persönlichkeiten und konnte sich ein Bild machen, ob ihm das Ölgeschäft behagte. Abgesehen davon gab es keine Garantien.
Zum zweiten Mal in seinem noch jungen Leben traf George H.W. Bush eine mutige und lebensverändernde Entscheidung. Nachdem er die Schule abgeschlossen hatte, entschied er sich gegen die Sicherheit, die ihm das College geboten hätte, und zog stattdessen in den Krieg. Nun würde er die Annehmlichkeiten Connecticuts hinter sich lassen, um mit seiner jungen Braut und seinem kleinem Sohn ins westliche Texas überzusiedeln.
GEORGE BUSH TRAF diese Entscheidung nicht alleine. Auch Barbara Bush genoss Mitspracherecht. Es war nicht unbedingt ein logischer Schritt für meine Mutter, dorthin zu ziehen. Sie war als Kind einer relativ wohlhabenden Familie in Westchester County im Bundesstaat New York aufgewachsen. Ihr Vater, Marvin Pierce, stammte aus Ohio und war einer der herausragendsten Sportler an der hiesigen Miami University gewesen. Er war ein großer, vierschrötiger Kerl, der sich seinen Mittwestler-Charme und seine kompromisslose Arbeitsmoral zunutze machte, um sich eine Karriere als Präsident der McCall Corporation, damals eines der größten amerikanischen Verlagsunternehmen, zu erarbeiten.
Ihre Mutter, Pauline Robinson Pierce, war eine Nachfahrin James E. Robinsons, der Richter am Obersten Gerichtshof von Ohio gewesen war. Sie genoss die Stellung ihrer Familie innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie und gab gerne Geld für die schönen Dinge des Lebens aus. Pauline Robinson Pierce beaufsichtigte ihre Kinder streng. Sie kaufte die Garderobe meiner Mutter und entschied, wo sie zur Schule und aufs College ging. Außerdem war sie ganz vernarrt in Mutters ältere Schwester Martha, ein Fotomodell, das etwa in der Vogue zu sehen war. Mrs. Pierce glaubte an einen Lebensstil, der kultiviert und raffiniert war. Ich kann mir ihr Entsetzen angesichts der Tatsache, dass ihre Tochter nun in den westlichen Teil von Texas zog, gut vorstellen. Das Einzige was dort nämlich als raffiniert durchging, war das Öl.
Zum Glück musste mein Vater aber nicht Pauline Pierce überzeugen, sondern nur meine Mutter – und ihr war die Idee leicht schmackhaft zu machen. Sie gestand mir später: »Ich war jung und verliebt, ich wäre überallhin mitgekommen, wo dein Vater hingewollt hätte.«
Ich glaube aber, dass mehr hinter ihrer Bereitschaft steckte, nach Texas zu gehen, als nur ihre Ergebenheit gegenüber meinem Vater. »Weihnachten war ein Albtraum«, vertraute sie mir an. »Wir verbrachten den Weihnachtsabend in Greenwich bei den Bushs. Dann ging es am Weihnachtsmorgen weiter zu meinen Eltern in Rye. Anschließend wieder zurück zum Mittagessen nach Greenwich.« Westwärts zu ziehen, war eine Erlösung von den Zwängen zweier wetteifernder Sippen.
Obwohl es ihr damals vielleicht nicht bewusst war, hatte auch meine Mutter eine nach Unabhängigkeit strebende Ader. Ansonsten wäre sie vermutlich keine so bereitwillige Partnerin bei der Suche nach neuen Abenteuern gewesen. Ich kann höchstens raten, wie Dads Leben verlaufen wäre, wenn seine Ehefrau nicht so offen gegenüber Veränderungen gewesen wäre. Die Geschichte wäre womöglich anders verlaufen.
Eine meiner liebsten Familiengeschichten ereignete sich kurz nach der Hochzeit meiner Eltern. Meine Mutter zündete sich eine Zigarette an, und mein Großvater, ihr Schwiegervater Prescott Bush, ermahnte sie augenzwinkernd: »Habe ich dir etwa gestattet zu rauchen?«
Schlagfertig konterte sie: »Nun, ich habe ja schließlich nicht dich geheiratet.«
In der Regel sprach niemand so mit meinem Großvater. Diese spitze Replik war einfach so herausgerutscht. Glücklicherweise reagierte er mit schallendem Gelächter. Eines war jedenfalls sicher: Barbara Bush war willens, ihre Meinung zu sagen. Das sollte sie in späteren Jahren auch ziemlich regelmäßig tun. Mit ihrem scharfen Witz und ihrer Selbstironie machte sie sich so bei Millionen von Amerikanern beliebt. Ihre Bereitschaft, ihre Meinung zu verkünden, unterschied sich stark von der Haltung manch anderer, gekünstelt wirkender Politikergattin. Durch die breite Zustimmung zu ihrer Person half sie in Folge vielen Amerikanern und Amerikanerinnen dabei, ihren Mann besser zu verstehen und liebzugewinnen. Viele sagten mir, dass jemand, der Barbara Bush geheiratet habe, ein guter Mann sein müsse.
IM SOMMER 1948 stand George H.W. Bush vor zwei Aufgaben: seinen Job anzutreten beziehungsweise für mich und Mutter ein geeignetes Heim zu finden. Während er sich nach einer passenden Behausung in Odessa, Texas, umsah, wohnten Mutter und ich vorübergehend bei meinem Urgroßvater G.H. Walker in seinem Sommerhaus in Kennebunkport, Maine.
Das Leben war auf Walker’s Point um einiges komfortabler als im Westen von Texas. Damals war Odessa eine Stadt mit knapp unter 30.000 Einwohnern. Sie lag ungefähr 30 Kilometer von der Partnerstadt Midland entfernt, und zum nächsten größeren Flughafen in Dallas waren es fast 500 Kilometer. Die meisten Straßen waren nicht asphaltiert. Wenige Häuser hatten mehr als ein Geschoss. Die Skyline bestand aus ein paar Erdölbohrtürmen, die den Horizont säumten. Im Sommer stieg das Thermometer regelmäßig in Richtung der 40 Grad Celsius – manchmal sogar schon am Vormittag. Auch lange Dürreperioden waren nichts Besonderes. Das flache Terrain bot wenig Abwechslung, und darüber hinaus gab es nichts, das einen natürlichen Schatten geworfen hätte, da es in der westlichen Ecke von Texas keine einheimischen Bäume gibt. Und der Wind blies einem um die Ohren und trug dabei mitunter jede Menge Staub mit sich.
Odessa entlieh sich seinen Namen von der am Schwarzen Meer gelegenen Stadt in der Ukraine, und für meinen Dad muss es sich anfangs auch tatsächlich so angefühlt haben, als wäre er in ein fremdes Land gezogen. Bei seiner Ankunft kannte er keine Seele. Die Menschen, auf die er traf, ähnelten eher den Leuten, die er in der Navy kennengelernt hatte, als jenen, die er von zu Hause kannte. Odessa war eine Arbeiterstadt, ihre Bewohner waren auf den Ölfeldern beschäftigt: Es handelte sich um Mechaniker, die die Ausrüstung in Schuss hielten, und Bohrarbeiter, die auf den Anlagen tätig waren. Einer der Mitarbeiter meines Vaters fragte ihn einmal, ob er ein College besucht habe. Wahrheitsgetreu teilte Dad ihm mit, dass Yale-Absolvent sei. Der Typ dachte kurz nach und sagte dann: »Hab ich noch nie von gehört.« Auch die Mode war anders dort. Dad verließ einst das Haus in Bermudashorts. Nachdem etliche Lastwagenfahrer ihn angehupt hatten, machte er sich allerdings auf den Heimweg und mottete, nachdem er zu Hause angekommen war, die Bermudas für alle Zeiten ein … Sogar das Essen war ungewohnt. Mein Vater erinnerte sich Zeit seines Lebens daran, wie er zum ersten Mal sah, wie jemand eine texanische Delikatesse orderte: paniertes Beefsteak.
Dad fand ein Haus in der East Seventh Street. Die gute Nachricht war, dass es über ein Badezimmer verfügte – die meisten Residenzen in dieser Straße hatten lediglich ein Plumpsklo. Die schlechte Nachricht bestand darin, dass wir unser Bad mit zwei Frauen teilten, die auf der anderen Seite des Zweifamilienhauses wohnten. Es handelte sich bei ihnen um ein Mutter-Tochter-Gespann, das seinen Unterhalt damit verdiente, zu nächtlicher Stunde männliche Kunden zu beglücken. Dagegen schien das 13-Familien-Haus neben dem Yale-Präsidenten alles andere als mies.
Das Leben im Westen von Texas erforderte noch weitere Anpassungen. Kurz nachdem Mutter und ich uns zu Dad in Odessa gesellt hatten, wurde sie von Gasgeruch aus dem Schlaf gerissen. Da sie fürchtete, dass höchste Explosionsgefahr für das Haus bestünde, schnappte sie sich mich und eilte hinaus auf den Bürgersteig. Ein Nachbar, der das Ganze beobachtete, erklärte ihr höflich, dass der Wind gedreht und nur den Geruch der Ölfelder herübergeblasen habe. Alles war in Ordnung. Wir konnten wieder zu Bett gehen. Mutters Erlebnis bestätigte eine der Wahrheiten über diesen Flecken Erde: Im westlichen Texas drehte sich alles um Öl. Es befand sich in der Erde, der Luft sowie in den Köpfen aller, die hier lebten.
Der Schlüssel zur erfolgreichen Anpassung meiner Eltern an ihre neue Umwelt lag in ihrer Einstellung. Sie sahen das Leben dort nicht als Widrigkeit an, die man eben ertragen musste. Vielmehr war es für sie ein Abenteuer – ihr erstes als verheiratetes Paar. Sie brachten ihren Mitmenschen Interesse entgegen und gewannen neue Freunde. Dabei wurde ihnen bewusst, dass sie weder auf Chauffeure noch auf französische Dienstmädchen angewiesen waren, um das Leben zu genießen. Sie hatten ja einander und waren in der Lage, das Beste aus jeder Situation zu machen.
Wir drei verbrachten Weihnachten 1948 in Odessa. Am Weihnachtsabend veranstaltete Dads Firma eine Feier für ihre Mitarbeiter. Er meldete sich freiwillig dafür, die Drinks zu mixen. Am Ende des Abends hatte der fröhliche Barkeeper, um seine Festtagslaune unter Beweis zu stellen, für fast jeden Cocktail, den er ausgeschenkt hatte, selbst einen gekippt. Im Anschluss an das Fest half ihm dann jemand auf einen der Pritschenwagen der Firma. Einer seiner Mitarbeiter war so freundlich, ihn nach Hause zu fahren. Dort angekommen, öffnete er die Ladeklappe und rollte meinen Dad auf den Rasen vor unserem Haus. Die Bushs passten gar nicht schlecht in den texanischen Westen.
* * *
DIESE ANEKDOTE VON der Weihnachtsfeier, die Mutter Dad nie vergessen ließ, war typisch für die Herangehensweise meines Vaters in Bezug auf Arbeit im Allgemeinen: Wenn er sich erst einmal einer Aufgabe verschrieben hatte, war er bereit, sich ihr hundertprozentig zu widmen. Wenn George Bush aufgetragen wurde, den Boden der Lagerhalle zu fegen, dann lieferte er dem Manager den allersaubersten Fußboden, den der je gesehen hatte. Wenn er Ölfördertürme anmalen sollte, legte er am Samstagmorgen eine Sonderschicht ein, um noch eine weitere Farbschicht aufzutragen, damit die Sache auch anständig erledigt wäre. Mein Vater liebte es, hart zu arbeiten – und er genoss es, die Früchte seiner Arbeit zu sehen. Er hatte die Lehren, die ihm seine Mutter mit auf den Weg gegeben hatte, absolut verinnerlicht. Gib dein Bestes. Sei nicht hochmütig. Beklage dich nicht.
Nach einer Weile begriffen seine Vorgesetzten, dass der Neue zu Höherem berufen war. Und so wurde Dad 1949, als ich drei Jahre alt war, nach Kalifornien versetzt. Dort arbeitete er sieben Tage in der Woche in einer Ölpumpenfabrik und schließlich als Handelsreisender im Auftrag von Tochterfirmen von Dresser und verkaufte Bohrmeißel und andere Ausrüstungsgegenstände. Während dieses Jahres lebten wir in vier verschiedenen Städten: Whittier, Ventura, Bakersfield und Compton. Sowohl in Whittier als auch in Ventura wohnten wir bei unseren längeren Aufenthalten in örtlichen Hotels. In Bakersfield hingegen hatten wir ein angemietetes, 90 Quadratmeter großes weißes Holzrahmenhaus. In Compton waren wir in einem Apartment in einem Wohnkomplex namens Santa Fe Gardens untergebracht. (Leider büßte die Wohnanlage Jahre später viel an Lebensqualität ein, als Drogen und Gewalt in die Gegend Einzug hielten.)
Unser nomadischer Lebensstil in Kalifornien stellte eine große Belastung für Mutter dar, da sie ständig packen und wieder auspacken beziehungsweise sich ständig um mich kümmern musste. Zusätzlich war sie nun auch wieder schwanger mit meiner jüngeren Schwester Robin, deren Geburt rund um Weihnachten 1949 ins Haus stand, als wir gerade in Compton stationiert waren. Mutter wollte sicherstellen, dass jemand da wäre, um ein Auge auf mich zu haben, wenn sie ins Krankenhaus müsste, weshalb sie unsere Nachbarin, mit der sie sich angefreundet hatte, darum bat. Diese willigte ein. Kurz bevor schließlich bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, fand sie dann allerdings heraus, dass die Nachbarin mitsamt ihrer Kinder vor ihrem ausfälligen Ehemann, der einmal zu oft betrunken nach Hause gekommen war, die Flucht ergriffen hatte. Somit stand ich nun wieder ohne Babysitter da. Irgendwie gelang es meiner Mutter dennoch, jemanden für mich aufzutreiben – wer genau, weiß keiner mehr –, und so kam meine Schwester Robin am 20. Dezember 1949 zur Welt.
Robin wurde nach meiner Großmutter Pauline Robinson Pierce benannt, die drei Monate zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Mein Großvater verbat meiner Mutter, zur Beisetzung anzureisen, da er fürchtete, dass dies das Baby gefährden könnte. Für meine Mutter, die ihren Vater verehrte, war es schwer, in Zeiten der Trauer so weit von ihm entfernt zu sein.
Das Jahr in Kalifornien war auch für meinen Dad nicht ganz einfach. Er war praktisch permanent unterwegs. Seiner Schätzung zufolge legte er mit seinem Auto in der Woche über 1.500 Kilometer zurück. Er war kein marktschreierischer Schnellredner, doch fand er für sich einen Ansatz, der sich als sehr effektiv erweisen sollte. Es gelang ihm, wie schon in der Schule und beim Militär, persönliche Beziehungen aufzubauen, und mit der Zeit konnte er so das Vertrauen seiner Klienten gewinnen, was wertvoller ist als jeder Bohrmeißel.
Im Frühjahr 1950 wurde meinem Vater mitgeteilt, dass Dresser ihn zurück ins westliche Texas holen wolle und er entweder in Odessa oder Midland wohnen könne. Als 25-jähriger zweifacher Familienvater strebte er danach, sesshaft zu werden. Er und Mutter entschieden sich schließlich für Midland, das damals 215 Ölfirmen sowie ca. 21.000 Menschen beheimatete. Midland würde für nächsten neun Jahre unser Zuhause sein. Es war die erste Stadt, an die ich mich erinnern kann, und wird für immer jener Ort bleiben, den ich als meine Heimatstadt ansehe.
* * *
DER NAME von Midland, Texas, rührte daher, dass die Stadt auf halbem Weg zwischen Fort Worth und El Paso auf der Texas-Pacific-Bahnstrecke lag. Wie Odessa vermittelte einem auch Midland das Gefühl, am Abgrund zu leben. Ich weiß noch, wie mein Vater in den Hinterhof unseres Hauses in Midland ging, um eine riesige Tarantel mit einem Besen zu vertreiben. Die haarige Kreatur legte einen Mordssatz hin, und Dad musste all sein Können als Baseballspieler aufwenden, um sie daran zu hindern, an ihm vorbei ins Haus zu huschen.
Obwohl Midland und Odessa einander in puncto Topografie nicht unähnlich waren, unterschieden sich die beiden Städte in Bezug auf ihre jeweilige Bevölkerung. Während die Leute in Odessa auf den Ölfeldern arbeiteten, waren die Einwohner von Midland in Büros angestellt. So wie Odessa war auch Midland eine Boomtown, und es war nicht einfach, dort eine Behausung zu finden. Für kurze Zeit lebten wir in einem Hotel und zogen danach in ein Haus mit knapp 80 Quadratmetern Wohnfläche, das sich am Stadtrand befand. Die Nachbarschaft hieß Easter Egg Row, weil der Bauunternehmer die Häuser in kräftigen Farben hatte anstreichen lassen, damit die Bewohner ihre Domizile auseinanderhalten konnten. Unser »Osterei« in East Maple, Hausnummer 405, war knallblau.
Auch das Midland der Neunzehnfünfzigerjahre beherbergte einen bunten Mix schillernder Charaktere. Es gab Leute, die am einen Tag noch pleite gewesen und nun plötzlich reich waren. Da gab es alte Rancher-Familien, die schon lange hier gelebt hatten, bevor Öl gefördert wurde. Dann lebten dort auch noch Texaner aus anderen Teilen des Bundesstaates, in erster Linie Absolventen der University of Texas und Texas A&M. Mein Vater gehörte zu einem kleinen Kontingent von Elitehochschul-Abgängern, die Angebote an der Ostküste in den Wind geschlagen hatten, damit sie ihre unternehmerischen Ambitionen im Ölgeschäft befriedigen konnten. Außerdem wohnten dort noch zahlreiche Fachleute, die für eine angemessene Infrastruktur rund um die Ölindustrie sorgten: Ärzte, Banker, Anwälte, Lehrer und Bauunternehmer, darunter auch ein netter Mann namens Harold Welch, dessen einzige Tochter, Laura Lane, ich Jahre später in der First Methodist Church von Midland heiraten würde.
Midland war ein von Wettbewerb geprägter Ort. Die in der Ölindustrie Beschäftigten gaben sich Mühe, ihre Nachbarn in Bezug auf Pacht- und Lizenzverträge abzuhängen. Die Ungewissheit, die die Branche prägte, hatte einen gleichmachenden Effekt. Jeder konnte es schaffen. Jedem konnte eine Fehlbohrung passieren. Trotz all der harten Arbeit und Wissenschaft, die in die Branche gesteckt wurden, hätten die Ölarbeiter dennoch alles für ein bisschen Glück gegeben. Trotzdem existierte in Midland aber auch eine Art Gemeinschaftssinn. Die Leute hielten in dieser unwirtlichen, abgeschiedenen Gegend zusammen.
Das Leben im westlichen Texas war simpel, so wie die Namen der Städte, die die hiesigen Straßen säumten: Big Lake (kein Wasser in Sicht), Big Spring (auch nicht viel mehr Wasser) oder Notrees (nicht ein einziger Baum). Meine Spielkameraden und ich verbrachten unsere Tage im Freien, wo wir Baseball oder Football spielten. An Freitagen im Herbst pilgerten die Leute in das Midland Memorial Stadium, um sich Spiele der Midland High Bulldogs anzuschauen. Einer meiner Lieblingsspieler war Wahoo McDaniel, der später für die Oklahoma Sooners und New York Jets spielte und außerdem noch als Wrestler in Erscheinung treten sollte. Am Sonntagvormittag gingen die meisten Leute in die Kirche. Rückblickend kann ich verstehen, warum Midland meinen Eltern so gefiel. Die Mischung aus Wetteifer und Gemeinschaft reflektierte die Erziehung, die mein Vater genossen hatte. Er hatte die Tugenden, die er zu Hause gelernt hatte, direkt mit sich in die texanische Wüste genommen.
Ein paar Monate nach unserer Ankunft in Midland erhielt mein Vater einen unerwarteten Brief von Tom McCance, einem hohen Tier bei Brown Brothers Harriman. Die Firma bekundete erneut ihr Interesse an Dad. Seine Kenntnisse der texanischen Ölbranche würden sich ihrer Meinung nach an der Wall Street bezahlt machen. Dieses Angebot wäre die perfekte Fluchtgelegenheit gewesen. Meine Eltern hätten sagen können, dass ihnen das Leben hier zwar zugesagt habe, sie viel gelernt hätten, nun aber wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren würden. Das war jedoch nicht, was sie taten. Mein Vater bedankte sich vielmehr bei Mr. McCance für sein großzügiges Angebot, lehnte es allerdings ab. Er hatte schließlich seinen Claim bereits im Westen von Texas abgesteckt.
EINIGE MEINER SCHÖNSTEN Erinnerungen an unsere Jahre in Midland betreffen die Zeit, die ich dort mit Dad verbrachte. Er war viel damit beschäftigt, sein Geschäft anzukurbeln und reiste unablässig. Außerdem engagierte er sich in der Gemeinde, unterrichtete etwa in der Sonntagsschule der First Presbyterian Church und begab sich im Namen von United Way und dem YMCA auf Spendensammelfahrten. Und dennoch war seine Abwesenheit für mich kaum spürbar. Es war ihm stets ein Anliegen, so viel Zeit wie nur möglich mit seinen Kindern zu verbringen. Wie mein Bruder Jeb es ausdrückte, war George H.W. Bush der Erfinder der »Quality Time«. Er kam von der Arbeit nach Hause, zog sich seinen Baseballhandschuh an und warf mir im Garten unseres Hauses in der West Ohio Avenue 1412, wohin wir im 1951 gezogen waren, Bälle zu. Dieses Haus trägt mittlerweile den Namen »George W. Bush Childhood Home« – obwohl ich mich schon sehr wundere, warum es nicht »George H.W. Bush-Haus, wo auch George W. Bush als Kind lebte« heißt.
An manchen Wochenenden nahm mich Dad mit auf die Taubenjagd, was für viele Leute in dieser texanischen Gegend eine Art Ritual darstellt. Ich trug dabei meine .410, die er mir zu Weihnachten geschenkt hatte, nachdem er überzeugt davon war, dass ich die Sicherheitslektionen verinnerlicht hatte. Wir scharten uns dann um ein Wasserloch inmitten der ausgedorrten Landschaft, bereiteten Burger auf einem tragbaren Grill zu und warteten bis zum Sonnenuntergang, in der Hoffnung, dass die Tauben zu uns fliegen würden, um ihren Durst zu stillen. Er nahm mich auch auf die Ölfelder mit, wo ich die Anlagen und Pumpen aus nächster Nähe sehen konnte. Diese Ausflüge entfachten bei mir das Interesse, das ich später in den Mittsiebzigern als unabhängig in der Ölindustrie Tätiger ausleben würde.
Unser Haus war ein geschäftiger Ort. Eines Tages brachte Dad einen jugoslawischen Ingenieur mit nach Hause, den er über das Ölgeschäft kennengelernt hatte. Er blieb eine Woche bei uns, und mein Vater führte ihn auf den Ölfeldern der Gegend herum. Während eines Sommers in Midland besuchte uns auch der jüngere Bruder meines Vaters, Bucky. Er war 14 Jahre jünger als Dad und in Begleitung seines College-Kumpels Fay Vincent – er sollte später Commissioner der Baseball Major League werden. Sie wohnten bei uns und betätigten sich gemeinsam auf den Ölförderanlagen.
Meine Eltern luden ständig ihre Nachbarn zu Gartengrillfesten oder Cocktails zu uns ein. Ich erinnere mich noch an ein Weihnachten, zu dem ich ein Horn geschenkt bekam. Offenbar blies ich das Ding ein paar Mal zu oft, denn letzten Endes nahm Dad es mir ab und machte es kaputt. Ein paar Tage später kaufte sich einer unserer Nachbarn das gleiche Horn, rief meinen Dad an – und blies lautstark in den Hörer. Ein anderes Mal war es wiederum mein Vater, der jemandem einen Streich spielte, nämlich seinem guten Freund Earle Craig, der ebenso wie er in Yale studiert hatte. Er war dafür bekannt, mit großer Freude in die Perlzwiebel zu beißen, die in seinem Martini schwamm. Eines Abends gab Dad ihm stattdessen ein Gummizwiebelchen in seinen Drink. Als der Earle of Craig (wie ihn manche nannten) schließlich dramatisch in die unechte Zwiebel biss, hatte das herzhaftes Gelächter innerhalb der Runde zur Folge (vermutlich hatten alle bereits ein paar Martinis intus). Earle wusste, dass das alles nicht so ernst gemeint war. Das Leben in Midland war jedenfalls erfreulich und sorgenfrei.
Ich weiß nicht mehr viel von unseren damaligen Gesprächen, aber es dürfte in der Regel um Sport und die Schule gegangen sein. Mein Vater war nicht der Typ, der einem Lektionen in Politik oder Philosophie erteilte. Er glaubte daran, dass er mit gutem Beispiel vorangehen müsse. Wenn ich eine Frage hatte, war er da, um sie zu beantworten. Er gab immer gute Ratschläge.
Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, ging ich mit ein paar Freunden in Midland in einen Gemischtwarenladen. Dort erspähte ich ein paar Spielzeugsoldaten aus Plastik, die sich in einem Glas auf einem der Regale befanden. Ich beschloss, sie in meine Hosentasche zu stopfen und spazierte, ohne für sie zu bezahlen, aus dem Geschäft. Später am selben Tag beobachtete mich mein Vater, wie ich vor dem Haus mit den erbeuteten Soldaten spielte.
»Hallo, mein Sohn«, sagte er. »Was tust du denn hier draußen?«
»Mit den Soldaten spielen«, antwortete ich.
»Woher hast du die denn?«, fragte er mich.
Ich zögerte, weshalb er die Frage wiederholte.
Nach ein wenig Kampf mit meinen inneren Dämonen legte ich ein Geständnis ab. »Ich habe sie aus dem Laden mitgehen lassen«, sagte ich.
»Komm mit mir mit«, meinte er daraufhin. Wir stiegen in sein Auto und fuhren zum Geschäft. Er wies mich an, alleine hineinzugehen, die Soldaten zurückzugeben und mich beim Besitzer für meinen Diebstahl zu entschuldigen. Ich tat, was er mir aufgetragen hatte, und verspürte aufrichtige Reue. Als ich zurück im Wagen war, sagte mein Dad kein weiteres Wort. Er wusste, dass die Botschaft angekommen war.
Der Großteil der alltäglichen Erziehungsarbeit bezüglich meiner Geschwister und mir fiel jedoch meiner Mutter zu. Sie fuhr mich zum Baseball-Training und machte sich während meiner Spiele Notizen, so wie sie es auch bei Dad getan hatte. Sie war wie eine Art Herbergsmutter, die mit unserer Pfadfindertruppe die Höhlen in Carlsbad und die Monahans Sandhills besichtigte. Mutter lud meine Freunde immer dazu ein, zwischen unseren schier endlosen Baseball- und Football-Sessions bei uns zu Mittag oder zu Abend zu essen. Wenn es sein musste, ergriff sie auch manchmal Disziplinarmaßnahmen. Anders als mein Vater war Subtilität nicht das ihre. Als ich jung war, gehörte es zum Beispiel zu ihrem Repertoire, mir den Mund mit Seife auszuwaschen, wenn ich etwas Unanständiges von mir gab oder tat – etwa als sie mich dabei erwischte, wie ich in die Hecke in unserem Garten urinierte. Im Großen und Ganzen hielt sie mich allerdings an der langen Leine, damit ich Spaß haben und ein freigeistiger Junge sein konnte.
Der Erziehungsansatz meiner Eltern reflektierte die Grundhaltung ihrer Generation. Mein Vater verbrachte mehr Zeit mit uns als sein Vater mit ihm, dennoch waren Dads damals nicht so in die Erziehung involviert wie heute. In der Regel waren sie auch nicht so emotional. In unseren frühen Jahren war er keiner, der einen umarmte. Er sagte auch nicht »Ich liebe dich«. Aber das musste er gar nicht. Uns war immer klar, dass er uns bedingungslos liebte.
Wir wussten auch, dass sich unsere Eltern gegenseitig liebten. In den 69 Jahren, in denen ich ihre Ehe nun schon beobachte, habe ich nie mitbekommen, dass es zwischen ihnen grobe Wortwechsel gegeben hätte. Selbstverständlich gibt es gelegentlich kleine Sticheleien oder auch einmal eine Meinungsverschiedenheit auf Augenhöhe. Allerdings spürte ich nie Zorn oder Frustration. Ihr solider und liebevoller Bund bot mir in meiner Kindheit stets Stabilität – und war ein Quell der Inspiration, als ich Laura heiratete.
In jenen Tagen konnten meine Geschwister und ich noch nicht gänzlich verstehen, wie viel Glück wir eigentlich hatten. Andere taten das sehr wohl. Bei Lauras fünfzigstem Highschool-Abschluss-Jubiläum zog mich Mike Proctor, ein Freund aus Kindertagen, zur Seite. Mike hatte seinerzeit, als wir aufwuchsen, gegenüber gewohnt. Wir waren im gleichen Alter und in derselben Klassenstufe gewesen. Mike verbrachte viel Zeit bei uns zu Hause. Wir fuhren zusammen auf unseren Fahrrädern, spielten gemeinsam Football und waren in derselben Pfadfindergruppe. Was ich hingegen nicht wusste, war, dass Mikes Familie ernsthafte Probleme hatte.
Beim Klassentreffen sagte Mike: »Es gibt etwas, das ich dir schon seit sehr langer Zeit sagen wollte. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust.«
»Kein Problem, Mike«, meinte ich. »Um was geht es denn?«
»Sag deiner Mutter, dass ich mich bei ihr bedanke.«
Er fuhr fort: »Damals ist es dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, wie zerrüttet meine Familie war. Durch die Liebenswürdigkeit deiner Mutter konnte ich erleben, wie eine echte Familie funktioniert.«
Am nächsten Tag rief ich meine Mutter an und erzählte ihr, was Mike gesagt hatte. Ich konnte fühlen, dass diese Art Dankbarkeit ihr Herz berührte.
»Richte Mike meine lieben Grüße aus«, trug sie mir auf.
ALS MEINE SCHWESTER Robin drei Jahre alt war, fiel meiner Mutter auf, dass sie nicht viel Energie hatte. Wenn Mutter sie etwa fragte, was sie gerne tun wolle, sagte sie, dass sie auf dem Bett sitzen oder im Gras liegen wolle. Das klang nicht normal für eine Dreijährige, weshalb sie Robin zur Familienärztin in Midland, zu Dr. Dorothy Wyvell, brachte.
Dr. Wyvell führte ein paar Tests durch. Mutter sorgte sich, dass die Ergebnisse schlecht ausgefallen waren, als die Ärztin sie und Vater in ihre Praxis einlud. Jeder, der selbst Kinder hat, kann sich die Agonie des Gesprächs, das folgen sollte, ausmalen. Dr. Wyvell teilte meinen Eltern mit, dass Robins Bluttests ergeben hätten, dass sie an Leukämie leide. Die Anzahl ihrer weißen Blutzellen war jenseits von Gut und Böse – die höchste, die Dr. Wyvell je untergekommen war.
Meine Eltern hatten erwartet, dass etwas im Argen läge, aber dies wiederum hatten sie nicht befürchtet. Schließlich erkundigte sich mein Vater: »Was ist der nächste Schritt? Wie werden wir sie behandeln?«
Während sie antwortete, füllten sich die Augen Dr. Wyvells mit Tränen. Sie war ja nicht nur die Ärztin meiner Eltern. In der eng zusammenstehenden Gemeinschaft von Midland war sie eine Freundin. »Es gibt nichts, was ihr tun könnt«, sagte sie. »Wahrscheinlich bleiben ihr nur noch ein paar Wochen. Ihr solltet sie mit nach Hause nehmen und ihr alles so angenehm wie möglich machen.«
Mein Vater konnte nicht akzeptieren, dass es keine Hoffnung mehr gab, sein kleines Mädchen noch zu retten. Er fuhr nach Hause und rief den Bruder seiner Mutter, Dr. John Walker, im Memorial Sloan Kettering, dem besten Krankenhaus zur Krebsbehandlung in New York, an. Sein Onkel meinte, dass es ein paar neue Fortschritte bei der Behandlung gebe, die Robin womöglich helfen könnten. Er bestätigte aber auch, was Dr. Wyvell gesagt hatte: Es gab keine Heilung für Kinderleukämie.
Meine Eltern begaben sich also mit Robin nach New York. Sie wussten, dass die Chancen schlecht standen, aber sie weigerten sich, ihre Tochter aufzugeben. Wie auch Dr. Walker meinem Vater mitteilte: »Du würdest nicht mehr mit dir selbst leben können, wenn du nicht versuchen würdest, sie behandeln zu lassen.«
Meine Eltern weihten mich nie richtig ein. Sie sagten mir nur, dass Robin krank sei beziehungsweise sie nach New York reisen würden, damit Onkel John ihr helfen könne, sich wieder besser zu fühlen. Mein Vater pendelte zwischen New York und Midland hin und her. Manchmal besserte sich Robins Krebserkrankung, und sie kam für ein paar Wochen zurück nach Hause. Dann hatte sie wieder einen Rückfall, und meine Eltern flogen mit ihr zurück nach New York. Während sie fort waren, ließen Mutter und Dad mich und meinen Bruder Jeb, der erst wenige Monate alt war, bei Freunden und Nachbarn aus Midland. Diese Leute wurden somit ohne mit der Wimper zu zucken zu unseren Ersatzeltern.
Meine Eltern begegneten Robins Krankheit auf ihre jeweils eigene Art und Weise. Mein Vater war ein wahrer Wirbelwind. Wenn er sich in New York aufhielt, traf er sich mit Ärzten, ging Testresultate durch und erkundigte sich nach neuen Behandlungsmethoden. In Texas eilte er schon früh am Morgen aus dem Haus, ging in die Kirche, um für Robin zu beten, und stürzte sich darauf in die Arbeit. Wenn ich zurückdenke, dann war seine emsige Umtriebigkeit seine Art, um mit der Hilflosigkeit, die er fühlte, umzugehen. George Bush, der Navy-Pilot, der auf das Rettungsfloß geklettert und dem Tod davongepaddelt war, muss es als unerträglich erlebt haben, nichts für das kleine Mädchen, das er so liebte, tun zu können.
Im Gegensatz zur Rastlosigkeit meines Vaters verbrachte meine Mutter beinahe jede Stunde, die sie wach war, an Robins Bett. Sie spielte mit ihr, las ihr vor und versuchte, sie bei guter Laune zu halten. Sie wohnte in New York bei den Walkers, und Familienmitglieder schauten im Krankenhaus vorbei, um ihr Unterstützung anzubieten. Mein Urgroßvater, der ruppige G.H. Walker – mit seinen 78 Jahren hatte er selbst sein letztes Lebensjahr erreicht – verbrachte Stunden damit, Robin Gin Rummy beizubringen. Sie nannte das Spiel »Gin Poppy«, nach dem Spitznamen, bei dem die Familie meinen Dad rief.
Robins Behandlung war schmerzhaft. Die Chemotherapie und Bluttransfusionen gingen ihr an die Substanz. Mutter stellte eine Regel auf: Es durfte vor Robin nicht geweint werden. Das fiel meinem Vater sehr schwer. Mutter harrte stoisch an Robins Seite aus und tröstete ihre Tochter, wenn sie litt. Ihr Biograf Richard Ben Cramer beschrieb den Charakter meiner Mutter in diesen Tagen so: »Es ging über Stärke hinaus – sie war heroisch und ihr Handeln ein Akt des Willens und der Liebe.«
Eines Tages besuchte Mutter die Eltern meines Dads in Greenwich, Connecticut. Mein Großvater Prescott Bush, der gerade zum Senator gewählt worden war, nahm sie mit auf einen langen Spaziergang durch den Putnam-Friedhof von Greenwich. Dort zeigte er ihr eine Grabparzelle, die er und meine Großmutter sich als letzte Ruhestätte ausgesucht hatten. Es gab auch noch genug Platz für einen weiteren Grabstein. Das war sein sanfte Art, meiner Mutter mitzuteilen, dass sie sich um Robin kümmern würden, wenn die Zeit gekommen wäre, und er seine Enkelin gerne an seiner Seite hätte. (Jahrzehnte später verlegten meine Eltern Robins Grab an den Ort, wo sie selbst einmal bestattet werden wollen, bei der Präsidentenbibliothek meines Dads in College Station, Texas.)
Das Ende kam schließlich am 11. Oktober 1953. Robin schlief friedlich ein, nachdem sie sieben Monate gekämpft hatte. Während eines ihrer letzten Augenblicke mit meinem Vater sah Robin ihn mit ihren wunderschönen blauen Augen an und sagte: »Ich liebe dich mehr, als die Zunge sagen kann.« Dad sollte diese Worte den Rest seines Lebens immer wieder wiederholen.
* * *
ICH HABE NOCH eine lebhafte Erinnerung an den Tag, als meine Eltern mir von Robins Tod erzählten. Einer meiner Lehrer an der Sam Houston Elementary School hatte mich und einen Mitschüler von mir darum gebeten, einen Schallplattenspieler in einen anderen Bereich der Schule zu bringen. Als wir hinausgingen, sah ich, wie meine Eltern in ihrem erbsengrünen Oldsmobile vorfuhren. Ich rannte hinüber zu ihrem Wagen und dachte zuerst noch, dass ich Robins blonde Locken auf dem Rücksitz sehen könnte. Ich war so aufgeregt, weil ich glaubte, dass sie wieder nach Hause gekommen wäre. Jedoch war sie nicht da, als ich beim Auto ankam. Mutter umarmte mich ganz fest und erklärte mir, dass sie gestorben sei. Auf der Fahrt nach Hause sah ich meine Eltern zum ersten Mal weinen.
Nach Robins Tod tauschten meine Eltern die Rollen. Mein Vater war nun der Starke, der sich um die Planung der Beerdigung kümmerte. Eine der ersten Entscheidungen meiner Eltern war, Robins Körper dem Memorial Sloan Kettering zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen. Die Ärzte hatten ihnen erklärt, dass das eine Möglichkeit darstelle, mehr über die Krankheit zu erfahren, und meine Eltern hofften, dass auf diese Weise womöglich andere Kinder von Robins Tod profitieren würden. Die Kinderkrebsforschung wurde in der Folge zu einem lebenslangen Anliegen meiner Eltern. Heute trägt die Kinderkrebsabteilung des Houstoner MD Anderson Cancer Centers Robins Namen.
Nachdem sie sieben Monate lang Stärke gezeigt hatte, war meine Mutter nun am Boden zerstört. Sie litt an Depressionen, die sie periodisch heimsuchten. Im Alter von 28 begannen ihre dunkelbraunen Haare weiß zu werden.
Obwohl ich zu jung war, um Robins Tod zur Gänze zu begreifen, spürte ich dennoch den Schmerz, den meine Mutter fühlte. Sie erzählte mir später, dass ich aufhörte, mit meinen Freunden zu spielen, damit ich drinnen bleiben konnte, um zu versuchen, sie mit meinen Witzen aufzuheitern. Auch mein Vater fand Wege, um ihre Stimmung zu heben. Er arrangierte Treffen mit Freunden und half ihr sanft, wieder in die Spur zu kommen und ihr Leben weiterzuleben. Anstatt sich auf den Verlust Robins zu fokussieren, betonten sie ihre Dankbarkeit für die Jahre, die sie mit ihr hatten verbringen dürfen.
Robins Tod trieb meine Eltern nicht auseinander, anders als viele andere Paare, die sich vor den Trümmern ihrer Beziehung wiederfinden, wenn sie ein Kind verlieren. In ihrem Fall schweißte sie das geteilte Leid noch enger zusammen. So wurde ihre Ehe noch stärker. Als sie einander am meisten brauchten, waren sie beide dazu bereit, dem anderen jeweils drei Viertel des Weges zwischen ihnen entgegenzugehen.
VATER SPRACH NIE sehr viel darüber, wie es war, Robin zu verlieren. In jener Ära besprachen die Menschen solche Dinge nicht wirklich. Ein paar Jahre nach Robins Tod schrieb Dad seiner Mutter aber einen Brief darüber, wie einsam er sich fühle. »Wir brauchen weiches blondes Haar, um unsere Bürstenhaarschnitte aufzuwiegen. Wir brauchen ein Puppenhaus, das unseren Forts und Schlägern und Tausenden von Baseball-Sammelkarten entgegensteht«, schrieb er ihr. »Wir brauchen ein Mädchen.« Seine Gebete wurden schließlich erhört, als 1959 meine Schwester Doro geboren wurde. Im Krankenhaus presste er sein Gesicht gegen die Fensterscheibe vor der Babystation und schluchzte.
Während seines Vorwahlkampfes um die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 1980 fragte ein Journalist meinen Vater, ob er je mit »persönlichen Schwierigkeiten« zu kämpfen gehabt habe. Zwischen den Zeilen zielte diese Frage darauf ab, herauszuarbeiten, ob ein Mann, der ein so behagliches Leben wie George Bush führte, die Probleme der gewöhnlichen Menschen nachvollziehen könne.
Mein Vater hätte erwähnen können, wie er im Zweiten Weltkrieg vom Feind abgeschossen worden sei. Oder dass er in der Highschool an einer Staphylokokkeninfektion beinahe gestorben wäre. Stattdessen starrte er den Reporter an und fragte ihn: »Haben sie jemals Ihrem Kind beim Sterben zugesehen?«
Der Journalist verneinte.
»Ich aber schon, sechs Monate lang«, sagte Dad.
Das war das Ende des Interviews. Jeder, der jemals ein Kind verloren hatte, wusste genau, was er meinte.
Mein Vater hörte nie auf, an seine Tochter zu denken. Solange ich mich erinnern kann, stand auf seinem Schreibtisch in seinem Büro ein gerahmtes Foto von ihr. Später in seinem Leben, als er sich mit seiner eigenen Sterblichkeit befasste, fragte Dad seinen Seelsorger, ob er Robin und seine Mutter im Himmel wiedersehen werde. Er wollte wissen, ob Robin noch wie ein Kind aussehe – oder ob sie in den sechzig Jahren seit ihrem Tod »erwachsen« geworden sei. Diese Frage ist ein Teil eines großen Mysteriums. Allerdings bin ich mir sicher, dass mein Dad in seinem Herzen weiß, dass er seine Tochter wiedersehen wird.