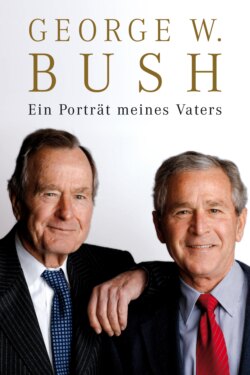Читать книгу Ein Porträt meines Vaters - George W. Bush - Страница 8
ОглавлениеKRIEG
JEDER PILOT ERINNERT SICH an seinen ersten Flug. In meinem Fall war das, als ich 1968 in einer Cessna 172 von der Moody Air Force Base in Valdosta, Georgia, abhob. Für meinen Vater fand dieser Moment 1942 in einer offenen Stearman N2S-3 auf der Wold-Chamberlain Naval Air Base in Minneapolis statt. Die Kadetten nannten dieses Flugzeug »die gelbe Gefahr«, weil es gelb angestrichen und es mitunter recht gefährlich war, es zu fliegen. Der andere Spitzname, der diesem Fluggerät anhaftete, lautete »Waschmaschine«, was sich auf die Anzahl der Kadetten bezog, die aus der Pilotenausbildung im Schleudergang »hinausgespült« wurden.
Mein Dad beschrieb seinen ersten Alleinflug als einen der größten Spannungsmomente seines Lebens. Ich weiß genau, was er damit meinte. Es ist ein beglückendes Gefühl, in einem Cockpit zu sitzen, die Startbahn entlang zu beschleunigen und sich schließlich in die Lüfte zu erheben. Das Flugzeug kümmert es nicht, woher du kommst, wo du zur Schule gegangen bist oder wer deine Eltern sind. Alles, was zählt, sind deine Flugkenntnisse und dein Können. Tom Wolfe nannte das den »Stoff, aus dem die Helden sind«.
Im winterlichen Minnesota flog Fähnrich George Bush beinahe jeden Tag unter frostigen Bedingungen. Dort lernte er, sich in der Luft wohlzufühlen und auf Schnee und Eis zu landen – eine wertvolle Fähigkeit, aber keine, die im Südpazifik dann sonderlich gefragt ist.
Piloten sagen, dass man sich größer fühle, nachdem man zu fliegen gelernt habe. Im Falle meines Vaters traf das sogar buchstäblich zu. Als ihm sein kommandierender Offizier im Juni 1943 in Corpus Christi schließlich seine goldenen Flugabzeichen anheftete, war er seit seinem Eintritt in die Streitkräfte um sechs Zentimeter gewachsen und maß nun 1 Meter 88. Er war noch nicht ganz 19 Jahre und somit der jüngste Pilot in der United States Navy.
Nach der Fliegerausbildung bekam Dad noch einen kurzen Urlaub zugestanden, bevor er sich seinen nächsten Befehlen würde widmen müssen. Er verbrachte ihn mit seiner Familie in Maine. Seine Mutter hatte großzügigerweise noch einen besonderen Gast eingeladen: Barbara Pierce, die mittlerweile am Smith College studierte, aber gerade Sommerferien hatte. So waren meine Eltern zwei Wochen lang in Maine absolut unzertrennlich. Als der Urlaub zu Ende ging, fassten sie den Entschluss, sich heimlich zu verloben.
Lange ließ sich ihre Verlobung allerdings nicht geheim halten. Im Dezember 1943, kurz vor der Indienststellungszeremonie für den Flugzeugträger USS San Jacinto, der meinen Dad zum Kampfeinsatz transportieren sollte, beschlossen meine Eltern, ihre Familien über ihre Heiratsabsichten zu informieren. Zu ihrem großen Erstaunen schien jedoch bereits jeder Bescheid zu wissen. Ihre Liebe zueinander war einfach offensichtlich. Wie mein Vater meiner Mutter schrieb: »Ich liebe dich, mein Schatz, von ganzem Herzen, und zu wissen, dass du mich auch liebst, bedeutet mir alles. Wie oft habe ich schon an die unermessliche Freude gedacht, die uns eines Tages zuteilwerden wird. Wie glücklich sich unsere Kinder schätzen werden, dich zur Mutter zu haben.« (Diese Zeilen stammen aus einem ihrer wenigen noch erhaltenen Briefe aus Kriegszeiten. Die anderen gingen leider während ihrer etlichen Umzüge verloren.) Nach der Einweihungszeremonie für das Kriegsschiff steckte meine Großmutter meinem Dad einen Verlobungsring zu, der mit einem Sternsaphir besetzt war, den ihre Schwester Nancy beigesteuert hatte. Etwas später, noch am selben Tag, überreichte er ihn Barbara. Sie trägt ihn heute noch – obwohl sie gelegentlich vermutet, dass der Stein in Wirklichkeit nur aus Blauglas besteht …
* * *
IM JANUAR 1944, nachdem er ein intensives eineinhalbjähriges Trainingsprogramm durchlaufen hatte, meldete sich Fähnrich Bush schließlich zum Einsatz an Bord der USS San Jacinto. Das Schiff war nach jener Schlacht benannt, in der General Sam Houston den mexikanischen Caudillo Santa Anna bezwingen konnte. Als vage Vorschau auf das Leben, das meinen Dad noch erwartete, wehten auf dem Flugzeugträger sowohl das Sternenbanner als auch die Lone-Star-Flagge des Staates Texas.
Der junge Navy-Pilot schloss sich einer Reihe von Fliegern an, mit denen er gemeinsam das Geschwader VT-51 bilden sollte. Jack Guy kam aus dem ländlichen Georgia und hatte seinen Job als Bankkassierer hinter sich gelassen, um sich der Navy anzuschließen. Lou Grab war im kalifornischen Sacramento aufgewachsen, wo sein Vater eine Tankstelle besaß. Stan Butchart kam aus Spokane im Bundesstaat Washington und hatte schon immer vorgehabt, Pilot zu werden. Die Mitglieder des Geschwaders hatten alle wenig miteinander gemein. Im Internat hatte George Bush gelernt, wie er zu Mitschülern aus verschiedenen Teilen des Landes eine Beziehung aufbauen konnte. Beim Militär konnte er nun lernen, das Gleiche mit Menschen zu tun, die über einen anderen sozialen Hintergrund als er selbst verfügten.
Mein Vater brachte Leute liebend gern zum Lachen. So dachte er sich etwa auch Spitznamen für jeden aus. (Erinnert euch das vielleicht an jemanden?) Stan Butchart wurde »Butch« gerufen. Jack Guy wurde zu »Jackoguy«, was er seiner mittleren Initiale zu verdanken hatte. Auch mein Vater selbst erhielt einen speziellen Namen. Während eines Trainingsmanövers nahe der Küste Marylands flog er sehr niedrig über einen Strand und erspähte einen Zirkus, der unter ihm errichtet wurde. Offenbar hatten die Zirkustiere keine Erfahrung mit Kampffliegern. So versetzte der Flugzeuglärm die Elefanten in Panik, die sich daraufhin losrissen und durch die Stadt trampelten. Von da an riefen Dads Kumpels ihn »Ellie the Elephant«. Er reagierte, indem er anfing, das Trompetengeräusch eines Elefanten zu imitieren, was er im Verlauf des Krieges anscheinend immer weiter verfeinerte. Ich habe ihn das nie machen hören, obwohl es manchmal, als er Vorsitzender des Republican National Committee war, sehr gut gepasst hätte.
Das Flugzeug, mit dem er die Elefantenpanik auslöste, war eine TBF/TBM Avenger – ein Torpedobomber. Die Avenger war die größte einmotorige Maschine, die von einem Flugzeugträger aus zum Einsatz kam. An Bord fanden der Pilot, zwei Besatzungsmitglieder sowie vier über 200 Kilogramm schwere Bomben Platz. Um die Bewaffnung unterbringen zu können, hatte das Flugzeug einen ausgebeulten Bauch, was ihm den liebevollen Spitznamen »schwangerer Truthahn« einbrachte.
Die Avenger war ein schweres Fluggerät und nicht gerade einfach zu manövrieren. Die größte Herausforderung war dabei, den Flieger auf der schmalen, auf und ab schaukelnden Landebahn eines Flugzeugträgers zu landen. Eine ordentliche Landung verlangte Konzentration, Genauigkeit und Teamwork. Ein Pilot musste sich im richtigen Winkel nähern, sich an die Flaggensignale eines Landeoffiziers halten und dann einen der Fanghaken erwischen, damit man nicht am anderen Ende der Landebahn vom Schiff herunterrutschte. Als Präsident war ich selbst einmal als Passagier an Bord einer S-3B Viking bei einer Landung auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln dabei. Ich hatte seit jeher den größten Respekt vor den Piloten, die auf Flugzeugträgern dienten, aber nach dieser Erfahrung verdoppelte sich dieser Respekt sogar noch.
Im Frühling 1944 stach die San Jac mit Kurs auf den Pazifik in See. Mein Vater saß im Cockpit seiner Avenger für seinen ersten Katapultstart vom neuen Flugzeugträger. Wie er seiner Mutter schrieb, war er »äußerst froh darüber, dass die Maschine funktionierte«. Am 20. April war der Flugzeugträger bereits von Norfolk, Virginia, aus durch den Panamakanal und hinaus nach Pearl Harbor im Pazifischen Ozean gefahren. Die Crew sah dort die verbrannten Überreste der USS Utah sowie der Arizona, was den Männern in Erinnerung rief, warum sie sich überhaupt im Krieg befanden – und wer der Feind war, der ihnen schon bald gegenüberstehen würde.
Die Monate nach Pearl Harbor waren betrüblich gewesen, da die japanische Kriegsmaschinerie sich ihren Weg durch den gesamten pazifischen Raum bahnte. Ab dem Frühling 1942 waren überhaupt nur noch Australien und Neuseeland als alliierte Bollwerke übrig. Das Blatt begann sich im Mai dieses Jahres allerdings zu wenden, als amerikanische und australische Seestreitkräfte den Vormarsch der Japaner bei der Schlacht im Korallenmeer einen Dämpfer versetzten. Einen Monat später fuhren die USA schließlich ihren ersten großen Sieg bei der Schlacht um Midway ein. Von da an begann die Navy einen Feldzug von Insel zu Insel, um alle japanisch besetzten Gebiete zu befreien, mit dem ultimativen Ziel vor Augen, letztlich Japan selbst anzugreifen.
Die erste Mission der San Jac bestand darin, die japanischen Stellungen auf Wake Island anzugreifen. Der Einsatz verlief erfolgreich, aber die Gefechte forderten auch erste Opfer. Bei einem Patrouillenflug verschwand Dads Zimmerkumpel und bester Freund auf dem Flugzeugträger, Jim Wykes, vom Radarschirm. Auch Suchmannschaften konnten ihn nicht finden. Er und seine beiden Crewmitglieder wurde vermisst gemeldet, und schon bald war klar, dass sie nicht zurückkehren würden. Mein Vater litt unter dem Verlust seines Freundes. Er verstand, dass der Tod zum Krieg nun einmal dazugehörte, doch dies war eine sehr persönliche Angelegenheit.
Wenige Tage später verfasste er einen von Herzen kommenden Brief an Jims Mutter. »Ich kenne ihren Sohn gut und habe mich lange genug glücklich schätzen dürfen, mich zu seinen engsten Freunden zu zählen«, schrieb er. »Sein liebenswerter Charakter und seine uneingeschränkte Tugendhaftigkeit haben ihm den Respekt und die Freundschaft jedes Offiziers und jedes gemeinen Mannes im Geschwader eingebracht.« Er fuhr fort: »Sie haben einen liebenden Sohn verloren. Und wir einen geliebten Freund.«
Dies war aber nur der erste von vielen solchen Briefen, die mein Vater an die Familien gefallener Kameraden verschickte. Jahrzehnte später sollte er als Präsident erneut ähnliche Briefe schreiben müssen. Ebenso ich selbst. Natürlich kann nichts, was in so einem Brief steht, den Verlust eines lieben Menschen wiedergutmachen. Aber der simple Akt, eine solche Botschaft zu schreiben und damit seine Anteilnahme zu zeigen, kann dabei helfen, den Schmerz einer trauernden Familie zu lindern.
Nach dem Einsatz bei Wake Island fuhr die San Jac Richtung Saipan. Mitte Juni geriet der Flugzeugträger dann plötzlich unter Beschuss durch japanische Kampfflieger. Als das Startkatapult die Avenger meines Vaters in die Luft bugsierte, sank schlagartig der Öldruck. Der Motor setzte aus. Die einzige Option war eine Wasserlandung. Fähnrich Bush lenkte das Flugzeug in den Ozean, kam zuerst mit dem Heck auf und schlitterte über die Wasseroberfläche. Er und seine Crew kletterten auf einen der Flügel, bliesen ein Rettungsfloß auf und paddelten vom Flugzeug weg, während unter Wasser die Bomben an Bord der Avenger detonierten. Ein amerikanischer Zerstörer, die C.K. Bronson, fischte sie dann mithilfe eines Ladenetzes aus dem Wasser. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass George Bush auf ein Rettungsfloß angewiesen sein würde.
Fliegen war gefährlich, aber das traf auch auf das Leben auf einem Schiff zu. Eines Nachts befand sich mein Vater gerade im Dienst auf Deck, als sich ein Flugzeug im Landeanflug auf den Flugzeugträger befand. Der Pilot schätzte allerdings die Entfernung falsch ein, verfehlte den Landehaken und donnerte in ein Geschütz. Der Pilot, die Crew sowie einige Unbeteiligte wurden dabei getötet. Dad sah das zuckende Bein des Piloten auf Deck liegen, bevor ein Unteroffizier ein paar Matrosen befahl, sauber zu machen und sich auf weitere Landungen vorzubereiten.
Solche Erfahrungen müssen tiefe Spuren bei einem zwanzigjährigen Jungen hinterlassen haben. Je mehr ich über die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erfuhr, desto mehr bewunderte ich George Bush und die vielen anderen seiner Generation, die damals ihrem Land dienten.
VON ALL DEN grauenvollen Tagen, die George H.W. Bush durchleben musste, war indes keiner dramatischer als der 2. September 1944. Die Piloten des Geschwaders waren bereits früh auf und versammelten sich zu einem Briefing bezüglich einer Mission, bei der ein Funkturm auf der stark befestigten Insel Chichi Jima zerstört werden sollte. Die Anlage war der wichtigste Kommunikationsknotenpunkt der Bonin-Inseln, denen eine Schlüsselfunktion bei der Verteidigung des japanischen Reiches zuwuchs.
Mein Vater flog praktisch immer mit denselben beiden Crewmitgliedern, dem Kanonier Leo Nadeau und dem Funker John Delaney. Aber an diesem Tag bat ein Lieutenant Junior Grade namens Ted White darum, als Kanonier mitkommen zu dürfen. White, der Waffenoffizier des Geschwaders und Yale-Absolvent, wollte die Waffensysteme im Einsatz begutachten. Dad warnte ihn, dass womöglich ein heißer Ritt bevorstehe. Erst am Tag zuvor waren sie über Chichi Jima unter schweren Beschuss geraten. White bestand allerdings darauf, mitzukommen, woraufhin mein Vater einlenkte, und auch der Skipper, Lieutenant Don Melvin, gab sein Einverständnis.
Gegen 7 Uhr 15 stiegen vier Avengers von der San Jac auf und flogen in Formation Richtung Chichi Jima, während ihnen Hellcat-Jagdflugzeuge von oben herab Rückendeckung gaben. Das Flugzeug meines Vaters, in dem nun White als Kanonier und Delaney als Funker saßen, sollte als drittes dem Ziel entgegenstürzen. Als sie schließlich in den Sinkflug übergingen, gerieten sie unter Flak-Beschuss seitens der japanischen Stellung. Leuchtspurgeschosse durchschnitten den Himmel, und explodierende Sprengsätze erfüllten die Luft mit schwarzem Rauch. Plötzlich wurde die Avenger durchgerüttelt und taumelte bugwärts. Die Maschine war getroffen worden. Rauch drang ins Cockpit, und ein Feuer breitete sich auf den Flügeln in Richtung der Treibstofftanks aus.
Mein Dad war entschlossen, die Mission durchzuziehen. Er setzte seinen Sturzflug mit 300 Stundenkilometern fort, warf die Bomben ab, traf das Ziel, drehte scharf ab und entfernte sich von der Insel. Er hatte gehofft, neuerlich eine Wasserlandung hinlegen zu können, doch das Flugzeug stand bereits in Flammen und ihm rannte die Zeit davon. Die einzig verbleibende Option war, auszusteigen.
»Wir springen ab!«, rief er seinen Crewmitgliedern über die Sprechanlage zu.
Dann legte er die Maschine leicht in die Kurve, um den Druck auf die Crew-Luke zu verringern. Er nahm an, dass Delaney und White absprangen.
Da ihm nur mehr Sekunden blieben, öffnete er seine Gurte, stieg aus dem Cockpit und zog die Reißleine seines Schirms.
Doch der Sprung verlief nicht nach Plan. Mein Vater erlitt einen Cut am Kopf, und das Heck des Flugzeugs fügte seinem Fallschirm einen Riss zu. Er schlug hart auf dem Wasser auf und ging unter. Als er wieder auftauchte, blutete sein Schädel, und er musste sich übergeben, da er zu viel Meerwasser geschluckt hatte. Außerdem war er mit einer Portugiesischen Galeere – einer Qualle – in Berührung gekommen. Er schwamm blind vor Wut fort von der Insel, die nur wenige Kilometer entfernt lag.
Dann sah er, wie Doug West, einer seiner Kameraden, mit den Flügeln seiner Avenger auf ein Objekt auf der Wasseroberfläche deutete. Es handelte sich um ein gelbes, mit Luft gefülltes Rettungsfloß. Einer der Piloten hatte es abgeworfen, nachdem er mitbekommen hatte, dass eines der anderen Flugzeuge abgestürzt war. Mein Dad kletterte auf das Floß und fing an, seine Hände als Paddel zu benützen. Am Himmel über ihm feuerten die amerikanischen Flugzeuge eine Salve nach der anderen ab, um einen Verband kleiner Boote, mit denen die Japaner den abgeschossenen Piloten gefangen nehmen wollten, von ihrem Plan abzubringen.
Im Verlauf der nächsten drei Stunden paddelte er unter der brütenden Sommersonne gegen die Strömung an und betete darum, gerettet zu werden. Irgendwie gelang es ihm durchzuhalten. Ich werde nie genau wissen, was ihm dabei durch den Kopf ging. Womöglich musste er an die Lektionen, die ihm seine Eltern erteilt hatten, zurückdenken: sich so viel Mühe wie möglich zu geben, niemals aufzugeben und stets daran zu glauben, dass Gott einen Weg finden würde, ihn zu retten.
Erschöpft vom Paddeln erspähte er schließlich einen schwarzen Punkt auf dem Wasser. Zuerst glaubte er, sich ihn nur einzubilden, aber letztlich handelte es sich tatsächlich um ein Periskop. Als Nächstes fürchtete er, dass es sich um ein japanisches U-Boot handeln könnte. Als es sich ihm aber näherte und auftauchte, konnte er das Logo der US-Navy erkennen. Die USS Finback fischte meinen Vater dann ein paar Minuten vor Mittag aus dem Wasser. Zwei Matrosen griffen ihn bei den Armen und zogen ihn vom Rettungsfloß auf ihr Schiff empor. »Willkommen an Bord, Sir«, sagte einer der beiden Männer zu ihm. »Es ist eine Freude, an Bord kommen zu dürfen«, erwiderte er, was selbstverständlich eine massive Untertreibung war.
Es ist eine bemerkenswerte historische Fußnote, dass ein gewisser Fähnrich Bill Edwards die Ankunft meines Vater auf der Finback mit seiner Handkamera von Kodak einfing. Jahrzehnte später sollte ein landesweites Publikum die Aufnahmen, die diesen Morgen im Pazifik wiedergeben, zu Gesicht bekommen: Amerikanische Soldaten retten darauf einem zwanzigjährigen Piloten, der später Präsident der Vereinigten Staaten sowie der Vater eines weiteren werden sollte, das Leben.
IN DEN TAGEN nach dem Abschuss dachte mein Vater ununterbrochen an seine Crewmitglieder Delaney und White. Keiner von beiden war gefunden worden. An Bord der Finback wurde er von Albträumen, in denen er alles noch einmal durchleben musste, heimgesucht. Nachdem er aufgewacht war, fragte er sich stets, ob er nicht mehr für seine Männer hätte tun können. Nur einen Tag nach seiner Rettung schrieb er einen Brief an seine Eltern, in dem er erklärte, dass er sich » so schrecklich verantwortlich für ihr Schicksal« fühle. Schlussendlich sollte er später erfahren, dass Augenzeugen beobachteten, wie eines der beiden Besatzungsmitglieder aus dem Flieger ausgestiegen war, sich aber sein Fallschirm nicht öffnete. Der andere war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch an Bord der Maschine ums Leben gekommen.
Mein Vater schrieb auch an die Familien von Delaney und White. Er übermittelte sein Beileid und brachte zum Ausdruck, dass er gerne in der Lage gewesen wäre, mehr für sie zu tun. Delaneys Schwester Mary Jane antwortete ihm. »Sie sagen in Ihrem Brief, dass Sie mir gerne helfen wollen«, schrieb sie. »Nun, da gibt es eine Möglichkeit, und zwar indem Sie aufhören, sich auf irgendeine Weise für den Absturz und das Schicksal Ihrer Männer die Schuld zu geben. Vielleicht würde ich Ihnen ja die Schuld dafür geben, wenn Jack Sie nicht stets als besten Piloten des Geschwaders bezeichnet hätte.«
Doch trotz ihrer Worte fühlte sich Dad weiterhin irgendwie schuldig am Tod seiner Besatzungsmitglieder. Er blieb jahrzehntelang mit ihren Familien in Verbindung. Als er schließlich über 40 Jahre später zum Präsidenten gewählt wurde, lud er die Schwestern Delaneys und Whites zu einem Privatbesuch ins Weiße Haus ein.
Während Dads Interview mit Jenna an seinem 90. Geburtstag, also beinahe 70 Jahre nach dem Abschuss, erkundigte diese sich, ob er immer noch an die Mitglieder seiner Crew denke.
»Ich denke die ganze Zeit an sie«, antwortete er ihr.
MEIN VATER VERBRACHTE ungefähr einen Monat auf der Finback, bevor er sich schließlich wieder seinem Geschwader anschloss. Obwohl er in dieser Zeit nur wenige offizielle Aufgaben zu erfüllen hatte, stürzte er sich kopfüber ins Alltagsleben an Bord des Unterseeboots. Er freundete sich mit der Crew an und brachte dabei so viel wie möglich über den Betrieb des U-Boots in Erfahrung. Unter anderem meldete er sich freiwillig als Zensor der Post, die nach Hause geschickt wurde, um zu vermeiden, dass geheime Informationen preisgegeben wurden. Er las dabei Briefe von Farmerjungs, die sich nach der letzten Ernte erkundigten, sowie einsamen Seemännern, die ihrem Schatz zu Hause ewige Liebe schworen. Die Streitkräfte versorgten ihn jedenfalls mit einer Art von Bildung, die man weder in Andover noch in Yale erwerben konnte.
Zusätzlich fungierte er als freiwillige Wache an Deck der Finback, auch in der Nacht. Jahre später erinnerte er sich noch an diese stillen Momente unter dem schwarzen Nachthimmel mitten im Pazifik als Augenblicke voller Klarheit. Er dachte viel daran, wie dankbar er für seine Familie war. Auch dankte er Gott dafür, dass er ihm geholfen hatte, als er es am nötigsten gehabt hatte. Und er träumte von Barbara, dem Mädchen, das er liebte und heiraten wollte.
Nach seiner Zeit auf der Finback wurde meinem Vater Heimaturlaub angeboten. Obwohl ich mir sicher bin, dass er liebend gerne sowohl Barbara als auch seine Familie gesehen hätte, fühlte er sich jedoch verpflichtet, zu seinem Geschwader zurückzukehren. So ging er Anfang November erneut an Bord der San Jac. Im Dezember erhielten die Männer schließlich einen ganzen Monat Landurlaub.
Lieutenant Bush kam am Weihnachtsabend 1944 am Bahnhof von Rye, New York, an. Als er auf den Bahnsteig trat, sah er die Frau, an die er in den Monaten auf See so oft gedacht hatte. Mutter und Dad hatten eigentlich geplant, erst nach dem Krieg zu heiraten, doch sie hatten dann in den Monaten der Trennung entschieden, es zu tun, sobald er heimkäme. Da alles so kurzfristig über die Bühne ging, mussten sie das Datum der Eheschließung sogar von Hand auf den Einladungen eintragen: 6. Januar 1945.
Als er an seinem 90. Geburtstag gefragt wurde, was der glücklichste Moment seines Lebens gewesen sei, sagte Dad, dass es sich um jenen handele, an dem Mutter und er geheiratet hätten. Die Hochzeit meiner Eltern war typisch für die Kriegszeiten: Mein Dad trug seine blaue Navy-Uniform und Mutter ein weißes Kleid sowie einen Schleier, den ihr Dorothy Walker Bush geliehen hatte. Ein paar der Navy-Kumpels meines Vaters sowie sein Bruder Jonathan machten sich als Platzanweiser nützlich. Sein älterer Bruder Pres, der gerade erst in der Vorwoche geheiratet hatte, war sein Trauzeuge. Mein Vater sagte zu, mit meiner Mutter den ersten Tanz zu tanzen, warnte sie aber vor, dass es das letzte Mal sei, das er dies in der Öffentlichkeit tue. Offenbar hatte er noch keinen Schimmer davon, dass er sehr viel später auf insgesamt zwölf Bällen anlässlich der Vereidigung des Präsidenten tanzen würde.
NACH EINER KURZEN Hochzeitsreise nach Sea Island in Georgia kehrte mein Vater zum Kampfeinsatz zurück. Seine Aufgabe bestand darin, die letzte Phase des Krieges, die Invasion des japanischen Festlandes, mit vorzubereiten. Die Japaner hatten ihre vorgelagerten Inseln erbittert verteidigt, und die Mission versprach, blutig zu werden. Während er sich auf einer Basis in Maine darauf vorbereitete, hörte er am 12. April 1945 im Radio vom Tod Präsident Roosevelts. Obwohl mein Vater mit ein paar der innenpolitischen Entscheidungen Roosevelts, die den Einfluss der US-Regierung dramatisch ausweiteten, nicht konform ging, respektierte er ihn dennoch als seinen obersten Befehlshaber und betrauerte den Verlust der nationalen Leitfigur während einer solch gefahrvollen Zeit.
Vizepräsident Harry Truman wurde noch am selben Tag vereidigt. Da ich selbst zu meiner Zeit als Präsident hinter demselben Schreibtisch wie er saß, kann ich mir ausmalen, wie schwer es gewesen sein muss, so plötzlich zwischen zwei großangelegten militärischen Operationen übernehmen zu müssen und außerdem noch die Verantwortung für das Geheimprogramm bezüglich der Entwicklung einer geheimen Nuklearwaffe zu tragen. Nur wenige Monate später musste er eine der schwierigsten Entscheidungen treffen, mit der sich je ein Präsident konfrontiert sah. Als das massive Bombardement Tokios es nicht schaffte, den japanischen Widerstand zu brechen, erteilte er schließlich den Befehl, Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen. Er wusste, dass der Blutzoll ein entsetzlich hoher sein würde. Doch der Einsatz dieser neuen verheerenden Waffe erstickte auch die Kampfbereitschaft des Feindes und rettete somit viele amerikanische Leben, womöglich auch jenes meines Dads. Jedenfalls verteidigte mein Vater Präsident Trumans Entscheidung stets als mutig und richtig.
Mutter und Dad zogen nach Virginia Beach, wo er stationiert war und auf seinen nächsten Einsatz wartete. Dort war es auch, wo sie schließlich von der Kapitulation Japans erfuhren. Meine Eltern, die anderen Piloten sowie deren Familien stürmten auf die Straße, um gemeinsam zu feiern. Dann begaben sie sich in eine Kirche, wo sie Gott dankten.
Am 2. September 1945, auf den Tag ein Jahr, nachdem mein Vater über Chichi Jima abgeschossen worden war, fand sich die japanische Delegation an Bord der USS Missouri ein, um die die formelle Kapitulation zu unterzeichnen.
Alles in allem verbrachte mein Vater etwas mehr als 1.200 Stunden im Dienste der Navy in der Luft. Er flog 58 Kampfeinsätze und landete insgesamt 126 Mal erfolgreich auf einem Flugzeugträger. Allerdings war es ein anderer Flug, der seiner Familie am meisten in Erinnerung bleiben sollte. Um das Kriegsende zu feiern, zischte er nämlich in seiner Avenger über Walker’s Point hinweg, während seine Lieben am Boden jubelten und schluchzten.
Am 18. September 1945 – drei Jahre und drei Monate nach seinem Eintritt in die Navy an seinem 18. Geburtstag – wurde George H.W. Bush ehrenhaft aus dem Dienst entlassen. Er hatte im Krieg alles gegeben. Er hatte überlebt. Und Amerika hatte gesiegt.
WIE DIE MEISTEN VETERANEN hielt sich auch mein Vater nicht lange damit auf, vom Krieg zu berichten. Er wollte nicht noch einmal die schlimmen Details der Kampfhandlungen durchleben müssen und sah sich selbst auch nicht als Kriegshelden. Ihm zufolge hatte er bloß seine Pflicht getan und wollte nun mit seinem Leben weitermachen. Auch war er der Meinung, dass sein Beitrag im Vergleich zu denjenigen, die ihr Leben gelassen hatten, verblassen würde. Freunde und Familie mit Geschichten über seine eigenen Erfahrungen zu unterhalten, wäre für ihn gewesen, als würde er jene, die das ultimative Opfer gebracht hatten, entehren.
Mutter war hingegen mehr als bereit dazu, Dads Erlebnisse mit mir zu teilen. Sie und ich saßen gemeinsam auf dem Boden und blätterten oft durch die Erinnerungshefte, die sie während seiner Zeit in der Navy angelegt hatte. Dort sah ich etwa Schnappschüsse von seinen Kumpels an Bord der San Jac, Muscheln, die er für Mutter auf wunderschönen Pazifikinseln gesammelt hatte, sowie ein Stück Gummi vom Floß, das ihm das Leben gerettet hatte. Ich bat ihn darum, mir Geschichten zu erzählen, aber er ließ sich nicht erweichen. Ich brauchte Jahre, um zu begreifen, welche Wirkung der Krieg auf sein Leben gehabt hatte.
Der Krieg hatte zur Folge, dass mein Vater und auch viele andere seiner Generation im Schnellverfahren erwachsen werden mussten. Im Alter von 22 Jahren hatte er bereits etliche Schlachten geschlagen und Freunde sterben sehen. Er hatte sein Leben riskiert und es beinahe selbst verloren. Nun wusste er aber auch, dass er mit Druck und Risiko umgehen konnte. Außerdem hatte er die Befriedigung erfahren, die einen erfasst, wenn man sich selbstlos in den Dienst anderer stellt – eine Erfahrung, die ihn sein Leben lang antreiben sollte.
2002 unternahm mein Vater eine Reise zurück an den Ort seines Abschusses. Begleitet wurde er dabei von CNN-Nachrichtensprecherin Paula Zahn sowie dem Historiker James Bradley, dem Autor von Flyboys, einem guten Buch über amerikanische Piloten, die über Chichi Jima abgeschossen wurden. Als er sich der Insel näherte, warf der 78-jährige Mann, der einst der jüngste Pilot der Navy war, zwei Kränze in den Ozean, um seine beiden Besatzungsmitglieder Delaney und White zu ehren. Als er auf der Insel ankam, hatten sich 2.000 Inselbewohner versammelt, um ihn willkommen zu heißen.
Dort traf er außerdem auch auf einen Mann, der als Soldat der japanischen Armee am Tag des Abschusses Dienst auf Chichi Jima tat. Der Mann war persönlich Zeuge geworden, wie amerikanische Piloten, die in Gefangenschaft geraten waren, Opfer von Folter, Hinrichtungen und Kannibalismus wurden. Sein Bruder war in Hiroshima durch die Atombombe ums Leben gekommen, und dennoch hegte er keinen Groll gegen die USA. Ganz im Gegenteil: Die Gräueltaten der japanischen Regierung auf Chichi Jima hatten ihn so erzürnt, dass er sogar den Namen eines der Marines, der auf der Insel exekutiert worden war, angenommen hatte. Er hatte später in der US-Botschaft in Tokio gearbeitet und dabei geholfen, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern.
Als die beiden ehemaligen Feinde beieinanderstanden, ihre Köpfe mit grauen Haaren bedeckt, erzählte der Mann meinem Vater mehr über den Tag, an dem er abgeschossen worden war. Er bestätigte etwa, dass die Japaner Boote geschickt hätten, um meinen Vater gefangen zu nehmen, wobei ihm vermutlich das gleiche abscheuliche Schicksal wie den anderen amerikanischen Gefangenen gedroht hätte. Der Mann beschrieb, wie die Boote von ihrem Vorhaben abkamen, als sie die anderen Avenger-Piloten unter Feuer nahmen. Als sich die Finback schließlich den Geschützen des Feindes preisgab, um meinen Vater an Bord zu ziehen, brachte einer der Kameraden des japanischen Mannes seine Verwunderung zum Ausdruck, dass die Amerikaner so viel Einsatz zeigten, einen einzigen Piloten zu retten. Eines war dem Mann zufolge klar: Ihre eigene Führung hätte das nie für sie getan. Wie sehr sich das doch vom Denken unserer eigenen Nation unterscheidet. Amerika pflegt die stolze Tradition, niemals einen Soldaten auf dem Schlachtfeld zurückzulassen – und so sollte es auch in Zukunft bleiben.
Seit seinen frühesten Tagen war George Bush ein Mann, der Tugendhaftigkeit, Loyalität und Einsatzbereitschaft zu schätzen wusste. Dies waren Eigenschaften, die ihm seine Mutter und sein Vater beigebracht hatten. Und die USA beziehungsweise vor allem ihre Bürger in Uniform verkörpern diese Ideale. Dies war das Land, für dessen Verteidigung mein Vater alles aufs Spiel gesetzt hatte. Und es war das Land, das er eines Tages anführen würde.