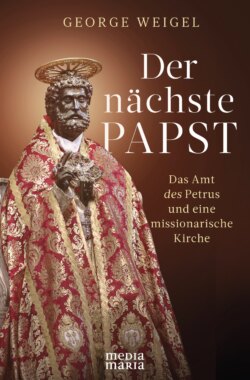Читать книгу Der nächste Papst - George Weigel, George Weigel - Страница 5
Ein kurzer erklärender Hinweis
ОглавлениеIn den vergangenen drei Jahrzehnten hatte ich immer wieder das Privileg, mich ausgiebig mit Papst Johannes Paul II., dem emeritierten Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus unterhalten zu dürfen. Die Überlegungen in diesem Buch fußen auf dem, was ich aus diesen Begegnungen – und in vielen Jahren der Interaktion mit Katholiken auf allen Kontinenten, die die unterschiedlichsten Positionen in der Kirche innehatten – gelernt habe.
Mit dem, was nun folgt, begleiche ich also lediglich einen Teil einer großen Schuld.
Die katholische Kirche ist zu allen Zeiten dieselbe, wie der heilige Paulus uns in Epheser 4,5 ins Gedächtnis ruft: Sie dient demselben Herrn, ist auf demselben Glauben und derselben Taufe gegründet. Nicht gleich bleibt hingegen die katholische Art und Weise des Kircheseins: Sie ändert sich, um den Anforderungen gerecht zu werden, die die Aufgabe, Christi Heilssendung in der Welt fortzusetzen, mit sich bringt. Fünf epochale Übergänge hat es in der Geschichte des Christentums gegeben. Einer davon bahnt sich gerade an.
Bei dem ersten dieser großen Übergänge trennte sich die frühe Kirche, wie wir sie nennen, endgültig von dem, was später als das rabbinische Judentum bekannt werden sollte, in einem Prozess, der nach dem ersten jüdischrömischen Krieg 70 n. Chr. an Fahrt aufnahm. Diese frühe Kirche brachte das patristische Christentum hervor und wurde von diesem abgelöst. Es entwickelte sich im vierten Jahrhundert und wurde durch die Begegnung der Kirche mit der klassischen Kultur beeinflusst. Das patristische Christentum seinerseits brachte gegen Ende des ersten Jahrtausends das Christentum des Mittelalters hervor und wurde von diesem abgelöst: der engsten Verbindung aus Kirche, Kultur und Gesellschaft, die es je gab. Das Christentum des Mittelalters brach in den verschiedenen Reformationen des 16. Jahrhunderts auseinander und aus dieser Umwälzung ging der gegenreformatorische Katholizismus hervor: die Art des Kircheseins, mit der jeder Katholik, der vor Mitte der 1950er-Jahre geboren wurde, aufgewachsen ist.
Gegen Ende des zweiten Jahrtausends schließlich nahm der fünfte große Übergang in der Weltkirche seinen Aufschwung: vom gegenreformatorischen Katholizismus zur Kirche der Neuevangelisierung. Die Katholiken der heutigen Zeit leben inmitten der Turbulenzen dieser Übergangszeit.
Im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hat dieser fünfte epochale Übergang der katholischen Kirche einen kritischen Punkt erreicht. Denn die drei Päpste, die ich persönlich kennengelernt und deren Ausübung des Petrusamtes ich aus nächster Nähe verfolgt habe, waren allesamt auf die eine oder andere Weise Männer des Zweiten Vatikanischen Konzils: jenes Ereignisses also, das den Übergang vom gegenreformatorischen Katholizismus zur Kirche der Neuevangelisierung erst so richtig angekurbelt hat. Der nächste Papst jedoch wird nicht in derselben Weise wie seine drei Vorgänger auf dem Stuhl des heiligen Petrus vom II. Vatikanum geprägt sein.
Karol Wojtyła (der spätere Papst Johannes Paul II.) nahm als noch sehr junger polnischer Bischof und späterer Erzbischof von Krakau in allen vier Sitzungsperioden des Konzils eine aktive Rolle ein und war am Entwurf der Pastoralkonstitution über die Kirche in der modernen Welt Gaudium et spes beteiligt. Joseph Ratzinger (der spätere Papst Benedikt XVI.) trug als junger Peritus oder theologischer Experte des II. Vatikanums maßgeblich zur Ausarbeitung von fünf Konzilstexten einschließlich der Dogmatischen Konstitutionen über die Kirche und über die göttliche Offenbarung bei. Die päpstlichen Programme Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. waren zutiefst von ihren Erfahrungen mit dem II. Vatikanum und seiner Rezeption in der Weltkirche beeinflusst. Ja, man kann ihre Pontifikate sogar als ein einziges, 35 Jahre andauerndes Bemühen deuten, eine offizielle Lesart des Konzils verbindlich festzuschreiben. Dreh- und Angelpunkt dieses Bemühens war die Außerordentliche Bischofssynode von 1985, die die Erklärung zur Interpretation der sechzehn Dokumente des II. Vatikanums im Konzept einer Kirche als missionarischer Gemeinschaft von Jüngern fand. Dieser Kernbegriff führte schließlich zur Proklamation der Neuevangelisierung im Vorfeld und während des Heiligen Jahres 2000 und zu dem 2007 von den Bischöfen Lateinamerikas und der Karibik veröffentlichten Dokument von Aparecida, das vielleicht die ausgereifteste Beschreibung dessen darstellt, wie eine missionarische Gemeinschaft von Jüngern aussehen sollte.
Anders als seine beiden päpstlichen Vorgänger hat Jorge Mario Bergoglio (der spätere Papst Franziskus) das Zweite Vatikanische Konzil zwar nicht direkt miterlebt, war jedoch während des Konzils bereits ein junges Mitglied der Gesellschaft Jesu und in der Zeit der hitzigen Debatten gleich nach dem II. Vatikanum ein Oberer seines Ordens. Als Erzbischof von Buenos Aires war er maßgeblich am Entwurf des Dokuments von Aparecida beteiligt. Und als Papst hat Franziskus Papst Paul VI. (der drei der vier Sitzungsperioden des II. Vatikanums geleitet hat) als sein päpstliches Vorbild bezeichnet und mit Papst Paul VI. und Papst Johannes XXIII. beide Konzilspäpste heiliggesprochen. Auch Papst Franziskus ist also maßgeblich vom Konzil geprägt.
Der nächste Papst wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den Jahren des II. Vatikanums ein Teenager oder ein sehr junger Mann gewesen sein; vielleicht sogar noch ein Kind. Jedenfalls werden ihn die Erfahrung des Konzils und die unmittelbar daran anschließenden Debatten über seine Bedeutung und Rezeption nicht so nachhaltig beeinflusst haben wie Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus. Somit wird der nächste Pontifex in einem anderen Sinne ein Übergangspapst sein als seine unmittelbaren Vorgänger. Und deshalb scheint es angemessen, jetzt darüber nachzudenken, was die Kirche aus ihren Erfahrungen mit den Pontifikaten dieser drei vom Konzil geprägten Päpste gelernt hat – und was der nächste Papst davon beherzigen sollte.
Die katholische Kirche wird im nächsten Pontifikat ein noch unerforschtes Gelände betreten. Deshalb ist es wichtig, jetzt über zwei Fragen nachzudenken:
Was will der Heilige Geist eine Kirche im Übergang lehren?
Welche Eigenschaften wird der Mann brauchen, der – als Nachfolger des heiligen Petrus, dem »die Schlüssel des Himmelreichs« gegeben sind (Mt 16,19) – die Ehrfurcht gebietende Verantwortung und große Last des päpstlichen Dienstamtes trägt, um die Kirche durch diesen Übergang hindurchzuführen?