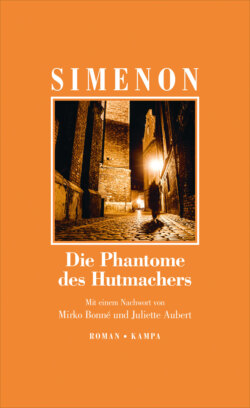Читать книгу Die Phantome des Hutmachers - Georges Simenon - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAls er ankam vor seinen Fensterläden, die Valentin zugemacht hatte, blieb er stehen und knöpfte sich den Mantel auf, um den Schlüsselbund aus der Hosentasche zu holen. Er machte stets die gleichen Bewegungen, wenn er abends nach Haus kam. Jemand war an der Ecke zur Rue du Minage stehen geblieben. Es war Kachoudas, der darauf wartete, dass die Tür des Hutmachers sich wieder schloss, ehe er seinerseits nach Haus ging.
Monsieur Labbé hob den Blick und bemerkte in der Werkstatt im ersten Stock die Frau des Schneiders. Ein wenig beunruhigt, hatte sie soeben einen Blick aus dem Fenster geworfen.
Er drehte den Schlüssel im Schloss, trat in die warme Dunkelheit, schloss die Tür wieder, ehe er den Lichtschalter drehte und die Querstange vorlegte; dann blieb er stehen, das Gesicht gegen einen Spalt im Fensterladen gepresst.
Endlich kam der kleine Schneider, vorsichtshalber immer noch in der Straßenmitte, auf Höhe seines Hauses an. Er ging komisch, irgendwie ruckartig … Zum ersten Mal fiel Monsieur Labbé auf, dass er ein Bein nach außen hin nachzog. Auch Kachoudas blickte nach oben, doch war seine Frau gerade zurück in die Küche gegangen. Er platzte in sein Geschäft, aus dem er aber noch mal zurück auf die Straße musste, um die Läden vorzulegen, denn er hatte keinen Gehilfen, der das an seiner Stelle machte. Alle seine Bewegungen waren nervös, abgehackt. Zur Treppe gewandt – der gleichen Wendeltreppe wie in der Hutmacherei –, hatte er wohl gerufen:
»Ich bin’s!«
Er beeilte sich, verriegelte die Tür. Das Licht im Erdgeschoss ging aus und kurz darauf in der Werkstatt an, wo der kleine Schneider gar nicht schnell genug aus dem Fenster sehen konnte.
Monsieur Labbé zog sich zurück von seinem Beobachtungsposten, legte den Rest von dem Geld, das er mitgenommen hatte, zurück in die Kassenschublade, ging in das Hinterzimmer und fingerte dort einen Moment lang an einem Gegenstand herum, den er aus der Tasche gezogen hatte und der einem Spielzeug ähnelte, zusammengebastelt von irgendeinem Straßenjungen: zwei durch eine Art Schnur miteinander verbundene Holzstücke.
Noch immer hatte er seinen durchnässten Mantel an, und als er sich vorbeugte, tropfte es von seinem Hut. Er nahm ihn erst ab am Fuß der Treppe, wo ein Kleiderständer war und wo er unter der Küchentür einen Lichtstreifen sah.
Der Tisch war gedeckt, mit einem einzelnen Teller und Besteck, einer weißen Decke, einer Flasche Wein, in der ein Korken mit silberner Kappe steckte.
»Guten Abend, Louise. Madame hat nicht gerufen?«
»Nein, Monsieur.«
Das Hausmädchen blickte auf seine Füße, während er sich vor den Ofen setzte, kam mit Pantoffeln in der Hand und kniete sich hin. Nie hatte er sie dazu aufgefordert. Bestimmt war sie auf dem Bauernhof dazu abgerichtet worden, den Männern die Schuhe auszuziehen, ihrem Vater und ihren Brüdern, sobald die vom Feld zurückkamen.
Es war genauso warm wie im Laden, die Luft stand, war ebenso drückend, fasste die Gegenstände ein und verlieh ihnen ein starres, unabänderliches Aussehen.
Hinter dem Fenster, das auf den Hof ging, war immer noch der Regen zu hören, und hier war es eine alte Uhr in ihrem Kasten aus Nussbaum, die eine kupferne Scheibe hin und zurück bewegte, langsamer, hätte man schwören können, als überall sonst. Die angezeigte Zeit war nicht dieselbe wie in der Hutmacherei, weder auf Monsieur Labbés Uhr noch auf dem Wecker im ersten Stock.
»Ist niemand vorbeigekommen?«
»Nein, Monsieur.«
Sie zog ihm seine Pantoffeln aus feinem Ziegenlackleder an. Der Raum war eher ein Esszimmer als eine Küche, denn Herd und Spüle waren nebenan, in einer schmalen Abseite. Der Tisch war rund, die lederbezogenen Stühle mit Nägeln beschlagen. Es gab viel Kupfergeschirr und, auf einer Bauernanrichte, alte, in Auktionslokalen erstandene Fayencen.
»Ich geh nach oben und sehe nach, ob Madame etwas braucht.«
»Kann ich die Suppe servieren?«
Er verschwand auf der Wendeltreppe, und sie hörte oben im Ersten die Tür aufgehen, Schritte, ein Murmeln, das Geräusch der Rollen des Sessels, der durchs Zimmer geschoben wurde, so wie jeden Abend. Als er wieder nach unten kam, sagte er, indem er sich an den Tisch setzte:
»Sie möchte nur ein bisschen. Was gibt es zu essen?«
Er hatte sein Buch vor sich hingelegt, seine Hornbrille aus ihrem Etui genommen. Der Ofen wärmte ihm den Rücken. Er ließ sich Zeit beim Essen. Louise trug ihm auf, und zwischen den Gängen wartete sie, den Blick leer, reglos in ihrer schmalen Abseite.
Sie war noch keine zwanzig. Ziemlich dick und sehr dumm war sie, ausdruckslos glotzten ihre Froschaugen vor sich hin.
Das Kabuff, das als Küche diente, war nicht breit genug, um einen Tisch hineinzustellen. Manchmal aß sie dort im Stehen, manchmal wartete sie, bis der Hutmacher fertig und gegangen war, und setzte sich auf seinen Platz.
Er konnte sie nicht ausstehen. Sie einzustellen war ein schlechtes Geschäft für ihn gewesen, aber es war noch genug Zeit, später darüber nachzudenken.
Um Viertel vor acht wischte er sich den Mund ab, schob seine zusammengerollte Serviette in den Silberring, steckte den Korken zurück in seine Flasche, von der er bloß ein Glas getrunken hatte, und stand seufzend auf.
»Ist fertig«, sagte sie.
Daraufhin nahm er das Tablett, auf dem ein weiteres Abendessen angerichtet war, und ging erneut zur Treppe. Wie oft am Tag ging er sie hinauf, diese Treppe?
Das Schwierige war, mit der einen Hand das Tablett zu halten, ohne etwas zu verschütten, während die andere den Schlüssel aus der Tasche holte und im Schloss drehte, denn diese Tür war immer verschlossen, selbst wenn er im Haus war. Er drehte den Lichtschalter, sodass von gegenüber Kachoudas das Rollo hell werden sah. Er stellte das Tablett ab, immer an denselben Platz, und schloss hinter sich die Tür wieder ab.
Alles das war sehr kompliziert. Es sich einspielen zu lassen hatte Zeit gekostet. Das Kommen und Gehen des Hutmachers folgte einer präzisen Ordnung, die enorme Bedeutung besaß.
Zunächst musste gesprochen werden. Er machte sich nicht immer die Mühe, die Wörter deutlich auszusprechen, denn unten kam davon ohnehin nur wirres Gemurmel an. Heute zum Beispiel sagte er immer wieder mit gewisser Befriedigung:
»Du würdest einen Fehler begehen, Kachoudas!«
Es gab diesen Abend kein besonders gutes Essen, er nahm sich aber trotzdem das zarteste Stück Kalbskotelett. Es gab Tage, da aß er auch das zweite Abendessen ganz auf.
Er trat ans Fenster. Er hatte Zeit. Er schob das Rollo etwas beiseite und bemerkte den kleinen Schneider, der mit dem Essen schon fertig war und wieder Platz nahm auf seinem Tisch, während die Mädchen in der Stube auf dem Boden spielten und die Älteste zusammen mit ihrer Mutter bestimmt das Geschirr abwusch.
Mit lauter Stimme sagte er, indem er zu dem Tablett zurückging:
»Hast du gut gegessen? Bestens.«
Und daraufhin leerte er die Teller – bis auf den Kotelettknochen – in die Toilette, wobei er darauf achtete, nicht die Spülung zu betätigen. Zuerst hatte er das noch gemacht, aber das war ein Fehler gewesen. So wie diesen hatte es eine Menge Fehler und Unvorsichtigkeiten gegeben, die er nach und nach korrigiert hatte.
Mit den leeren Tellern ging er wieder nach unten, wo Louise auf seinem Platz zu Abend aß. Um nicht so viel Geschirr spülen zu müssen, nutzte sie zum Essen den Teller und zum Trinken das Glas ihrer Herrschaft. Sie las während des Essens, sie genauso, allerdings Groschenheftchen.
»Sie gehen nicht raus, Louise?«
»Hab keine Lust, mich erwürgen zu lassen.«
»Gute Nacht.«
»Guten Abend, Monsieur.«
Es war fast geschafft. Noch ein paar tagtägliche Verrichtungen waren auszuführen: sich vergewissern gehen, dass die Ladentür gut abgeschlossen war, das Licht ausmachen, noch einmal die Treppe hinaufsteigen, den Schlüssel aus der Tasche holen, aufmachen, zumachen.
Nachher würde Louise raufgehen, um sich im Hinterzimmer schlafen zu legen, und er für eine gute Viertelstunde noch ihre schweren Schritte hören, bis der Bettrost kreischte unter ihrem Gewicht.
»Ein Kalb ist das!«
Er hatte das Recht, die Stimme zu erheben. Von Zeit zu Zeit war das fast eine Notwendigkeit. Er konnte jetzt ebenso die Toilettenspülung ziehen, sich des Kragens, der Krawatte, des Jacketts entledigen, seinen braunen Morgenmantel überziehen. Nur war er ja noch nicht ganz fertig mit allem, denn es blieben drei, vier Scheite im Kamin nachzulegen.
Louise war es, die sie morgens nach oben schaffte und stapelte auf dem Treppenabsatz im ersten Stock.
Alle Häuser in der Straße hatten das gleiche Alter, sie stammten aus der Zeit Ludwigs XIII. Von außen waren sie mit ihren Arkaden und ihrem steil abfallenden Dach gleich geblieben, im Lauf der Jahrhunderte aber hatte jedes im Inneren diverse Veränderungen erfahren. Über dem Kopf von Monsieur Labbé beispielsweise existierte ein zweites Stockwerk, das man allerdings nur über die Straße erreichte. Neben dem Geschäft war eine Tür zu einem schmalen Gang, der zum Innenhof führte. Und dort fing die Treppe an, die in den zweiten Stock führte, ohne aber mit dem ersten irgendwie in Verbindung zu stehen.
Früher, als dort oben noch Mieter wohnten, war das praktisch gewesen. Die Zimmer standen seit Langem jedoch leer, nämlich seit dem ersten Jahr der Erkrankung von Mathilde, die es nicht aushielt, den ganzen Tag lang Schritte über sich zu hören.
Einen Prozess hatte man anstrengen müssen, um die Leute aus dem Zweiten loszuwerden. Und noch viel größere Schwierigkeiten als das hatte es gegeben!
Vergaß er auch nichts? Die Scheite brannten. Die Rollos waren ordentlich zu. Das Deckenlicht, es war ihm eh zu grell, konnte er noch löschen, anlassen nur die Lampe, die auf dem Sekretär stand, denn zu allen Zeiten schon war in einer Ecke dort ein kleiner Sekretär gewesen, voll mit winzig kleinen Schubladen, und jetzt war das ganz praktisch.
Er nahm den Packen Zeitungen, die Schere, stopfte seine alte Meerschaumpfeife. Zwei-, dreimal drehte er sich zum Fenster und dachte an Kachoudas.
»Armer Kerl!«
Anfangs war die Verfertigung der Briefe eine Geduldsarbeit gewesen, denn da hatte er ja jeden Buchstaben noch einzeln ausgeschnitten. Inzwischen kannte er die Zeitung so gut, dass er wusste, in welcher Rubrik er sich fast sicher sein konnte, die benötigten Wörter zu finden. In Mathildes Nähkorb hatte er außerdem eine Stickschere ergattert, die keine unsauberen Stellen hinterließ.
Die Sechste ist tot, junger Mann, und wieder wird die Stadt ihr Los beklagen.
Es war ihm zur Gewohnheit geworden, sich unmittelbar an Jeantet zu wenden.
Bedenken Sie, dass Mademoiselle Mollard seit mehreren Jahren an einer Herzkrankheit litt, dass sie arm war, dass sie allein lebte, dass sie keinen hatte, der sie gepflegt hätte, und dass sie gezwungen war, den Kindern ihrer Freundinnen Klavierunterricht zu geben. Ihr Schwager, der Architekt, der beileibe genug verdient, hat sich ja immer geweigert, ihr unter die Arme zu greifen.
Natürlich habe ich sie nicht deswegen umgebracht. Ich habe sie umgebracht, so wie die anderen, weil es sein musste. Aber das will keiner begreifen. Wieder wird man sagen und schreiben, ich sei ein Verrückter, ein Wahnsinniger, ein Sadist, ein Besessener, aber das stimmt nicht.
Ich tue, was ich tun muss, und damit basta. Würde man sich davon überzeugen, vermiede man diese stupide Panik, die die Leute davon abhält, aus dem Haus zu gehen, und die allen Handel in Mitleidenschaft zieht.
Vorausgesetzt, niemand begeht eine Dummheit, steht nur noch eine auf der Liste. Genau sieben werden es sein, und daran werden alle Ermittlungen der Welt nichts ändern.
Zum Beweis, junger Mann, kündige ich Ihnen schon jetzt an, dass es am Montag sein wird.
Die Adresse war einfach zusammenzusetzen, denn hierzu genügte es, Jeantets Namen unter einem Artikel sowie die über den Kleinanzeigen abgedruckte Adresse des Verlags auszuschneiden.
Louise war eben in ihr Zimmer gekommen und schnaubte wie üblich.
Monsieur Labbé klebte den Brief zu, pappte eine Marke darauf und steckte den Umschlag in die Tasche seines Jacketts, das auf einem Bügel hing. Nachdem er morgen früh die Platten von den Fenstern genommen hatte, würde er warten, bis Valentin kam, und dann seine gewohnte Runde durch die Stadt drehen, regnete es oder regnete es nicht.
Was er so verblüffend fand, war, dass er nichts an seinen Gewohnheiten hatte ändern müssen. Immer schon war er am Morgen durchs Viertel spaziert, herum um ein oder zwei Häuserblocks, so wie er sich am Abend stets ins Café des Colonnes begeben hatte.
Es war halb zehn. Er hatte noch eine gute Stunde, deshalb setzte er sich mit dem Gesicht zum Feuer, die Beine ausgestreckt, einen Wälzer mit angegilbten Seiten auf den Knien.
Es war einer der Bände der Berühmten Fälle des 19. Jahrhunderts. Vor fünf Monaten hatte er im Auktionslokal zwanzig Einzelbände ersteigert. Sieben davon blieben ihm noch zu lesen.
Er paffte in kurzen Zügen. Es war warm. Louise war wohl endlich eingeschlafen. Er hörte nichts mehr außer dem monotonen Geräusch des Regens, manchmal einem Prasseln der Scheite, und es gab auch niemanden, der ihn bei seiner Lektüre störte.
Monsieur Labbé war ruhig, ja gelassen. Von Zeit zu Zeit warf er einen Blick auf den Wecker.
»Noch zwanzig Minuten!«
Noch zehn. Noch fünf. Um halb elf klappte er seufzend sein Buch zu, erhob sich und ging ins Badezimmer. Um Viertel vor elf legte er sich im rechten Bett schlafen.
Früher hatte nur ein einziges Bett in dem Zimmer gestanden, ein sehr schönes Bett, das zu den anderen Möbeln im Raum gepasst hatte. Nach Mathildes Erkrankung hatte man es über die Straße – es gab ja keine Treppe zwischen den beiden Stockwerken – in die obere, leerstehende Wohnung getragen und es durch zwei von einem Nachttisch getrennte Betten ersetzt.
Er drehte sich um und versicherte sich, dass die noch rote Glut im Kamin nicht auf den Teppich fallen und ihn in Brand setzen konnte.
Gegenüber arbeitete Kachoudas immer noch. Er war ein armer Schlucker. Er machte alles selbst, einschließlich der Unterhosen und der Westen, die die wichtigeren Schneider Heimarbeiterinnen anvertrauten.
Jetzt, da das Zimmer im Dunkeln lag, konnte Monsieur Labbé durch das Rollo hindurch das helle Rechteck auf der anderen Straßenseite sehen.
Ehe er einschlief, sagte er halblaut, denn etwas zu sagen war immer gut:
»Gute Nacht, Kachoudas.«
Seinetwegen brauchte der Wecker nicht zu läuten; er wachte um halb sechs in der Früh von selbst auf. Die dicke Louise schlief noch, vergraben in ihrem feuchten Bett; mit Sicherheit hörte sie ihn, wenn er aufstand, vom Treppenabsatz Scheite holte, die Tür wieder schloss, sich ein Feuer anmachte. Einen Augenblick später an diesem Morgen fiel ihm auf, dass etwas fehlte, und das war das Geprassel des Regens, das Geräusch des Wassers in der Dachrinne. Noch war es zu dunkel, den Himmel zu sehen, aber man ahnte den Seewind, der die Wolken ins Landesinnere jagte.
Er musste sein Bett machen, das Zimmer aufräumen, den Kübel mit der Kaminasche nach draußen stellen – für alles das verfügte er über präzise Bewegungen, die er in einer minutiös einstudierten Abfolge ausführte.
Er redete ein bisschen vor sich hin, sagte irgendwas, sah bald schon das Fenster gegenüber hell werden. Das war nicht Kachoudas, der schlief noch, aber dessen Frau, die im Haus für Feuer sorgte, die Werkstatt fegte, Staub wischte.
Er hörte Karren vorbeifahren, die unterwegs waren zum Markt, dann andere, die unten in der Straße haltmachten, die Stimmen der Bäuerinnen, das Aufprallen der Körbe und Säcke, die man auf den Boden fallen ließ.
Es war Samstag. Er nahm sein Bad, zog sich an, während sich unmittelbar hinter der Waschraumwand Louise wusch.
Sie ging als Erste nach unten, um Kaffee zu machen und damit das Feuer brannte, wenn er seinerseits hinunterging.
»Guten Morgen, Louise.«
»Guten Morgen, Monsieur.«
In der Hutmacherei steckte er ein Streichholz in das kleine Loch im Gasofen. Die Straßengeräusche wurden lauter, doch es war noch nicht Zeit, die Fensterplatten abzunehmen.
Zunächst hatte er sein Frühstück zu sich zu nehmen, dann Mathilde das ihrige nach oben zu bringen. Der Himmel fing an blass zu werden. Monsieur Labbé rollte den Sessel, den er stets im selben Winkel an denselben Platz stellte, bis ans Fenster, wo er sicherging, dass der Holzkopf aus dem Hinterzimmer seines Ladens nicht runterfallen konnte.
Licht ausmachen. Rollo hochziehen. Alles war grau, fast weiß. Der Regen war zu Nebel geworden, sodass man Kachoudas’ Lampe nur durch einen Schleier sah.
Die Fensterscheiben waren beschlagen. Würde es endlich Frost geben? Die Bäuerinnen auf der Straße, dick in Tücher eingemummelt, hielten beim Aufstellen ihrer Körbe ab und an inne, um sich mit blau angelaufenen Händen unter die Achseln zu klopfen. Es war eine darunter, eine kleine Alte, die stellte sich seit vierzig Jahren an denselben Platz und hatte einen Kohlenofen angezündet. Zu dieser Jahreszeit verkaufte sie Kastanien und Nüsse.
Kachoudas hatte noch nicht Platz auf seinem Tisch genommen. Die Tür zur Küche stand offen, und die ganze Familie war dabei zu frühstücken. Madame Kachoudas war weder gewaschen noch frisiert. Die kleinste der Blagen, der einzige Junge, hatte große schwarze, mandelförmige Augen und immer noch sein Nachthemd an.
Es waren komische Leute. Sie aßen schon morgens Wurst. Kachoudas wandte ihm den Rücken zu, eine Schulter höher als die andere.
Monsieur Labbé würde auf ihn warten. Er hatte immer dies oder das zu tun. Die Zeitungen, aus denen er die Wörter und Buchstaben ausgeschnitten hatte, waren schon verbrannt. Er brachte Louise seinen Anzug vom Vortag, damit sie ihn aufbügelte, schließlich war er äußerst gepflegt, seine Kleidung stets aus feinem Tuch, seine Schuhe maßgefertigt.
Es hatte angefangen mit dem Gerumpel von ein paar Karren und mit vereinzelten Stimmen, und jetzt war es vom einen Ende der Straße bis zum anderen angeschwollen zum ohrenbetäubenden Radau jeden Samstags. Schon im Voraus wusste er, welcher Geruch nach frischem Gemüse, nach befeuchtetem Kohl, nach Hühnern und Kaninchen ihm in die Nase stiege, sobald er die Tür zum Laden öffnete.
Eine ganze Weile musste er noch warten, das Auge am Spalt, bis Kachoudas endlich aus dem Haus kam und er es ihm nachmachte und über die Köpfe der Frauen hinweg rief:
»Guten Morgen, Kachoudas.«
Die dürren Schultern zuckten, der Mann drehte sich um, öffnete den Mund, brauchte einige Sekunden, ehe er hervorbrachte:
»Guten Morgen, Monsieur Labbé.«
Für ihn musste das unfassbar sein, fast eine Halluzination – nicht zuletzt wohl aufgrund des Nebels. Alles ging wie jeden Morgen vonstatten, jedenfalls wie an jedem anderen Samstag: Der Hutmacher war frisch rasiert, sorgfältig gekleidet, würdevoll entfernte er von seinem Auslagefenster die Tafeln, die er eine nach der anderen hineinbrachte in die dafür zurechtgezimmerte Nische hinter der Tür.
Das Pflaster war noch nass, das Wasser stand in Pfützen entlang der Trottoirs. Die Metzgerei neben Kachoudas ließ das Licht an.
Valentin kam um halb neun, mit roter Nase, und musste sich schnäuzen, kaum dass er im Laden war.
»Hab mir einen kleinen Schnupfen geholt«, sagte er.
In der ohnehin überhitzten Luft der Hutmacherei würde er ihn großziehen können. Monsieur Labbé zog seinen Mantel an, nahm seinen Hut.
»Ich bin in einer Viertelstunde zurück.«
Er ging Richtung Markthalle und wurde von vielen gegrüßt, denn er stammte aus La Rochelle, wo er auch immer gelebt hatte. Er wählte den Briefkasten in der Rue des Merciers – in dem Hin und Her der ganzen Leute lief er an diesem Morgen keine Gefahr, bemerkt zu werden. Dann, so wie er es samstags gerne tat, tauchte er ein in das Getümmel der Markthalle, schlenderte vorbei an den Ständen für Fisch und Krustentiere.
Erst auf dem Heimweg kaufte er sich an der Ecke zu seiner Straße die Zeitung und steckte sie sich in die Tasche, ohne allzu neugierig einen Blick darauf zu werfen.
Eine Bäuerin hatte ihren Sohn mitgebracht, dem Valentin, Taschentuch in der Hand, Mützen anprobierte. Es war der Tag dafür. Monsieur Labbé ging Mantel und Hut ablegen, sagte durch den Türspalt zu Louise:
»Kaufen Sie Langusten. Die kleine Alte aus Charron hat schöne. Madame hat nicht gerufen?«
»Nein, Monsieur.«
Er würde unten zuerst seinen Anteil Langusten essen, dann Mathildes im Zimmer. Es war ein Glück, dass die frühere Haushälterin, Delphine, zu ihrer Tochter auf die Île d’Oléron gezogen war, wusste doch Delphine, die zwanzig Jahre lang bei ihnen gearbeitet hatte, dass Mathilde nichts mochte, was aus dem Meer kam.
Er hätte es besser treffen können als mit Louise. Eine ganze Menge hätte sich angenehmer einrichten lassen. Ja, er fing an, das dicke Mädchen zu hassen. Nie fragte sie etwas. Man hatte keinen Schimmer, was sie dachte. Dachte sie womöglich gar nicht?
Er mochte es nicht, dass sie im Haus schlief. Delphine, die Kinder hatte, war sofort nach dem Abendessen nach Hause gelaufen auf die andere Bahnhofseite. Anfangs hatte auch Louise in der Stadt geschlafen. Dann hatte sie jedoch erklärt, wegen der Morde an den alten Frauen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr das Haus verlassen zu wollen.
Wieso hatte er es akzeptiert, ihr im Ersten ein Zimmer herzurichten? Hatte er da noch vielleicht so eine vage Vorstellung im Hinterkopf gehabt? Wenn man nicht allzu genau hinguckte, war sie ganz appetitlich. Jetzt aber, da er durch die Trennwand hindurch hörte, wie sie ihre Toilette verrichtete, konnte er nicht darüber hinwegsehen, dass sie ungepflegt war. War er mal in ihr Zimmer gegangen, so hatte ihn der Geruch dort angeekelt, genauso wie die auf einem Stuhl herumliegende Wäsche.
Wahrscheinlich war sie nicht gefährlich, sie stellte aber trotzdem eine Komplikation dar, und um Komplikationen zu umgehen, hatte er schon genug getan.
Man würde da schon sehen.
Er wechselte das Jackett – zum Arbeiten trug er stets ein altes –, ging ins Hinterzimmer und zündete den Kocher an, den er zum Dämpfen der Hüte nutzte.
Mit dem kleinsten Schlüssel an seinem Bund schloss er einen Wandschrank auf. Von allergrößter Bedeutung waren diese Schlüssel, glatt waren sie, glänzten wie Werkzeuge, immer trug er sie in derselben Tasche, und nie vergaß er, sie auf den Nachttisch zu legen, ehe er ins Bett ging.
Ganz hinten in dem Schränkchen hing eine Kordel von der Decke, an der er zwei-, dreimal kurz zog.
Valentin, noch immer mit der Kundin und dem kleinen Jungen beschäftigt, machte ein paar Schritte, um ihm mitzuteilen:
»Madame ruft nach Ihnen, Monsieur Labbé.«
Denn indem er an der Kordel zog, setzte er einen Mechanismus in Gang, der im ersten Stock auf den Fußboden klopfte, genau wie früher, als Mathilde, wenn sie ihn brauchte, mit dem Stock auf den Fußboden geklopft hatte.
»Ich geh schon«, verkündete er seufzend.
Das Schränkchen wieder zumachen, die Schlüssel zurück in die Tasche stecken. Merkwürdig: In Kachoudas’ Geschäft war der kleine Schneider damit beschäftigt, Maß zu nehmen bei einem kleinen Jungen, den seine Mutter mitgebracht hatte. Ein kleiner Junge und eine Mutter auf jeder Straßenseite und, noch merkwürdiger, aus demselben Dorf.
Labbé verschwand auf der Wendeltreppe, wo Valentin seine Schritte hören konnte. Die Tür ging auf und wieder zu. Die Vorhänge verhinderten, dass man hereinsah. In ihrer Küche war Madame Kachoudas, die nie an die Nachbarn von gegenüber dachte, mit in die Luft gereckten Armen dabei, ein Kleid über ihr Unterkleid zu streifen, denn um es wärmer zu haben, zogen sich diese Leutchen in der Küche an und wuschen sich dort sogar. Für die Mädchen und den Jungen stellte man eine Emailleschüssel auf einen Stuhl.
Er legte ein weiteres Holzscheit auf das Feuer, setzte sich, zündete seine Pfeife an, und erst dann schlug er die Zeitung auf.
Der Würger hat ein neues Opfer gefunden.
Ist es nicht seltsam, festzustellen, wie die Wörter die Realität verzerren? Der WÜRGER! Und das zu allem Überfluss in Großbuchstaben! Als würde man, zum Beispiel, als Würger geboren. Als wäre es, kurz gesagt, eine Berufung! Nur dass die Wahrheit so ganz anders aussah! Immer machte ihn das ein bisschen ärgerlich. Und dieser Ärger hatte ihn sogar dazu gebracht, der Zeitung den ersten Brief zu schreiben. Seinerzeit hatte es geheißen:
Ein gefährlicher Verrückter irrt in der Stadt umher.
Er hatte erwidert:
Nein, Monsieur, einen Verrückten gibt es nicht. Sprechen Sie nicht von etwas, das Sie nicht kennen.
Trotzdem, der kleine Jeantet war nicht dumm. Während die Polizei die Stadtstreicher und die Matrosen auf Kneipentour einsammelte, auf gut Glück Leute auf der Straße anhielt und nach ihren Papieren verlangte, trug der Reporter eine Beweisführung zusammen, die etwas für sich hatte. Nach dem dritten Opfer, Mademoiselle Lange, der Kurzwarenhändlerin aus der Rue Saint-Yon, und nachdem die Überwachung bereits mit Anbruch der Dunkelheit eingesetzt hatte, schrieb er:
Es ist falsch, sich mit Herumtreibern und, ganz allgemein gesprochen, mit all denen zu befassen, die durch ihr Äußeres oder ihr Auftreten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Mörder ist zwangsläufig ein Mann, der nicht groß auffällt. Er ist also kein Fremder, wie manche vermutet haben. Wenn man bedenkt, dass seine drei Verbrechen einiges an Lauferei nötig gemacht haben, ist es mehr als wahrscheinlich, dass er zumindest ein Mal einer der Freiwilligenpatrouillen begegnet ist, die jeden Abend die Stadt durchkämmen.
Das stimmte. Der Hutmacher war einer Patrouille begegnet und hatte seelenruhig seinen Weg fortgesetzt. Man richtete das Strahlenbündel einer Taschenlampe auf ihn, und eine Stimme sagte:
»Guten Abend, Monsieur Labbé.«
»Guten Abend, meine Herren!«
Einzig ein bekannter und angesehener Bürger konnte …
Er ging in seinen Schlussfolgerungen sehr viel weiter, der Jüngling, den man jeden Abend am ersten Tisch des Café des Colonnes schreiben sah:
… Die Tatzeiten weisen darauf hin, dass es ein verheirateter Mann ist, mit festen Gewohnheiten …
Er gründete diese Annahme auf die Tatsache, dass keines der Verbrechen nach der Abendessenszeit verübt worden war.
… Folglich ein Mann, der abends nicht allein aus dem Haus geht …
Dann ging er ins Detail. Nach dem fünften Mord, dem vorletzten, dem an Léonide Proux, der Hebamme aus Fétilly, hatte er geschrieben:
Es steht zu vermuten, dass die Geburtshelferin durch einen Telefonanruf aus dem Haus gelockt wurde, was ein Versorgungsköfferchen zu belegen scheint, das sie bei sich hatte, als sie überfallen wurde …
Das war falsch. Genau genommen war sie die Einzige, der Monsieur Labbé fast zufällig begegnet war. Natürlich, sie hatte auf der Liste gestanden. Hätte er sie vielleicht tatsächlich angerufen, wenn er ihr nicht begegnet wäre?
Da einen derart entlarvenden Anruf von einem öffentlichen Fernsprecher oder aus einem Café zu tätigen riskant gewesen wäre …
Er wollte zu intelligent sein, intelligenter als der Mörder. Dieser, so nahm er an, nutze zu Hause ein eigenes Telefon. Bedachte er dabei wirklich nicht, dass in diesem Fall seine Frau oder das Hausmädchen das Gespräch würde mithören können?
Außerdem hatte Monsieur Labbé gar kein Telefon, er hatte es stets abgelehnt, sich einen Anschluss legen zu lassen. Der kleine Jeantet verhedderte sich weiter:
Es handelt sich vermutlich um einen Mann, der in einem Büro arbeitet, das er zwischen fünf und sechs Uhr verlässt, und der seine Verbrechen auf dem Heimweg verübt.
Es war schon verblüffend, dass er derlei in einem Café schrieb, wo er jeden Tag Geschäftsleute sah, die ein, zwei Stunden lang vor ihrem Abendessen Karten spielten.
Heute aber kam es noch besser. Die Zeitung brachte als Untertitel:
Haben wir jetzt eine Personenbeschreibung des Mörders?
Man hatte den Leichnam von Mademoiselle Irène Mollard kurz nach acht Uhr abends entdeckt. Ein Polizist war buchstäblich darüber gestolpert. Man hatte die ganze Straße in Alarm versetzt. Die Mutter des kleinen Mädchens, dem das alte Fräulein die letzte Klavierstunde gegeben hatte, rief aus:
»Ich habe sie nur widerwillig allein gehen lassen. Ich habe sie inständig gebeten, die Rückkehr meines Mannes abzuwarten, der sie bis nach Hause begleitet hätte. Sie wollte nichts davon hören. Meine Befürchtungen waren ihr völlig gleichgültig. Sie hat behauptet, sie habe keine Angst. Während sie davonging, ließ ich für einen Augenblick die Tür einen Spalt offen, um das Geräusch ihrer Schritte zu hören. Ich erinnere mich jetzt, mitten auf der Straße einen Mann gesehen zu haben. Fast hätte ich um Hilfe gerufen, dachte dann aber, ich würde mich lächerlich machen, weil sich ein Mörder ja nicht mitten auf die Fahrbahn stellt. Trotzdem habe ich die Tür sehr schnell wieder zugemacht. Ich habe ihn zwar nicht genau gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein kleiner Dürrer war, mit einem zu langen Regenmantel.«
Der Regenmantel von Kachoudas, oder vielmehr der Regenmantel, der gar nicht Kachoudas gehörte, sondern den ein auswärtiger Vertreter, nachdem er einen Mantel gekauft hatte, ihm überließ, weil er abgenutzt und schmutzig war, und den der kleine Schneider aus Sparsamkeit auftrug, sobald es regnete.
Monsieur Labbé drehte sich zum Fenster. Kachoudas war zurück auf seinen Tisch gestiegen. Er redete mit seiner Frau, die, einen Einkaufsbeutel in der Hand, dabei war, das Haus zu verlassen. Bestimmt fragte sie ihn, was er gern essen würde.
Der Schneider hatte die Zeitung noch nicht gelesen. Er verließ das Haus morgens nur, um die Fensterläden abzunehmen. Erst wenn sie vom Markt zurückkam, würde ihm seine Frau das Echo des Charentes mitbringen.
Und auch Louise ging aus dem Haus, um Besorgungen zu machen. Die Klingel an der Eingangstür bimmelte mehrere Male. Es waren Kunden im Laden.
Ehe er das Zimmer verließ, vergaß Monsieur Labbé nicht, einige Wörter zu murmeln, und verrückte leicht den Sessel.
Valentin sah die Beine auftauchen, den Torso, schließlich das Gesicht, gelassen, entspannt. Weil er betreten wirkte, fragte ihn der Hutmacher:
»Was ist?«
Und der junge Mann, verschnupft, wie er war, deutete auf einen hünenhaften Bauern, der von einem Bein aufs andere trat.
»Er bräuchte eine 58, wir haben aber bloß 56.«
»Lassen Sie sehen.«
Er richtete den Hut im Dampf, bis der Kunde schließlich ging, nicht ohne sich leicht beunruhigt in den Spiegeln zu mustern.