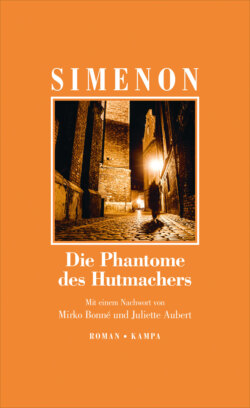Читать книгу Die Phantome des Hutmachers - Georges Simenon - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление»Schließen Sie ab, Valentin.«
»Ja, Monsieur. Guten Abend, Monsieur.«
»Guten Abend, Valentin.«
Valentin hatte sich den ganzen Tag lang die Nase geputzt, denn so flüssig war das Ganze wohl, dass man schon vom Zugucken und Hinhören feuchte Augen bekam. Zweimal hatte er sein Taschentuch zum Trocknen vor die Gasheizung gehängt, weil keine Kunden da gewesen waren.
Auch der war ein armer Kerl. Er war groß und rothaarig, mit dunkelblauen Augen, und derart anständig, dass Monsieur Labbé, machte er den Mund auf, um ihm einen Rüffel zu erteilen, ihn, ohne etwas zu sagen, wieder schloss und sich begnügte, mit den Achseln zu zucken.
Sie verbrachten den größten Teil des Tages zusammen, denn in Wirklichkeit bestanden Hutgeschäft und Werkstatt aus bloß einem Raum. Es gab Tage, da sah man stundenlang keinen Kunden. Hatte er alles abgestaubt, alles in Ordnung gebracht, zum hundertsten Mal die Etiketten überprüft, dann zog sich der arme Valentin wie ein großer Hund, den sein Körper nervte, in eine Ecke zurück, vermied es, ein Geräusch von sich zu geben, zuckte bei der kleinsten Bewegung seines Herrchens zusammen und lutschte, weil er im Laden nicht rauchen durfte, lautlos Veilchenbonbons.
»Bis Montag, Valentin. Schönen Sonntag.«
Eine Zusatzstreicheleinheit, im Vorbeigehen. Worauf es ankam, war, herauszufinden, ob Kachoudas herunterkäme oder nicht. Er hatte sich den ganzen Tag nicht aus dem Haus gerührt. Einmal war er zu einer Anprobe heruntergekommen, ein andermal hatte er Stoffe ausgekramt vor einem Kunden, der unentschieden blieb und ging, wahrscheinlich indem er wiederzukommen versprach. Er hatte in seiner Werkstatt das Licht angelassen, denn der Nebel hatte sich noch nicht verzogen, ja, als die Marktgeräusche schwächer geworden waren, hatte man in regelmäßigen Abständen das Nebelhorn gehört. Wie das Muhen einer riesenhaften Kuh klang es in der leeren Weite, und es gab Leute, die wohnten schon lange in der Stadt und waren davon noch immer beeindruckt. Kein Boot hatte abgelegt. Noch immer wartete man auf welche, die nicht zurückgekehrt waren, und sorgte sich um ihren Verbleib.
Lange vor Einbruch der Dunkelheit waren die Bäuerinnen in ihren Karren oder mit dem Bus wieder heimgefahren, und übrig blieben nur die Männer, die mit gerötetem Gesicht und glänzenden Augen in den Bistros die Zeit totschlugen.
Kachoudas hatte die Zeitung gelesen. Jedenfalls hatte seine Frau sie ihm mitgebracht. Monsieur Labbé hatte sich in dieser Hinsicht nicht getäuscht. Täuschte er sich denn je? Es war ihm nicht gestattet. Trotz allem, was er im Kopf hatte, gelang es ihm, nichts zu vergessen, nicht das kleinste Detail. Sonst nämlich wäre er verloren gewesen.
Die Zeitung lag auf einem Stuhl unweit des Schneidertischs, und man sah, dass sie aufgeschlagen worden war.
Kachoudas würde kommen. Der Hutmacher war überzeugt, dass er kommen würde, er blieb auf seiner Türschwelle stehen, blickte hinüber zu dem erleuchteten Fenster und machte dabei mechanisch, nur für sich, wie die Bäuerinnen, die die Hühner anlocken:
»Komm, komm, putt, putt …«
Geräuschlos ging er davon, und er hatte keine zwanzig Meter zurückgelegt, da waren hinter ihm die Schritte zu vernehmen, die er unter allen Schritten hätte heraushören können.
Kachoudas war gekommen. Hatte er gezögert? Ein armer Kerl, wirklich. Überall auf der Welt gibt es jede Menge arme Kerle. Er musste ganz furchtbar versessen sein auf die zwanzigtausend Franc. Nie hatte er eine solche Summe auf einem Haufen auch nur gesehen, außer vielleicht hinter dem Bankschalter. Zwei Jahre bräuchte er, Tag und Nacht müsste er auf seinem Tisch verbringen, um derart viel zu verdienen.
Diese zwanzigtausend Franc, die wollte er sich verdienen, ohne Wenn und Aber. Mit aller Macht wollte er sie haben. Ja, gerade weil alles an ihm sie so unbedingt wollte, hatte er solche Angst.
Womöglich mehr Angst, sie zu verlieren, als Angst vor dem Hutmacher? Was passiert war, hatte passieren müssen, weil es zwangsläufig geschehen war: Immer ist es einer wie Kachoudas, der sich verdächtig macht. Kachoudas war es, den die Mutter des kleinen Mädchens mit dem Klavier gesehen und der Polizei beschrieben hatte.
Sie gingen hintereinander her, so wie jeden Tag, und bei jedem Schritt musste der Schneider ein Bein nach außen hin nachziehen. Monsieur Labbé hingegen stolzierte ruhig und würdevoll voran, er hatte wirklich einen schönen Gang.
Er drückte die Tür zum Café des Colonnes auf, in dem schon der Krach und der Geruch ihm klargemacht hätten, dass Samstag war. Der Geruch, ja, denn die Leute vom Samstag nahmen nicht die gleichen Getränke zu sich wie die Gäste der übrigen Tage.
Das Lokal war voll besetzt. Einige standen sogar. Die gewöhnlichen Bauern trafen sich in den kleinen Bars rund um den Markt; hier waren es die reichsten oder unternehmungslustigsten, jene, die mit Düngemittelhändlern, Versicherungsmaklern, Gesetzesvertretern zu tun hatten, die jeden Samstag an stundenweise Schreibtisch oder Kanzlei gewordenen Tischen ihre Sitzungen abhielten.
Einzig die Tische in der Mitte, nahe dem Ofen, blieben eine Oase der Ruhe und Schweigsamkeit.
Chantreau, der nicht spielte, saß hinter dem Senator, der die Karten hielt. Monsieur Labbé reichte dem Arzt die Hand.
»Guten Abend, Paul.«
Und als sein Freund aus einem Kartonschächtelchen eine Pille fischte:
»Geht es nicht gut?«
»Die Leber.«
So erging es ihm von Zeit zu Zeit. Von einem Tag zum anderen schien er um mehrere Kilo abgemagert zu sein, so ausgezehrt war sein Gesicht, mit weichen Tränensäcken unter den Augen, dem Blick eines Leidenden.
Sie waren gleichaltrig. In der Oberschule waren sie eng befreundet gewesen, fast unzertrennlich.
Gabriel nahm Monsieur Labbé den Mantel, den Hut ab.
»Wie immer?«
Vor dem Arzt, auf der Marmorplatte des Tischs, stand ein Viertel Vichy. Kachoudas, der gerade hereingekommen war, zögerte, sich zu den Spielern zu setzen.
Armer Kerl, auch der! Nicht bloß Kachoudas, der endlich vorsichtig den Hintern auf einen Stuhl senkte, sondern genauso Paul, der Arzt. In irgendeiner Schublade musste Monsieur Labbé noch ein Foto haben, das sie beide zeigte, mit fünfzehn oder sechzehn Jahren. Chantreau war in dem Alter ein Spiddel gewesen, seine Haare mit einem Stich ins Rötliche, allerdings nicht verwaschen rot wie bei Valentin. Selbstbewusst hatte er das Kinn vorgestreckt, herausfordernd hatte er geradeaus gesehen.
Schon da hatte er Mediziner werden wollen, kein gewöhnlicher Mediziner jedoch: ein großer Entdecker in der Art von Pasteur oder von Nicolle. Sein Vater war reich gewesen, hatte an die zehn Höfe im Aunis und in der Vendée besessen. Er hatte nichts anderes gemacht, als sie aus der Ferne zu verwalten, und, seltsam genug, seine Nachmittage im Café des Colonnes verbracht, an demselben Platz wie heute die Bridgespieler.
»Er ekelt mich an«, hatte der junge Paul von ihm gesagt. »Er ist ein Geizhals. Was aus den Bauern wird, ist ihm schnuppe.«
Im Grunde hatten ihre Eltern alle Besitz gehabt, Ländereien, Höfe oder Häuser, Schiffe oder Anteile an Schiffen.
Kachoudas beobachtete Monsieur Labbé so eingehend wie verstohlen, was dieser sich aber nicht anmerken ließ. Es war ein Spiel. Letzterer bewies sich dadurch, dass er sich nichts vorzuwerfen hatte. Die Rollen waren vertauscht: Der kleine Schneider war es, der vor Angst schwitzte, der nervös sein Glas trank, manchmal mit einem Ausdruck, als würde er ihn anflehen.
Anflehen, worum? Sich fassen zu lassen, damit er seine zwanzigtausend Franc Belohnung kassieren konnte?
»Du trinkst zu viel, Paul.«
»Ich weiß.«
»Wieso?«
Wieso trank man? Chantreau war Mediziner geworden. Er war in die Stadt zurückgezogen und hatte eine Praxis eröffnet. Er hatte entschieden:
»Patienten werde ich nur morgens annehmen, so habe ich den Rest der Zeit frei für meine Forschungen.«
Er hatte sich ein wahres Labor geleistet, hatte sämtliche medizinischen Zeitschriften abonniert.
»Warum hast du nie geheiratet, Paul?«
Vielleicht weil er Wissenschaftler hatte werden wollen, er wusste es nicht und begnügte sich mit einem Achselzucken und einer Grimasse, die der Schmerz ihm abtrotzte.
Er hatte sich den Bart wachsen lassen, war nicht länger gepflegt. Seine Nägel waren schwarz, seine Kleidung bedenklich. Wie die, die arbeiteten, war er zuerst um sechs ins Café des Colonnes gekommen, dann um fünf, dann um vier, und jetzt war er gleich nach dem Mittagessen hier – weil um diese Zeit keiner aufzutreiben war, mit dem sich eine Partie spielen ließ, spielte er Dame mit Oscar, dem Patron.
Inzwischen war er über sechzig, wie Monsieur Labbé. Alle waren sie über sechzig.
»Spielst du für mich weiter, Léon? Ich muss ein bisschen mit meinen Wählern schwatzen.«
André Laude, der Senator, der grad eben einen Rubber gewonnen hatte, erhob sich nur ungern. Um sie her herrschte ein beständiger Lärm, Schuhe, die über den mit Sägemehl bedeckten Boden trotteten, Gläser, die aneinanderstießen, Unterlegschälchen, lautere Stimmen als sonst.
»Den werden sie auch noch kriegen, und ob«, sagte ein Landwirt mit Ledergamaschen. »Am Ende kriegen sie alle, selbst die Ausgebufftesten. Aber dann? Ihr werdet schon sehen, dass sie ihn in die Klapse stecken, angeblich weil er nicht ganz dicht ist hier oben, und wir, die Steuerzahler, sind es dann, die ihn durchfüttern, bis er krepiert.«
»Es sei denn, ein Bursche wie ich kriegt ihn in die Finger!«
»Du würdest es machen wie die anderen, trotz deines großen Mundwerks! Vielleicht würdest du ihm die Faust in die Fratze hauen, trotzdem würdest du ihn dann schön brav bei der Polizei abliefern. Auf dem Dorf irgendwo, ja, kann sein, da wär es vielleicht anders. Da gibt es Mistgabeln und Schaufeln.«
Seelenruhig, ohne eine Miene zu verziehen, setzte sich Monsieur Labbé auf den Platz des Senators, der seinen Rundgang von Tisch zu Tisch angetreten hatte. Einen Moment lang fragte sich der Hutmacher, ob auch Kachoudas erkältet war, so rot war er, hatte glänzende Augen, bemerkte dann aber zwei Unterlegschälchen unter seinem Glas.
Der Schneider trank! Womöglich, um sich Mut zu machen? Schon gab er Gabriel ein Zeichen, ihm einen dritten Weißwein zu bringen.
»Wir spielen zusammen«, verkündete Julien Lambert, der Versicherungsmakler, und mischte die Karten.
Der wiederum trank nicht, das heißt, er begnügte sich mit einem Aperitif, höchstens zweien. Er war Protestant. Er hatte vier oder fünf Kinder und hätte noch viel mehr gehabt, wenn die Gemahlin nicht jedes zweite Mal eine Fehlgeburt hingelegt hätte. Inzwischen zog man ihn damit auf. Er wurde gefragt:
»Deine Frau?«
»Im Krankenhaus.«
»Baby?«
»Fehlgeburt.«
Auch er hatte Geld, das er von den Eltern geerbt und das ihm ermöglicht hatte, sich eine Versicherungsvertretung zuzulegen. Er kümmerte sich nicht viel darum. Er hatte ja gute Untervertreter. Mitunter kam einer von ihnen in einer dringenden Sache zu ihm ins Café. Nachdem er den Nachmittag mit Bridgespielen verbracht hatte, aß er hastig zu Abend, bloß um dann bei sich oder Freunden weiter Bridge zu spielen.
Im Übrigen war er der Bruder von Madame Geoffroy-Lambert aus der Rue Réaumur, der vierten Erwürgten. Monsieur Labbé war zu ihrem Begräbnis gegangen:
»Mein Beileid, Julien.«
Zu sämtlichen Begräbnissen war er gegangen, schließlich hatte er sie alle gekannt, zumindest durch Mathilde.
Der kleine Journalist war nicht zu sehen. Wahrscheinlich war er draußen mit seinen Nachforschungen beschäftigt. Zwei-, dreimal warf Monsieur Labbé einen Blick hinüber zu dem Tisch, an dem Jeantet sonst saß.
»Wir haben einen neuen Brief bekommen«, meinte Caillé, der Drucker und Besitzer des Echo des Charentes, während er auf seine Karten blickte.
»So langsam übertreibt er’s«, murmelte Julien Lambert und bot zwei Treff.
Und indem er sich zu Chantreau umdrehte, der die Partien mitverfolgte:
»Du meinst, er ist ein Durchgeknallter, Paul?«
Der Arzt zuckte mit den Achseln. Momentan interessierte ihn das nicht. Er hatte bloß Angst vor den Krallen, die seine Flanken bearbeiteten.
»Auf jeden Fall wird er erst aufhören, wenn man ihn hat«, grummelte er.
»Jack the Würgegerippe wurde nie gefasst, und trotzdem hat er aufgehört zu morden.«
Das freute Monsieur Labbé, der daran nie gedacht hatte.
»Wie viele hat er denn umgebracht?«, fragte er. »Drei Karo.«
»Passe.«
»Drei Pik«, übertrumpfte Lambert.
»Vier Herz.«
Es bestand Aussicht auf ein Klein-Schlemm, weshalb für einen Moment Schweigen eintrat, unterbrochen von Ansagen bis sechs Karo.
»Kontra!«
»Ich weiß nicht, wie viele er umgebracht hat, aber der Schrecken, in London und Umgebung, dauerte mehrere Monate lang. Die Armee wurde zu Hilfe gerufen. Büros und Fabriken mussten schließen, weil sich Angestellte und Arbeiterinnen nicht mehr auf die Straße trauten.«
»Ich würde gern wissen, wie viele Frauen jetzt gerade unterwegs sind auf den Straßen.«
Der kleine Schneider zitterte und trank das dritte Glas auf einen Zug leer. Aus Angst, dem Blick des Hutmachers zu begegnen, blickte er nicht mehr hinüber zu den Spielern, sondern fixierte düster den schmutzigen Fußboden.
»Viermal Trumpf. Ich mache den Pik-Impass auf den König, und der Rest meiner Hand ist hoch.«
Zu wissen, wie Kachoudas war, wenn er getrunken hatte, wäre interessant gewesen. Monsieur Labbé hatte ihn nie betrunken gesehen. Der Doktor zum Beispiel, der schon morgens anfing, sich volllaufen zu lassen, der nach jeder Untersuchung trank und den ganzen Tag lang nicht aufhörte damit, war zuerst von einem nur leicht mit Ironie durchsetzten Wohlwollen. Seine letzten Patienten am Vormittag, alle nannte er sie:
»Mein Kleiner.«
Oder:
»Mein armer Alter.«
Oder:
»Meine kleine Dame.«
Und anstatt ihnen ein Rezept auszustellen, holte er aus seinem Wandschrank ein Medikament hervor, das er ihnen in die Hand drückte, gratis.
Zu Beginn des Nachmittags sah man ihn als Olympier, Gesicht qualmverhüllt, Gestik verlangsamt, Blick verhangen, Äußerung karg. Dann wurde er langsam sarkastisch, sogar gegenüber den besten Freunden.
Die, die ihn abends gegen zehn trafen, wenn er nach Haus ging, nachdem er Rotwein getrunken hatte in den kleinen Bistros, behaupteten, er habe Tränen in den Augen gehabt und sie am Arm festgehalten.
»Ein Rohrkrepierer, mein Alter. Ein altes Aas von einem Versager, das ist es, was ich bin! Gib zu, dass ich dich anekle, dass ich euch alle anekle!«
Was den Wirt anging, der berufshalber gezwungen war, den ganzen Tag lang mit seinen Gästen ein Gläschen zu heben: Oscar quollen die Lider auf, sein Gang wurde würdevoll und zögerlich; als hätte er einen Knoten in der Zunge, vertat er sich gegen Abend mit den Silben, sodass man nicht immer verstand, was er von sich gab.
Jedenfalls wurde der kleine Schneider unruhig. Er hielt es nicht länger auf seinem Platz aus, bewegte sich, als hätte er einen Tick oder wollte Fliegen verjagen, die es auf ihn abgesehen hatten.
Monsieur Labbé hatte den nicht unangenehmen Eindruck, Kachoudas an Fäden zu halten, ihm zugewandt zu flüstern:
»Ganz ruhig, Kleiner.«
Er wusste genau, dass Kommissar Pigeac da war, hinter ihm, am Tisch der Vierzig- bis Fünfzigjährigen. Er hatte ihn hereinkommen sehen, im grauen Mantel, einen grauen Hut auf, mit grauem Gesicht. Er erinnerte an einen Fisch, an einen drögen Stockfisch, und hatte immer ein kaltes Lächeln auf den Lippen, wie um zu verstehen zu geben, dass er sehr viel wusste.
Er wusste überhaupt nichts, davon war Monsieur Labbé überzeugt. Ein aufgeblasener Blödian war er, ein Beamter von Geburt an, der an nichts dachte als an seine Beförderung und in die Freimaurerloge eingetreten war, weil man ihm weisgemacht hatte, das wäre hilfreich. Stark war er bloß beim Billard, wo er Serien schaffte von hundertfünfzig bis zweihundert Punkten, während er gemächlich um den grünen Filz stolzierte und sich ab und an in einem Spiegel betrachtete.
»Geh da nicht hin, Kleiner.«
Kachoudas war es, zu dem er das in Gedanken sagte, denn er spürte den Schwindel, der den kleinen Schneider packte, heiß wurde ihm, er wusste nicht, wohin er gucken sollte, während er an seine zwanzigtausend Franc und an die Aussage der Mama des kleinen Mädchens mit dem Klavier dachte.
»Angeblich«, sagte Caillé noch, der Druckereibesitzer, »will er ja nur noch eine um die Ecke bringen.«
»Wieso das?«
»Den Grund nennt er nicht. Er behauptet immer, das sei nötig, er mache das nicht aus Lust und Laune. Lest morgen früh seinen Brief in der Zeitung. Ich bin dran? Kein Trumpf.«
Vier Gläser Weißwein. Kachoudas hatte bereits vier Gläser Weißwein getrunken – darüber vergaß er ganz, auf die Uhr zu sehen. Die Zeit, zu der er für gewöhnlich nach Haus ging, war längst um.
»Es passiert Montag.«
»Was passiert Montag?«
»Der letzte Mord. Warum Montag, weiß ich auch nicht. Bin gespannt, ob es heute oder morgen Morde gibt. Das wäre ein Indiz dafür, dass er Quatsch schreibt.«
»Der schreibt keinen Quatsch«, sagte Julien Lambert.
»Wieso sieben und nicht acht?«
»Und wieso meine Schwester, die nie jemandem etwas getan hat?«
»Vielleicht mag er alte Frauen nicht«, sagte Chantreau kehlig.
Monsieur Labbé sah ihn neugierig an, denn die Bemerkung war gar nicht so dumm. Zwar traf sie nicht exakt zu, aber dumm war sie keineswegs.
»Ist euch aufgefallen«, fuhr Caillé fort, »dass sie alle etwa in unserem Alter sind?«
Hier schaltete sich Arnould ein, der dicke Arnould von Sardinen-Arnoulds, der noch nichts gesagt hatte:
»Mindestens zwei waren dabei, die ich im Bett hatte, und eine hätte ich fast geheiratet.«
Lambert ging hoch wie von der Tarantel gestochen.
»Meine Schwester?«
»Ich rede nicht von deiner Schwester.«
Dabei wusste jeder um Madame Geoffroy-Lamberts gastliche Schenkel. Allerdings war sie so erst ab etwa vierzig geworden, nachdem sie verwitwet gewesen war, und hatte es auch nur auf sehr junge Herren abgesehen.
»Kanntest du Irène Mollard?«
»Sie war hübsch, aber schon mit siebzehn hieß es, ein Vogel sei das, den würde sich die Katze holen, so zart war sie. Sentimental wie ein Fortsetzungsroman. So sentimental, dass sie nie geheiratet hat. Ich wette, sie hat als Jungfrau das Zeitliche gesegnet.«
»Stimmt das?«, fragte man den Doktor, dessen Patientin sie gewesen war.
»Was das betrifft, hatte ich sie nicht zu untersuchen.«
»Wer hat drei Treff geboten? Bei drei Treff waren wir. Du bist dran, Paul.«
Das Café war voller Qualm, angezogen von den dicken Kugellampen aus Milchglas, die seit Kurzem von der Decke hingen. Der Senator war an seinem dritten Tisch, und an jedem gab er eine Runde aus. Fast an jedem Tisch sah man ihn ein Heft aus der Tasche ziehen, etwas hineinschreiben. Nur wenige Wähler hatten keine Forderungen, sodass Laude, als Monsieur Labbé von Weitem hinübersah, gerade sein Heft in die Jacke zurücksteckte und ihm dabei zynisch zuzwinkerte.
Früher war er der Ärmste von ihnen. Sein Vater war ein kleiner Angestellter beim Crédit Lyonnais gewesen. Der Sohn hatte die einzige Tochter einer betuchten Familie geheiratet, obwohl er nur Anwalt und Stadtrat gewesen war. Heute bewohnte er eine der dicken Villen an der Rue Réaumur, nicht weit von Madame Geoffroy-Lamberts.
»Da fällt mir ein«, sagte Monsieur Labbé, »das Haus deiner Schwester muss doch eigentlich zum Verkauf stehen, oder?«
»Willst du’s denn kaufen?«, fragte der andere ironisch. »Ist eine richtige Last, der alte Kasten. Hat ja gerade mal elf Schlafzimmer und hinten im Hof Ställe für bloß zehn Pferde. Ich versuche, ihn der Präfektur unterzujubeln, die brauchen ja immer Platz für Büros.«
»Ganz ruhig, Kleiner!«
Um ein Haar hätte Monsieur Labbé Gabriel angewiesen, dem kleinen Schneider nichts mehr zu trinken zu bringen, und bestimmt hätte Gabriel ihm gehorcht. Einen Moment lang war er beunruhigt, als Kachoudas aufsprang und es aussah, als stürze er in Richtung Tisch des Kommissars. Er ging jedoch daran vorbei und verschwand auf die Toilette.
Seine Blase? Sein Magen? Ein glücklicher Zufall wollte, dass der Hutmacher just zu diesem Zeitpunkt pausieren musste, weshalb er sich gleichfalls zu den Waschräumen begab, rein aus Neugier, denn Angst hatte er nicht.
Es war nur die Blase, und so standen sie nebeneinander vor den Kacheln, mit denen die Wand verkleidet war. Der kleine Schneider, der am ganzen Leib zitterte, war nicht in der Lage zu fliehen. Starr vor sich hin blickend sagte Monsieur Labbé nach einem Moment des Zögerns leise zu ihm:
»Ganz ruhig, Kachoudas.«
Sie waren allein. Stellte der Schneider sich vor, sein Nebenmann würde ihn erwürgen? Ohne zu lügen, hätte ihm Monsieur Labbé versichern können, dass er sein Instrument nicht dabeihatte.
Es hatte ja nie einer daran gedacht, eine Liste derjenigen Einwohner von La Rochelle aufzustellen, die Cello spielten. Allzu viele waren es ganz bestimmt nicht.
Was ihn betraf, so hatte man wahrscheinlich vergessen, dass er Musik gemacht hatte. Seit mindestens zwanzig Jahren hatte er nicht gespielt auf seinem Instrument, das auf dem Dachboden stand. Um zum Dachboden zu gelangen, musste er das Haus verlassen, den Durchgang zum Hof durchqueren und die Treppe nehmen, nach oben in den zweiten Stock. Das hatte er gemacht, denn er war nicht so unvorsichtig gewesen, eine Cellosaite bei dem Geigenbauer in der Rue du Palais zu kaufen. Zumal es nur einen einzigen in der Stadt gab. Und seit fünfzehn Jahren hatte der Hutmacher La Rochelle nicht verlassen, nicht mal, um nach Rochefort zu fahren, fünfzehn Jahre, in denen er nirgends sonst geschlafen hatte als in seinem Bett.
Auch das war niemandem aufgefallen. Die anderen fehlten ab und an bei den nachmittäglichen Zusammenkünften. André Laude fuhr nach Paris zu einer Senatssitzung und verbrachte seine Ferien auf einem Schloss in der Dordogne, das zur Mitgift seiner Frau gehört hatte. Selbst Chantreau machte jedes Jahr eine Kur in Vichy. Die Familie Julien Lambert hatte ein Häuschen in Fourras, wo sie zwei Monate im Jahr verbrachte, und der Versicherungsfritze kündigte mal an, geschäftlich nach Bordeaux zu reisen, mal verabsentierte er sich nach Paris.
Die meisten besaßen ein Auto, fuhren Bahn. Arnould, der Verfrachter, hatte vergangenen Sommer eine Kreuzfahrt nach Spitzbergen gemacht. Es gab Tage, da hatte man Mühe, für eine Partie den vierten Mann zu finden, ja mitunter musste man Leute vom Tisch der Vierzig- bis Fünfzigjährigen zu Hilfe rufen.
Einzig der Hutmacher war immer da, und daran hatte man sich so sehr gewöhnt, dass es einem überhaupt nicht mehr auffiel. Seit wann hatte er keine echte Kuh mehr gesehen, abgesehen von den Herden, die durch die Straßen zum Schlachthof getrieben wurden?
Anfangs hatte man ihn bedauert. Bedauert hatte man vor allem Mathilde.
»Wie erträgt sie das?«
»Nicht schlecht. Nicht schlecht.«
Selbst Kachoudas … Kachoudas war nach Paris gefahren und nach Elbeuf! An bestimmten Sommersonntagen fuhr er mit den Seinen ans Meer, gut, nicht sehr weit, nach Châtelaillon, und auch nur an Tagen, an denen die Straße leer wie ein Billardtisch war und man kein anderes Geräusch hörte als das Gezwitscher der Spatzen.
Monsieur Labbé war als Erster an seinen Platz zurückgekehrt. Er wusste genau, der andere würde ihm nachkommen.
»Und die drei Herz?«
»Hab fünf gemacht.«
»Du hast ein volles Spiel verpasst. Ich gebe?«
Es war sechs, und die Bauern wurden spärlicher. Die noch blieben, hatten ein Auto oder einen Lieferwagen, denn die Fuhrwerke, die längst aufgebrochen waren, mussten im Schritttempo durch den sich wieder eindickenden Nebel. Er war so dicht, selbst in der Stadt, dass, wenn die Tür zum Café aufging, er wie kalter Qualm in das Lokal wallte, weißer als der Qualm der Pfeifen und Zigarren.
Wer, der nicht zu ihrem Tisch gehörte, hätte geglaubt, dass Monsieur Labbé Flieger gewesen war? Und doch war es so gewesen, während des Kriegs von ’14. Er hatte feindliche Maschinen abgeschossen wie Pfeifen auf dem Jahrmarkt und mehrere Auszeichnungen bekommen. Er hatte in La Rochelle sogar einen Aviatik-Club ins Leben gerufen, dessen Präsident er eine Zeitlang gewesen war. Und zuvor hatte er bei den Dragonern gedient.
»Kontriere die zwei Treff.«
»Rekontriere.«
Ihm unterlief kein Fehler. Julien Lambert, der stets peinlich genau war, hatte ihm nicht das Geringste vorzuwerfen. Seine Ansagen waren korrekt, seine Impasse fast immer von Erfolg gekrönt.
Wäre es nicht das Einfachste, Kachoudas die zwanzigtausend Franc anzubieten? Leisten könnte er es sich. Er war wohlhabend. Wenn seine Hutmacherei den Bach runterging, dann passierte das, weil es ihm in den Kram passte.
Er hätte umziehen können, weil die Geschäfte sich zur Rue du Palais hin verlagert hatten, wo die Lichter und Lautsprecher des Prisunic und anderer Warenhäuser groß auftrumpften.
Selbst in der Rue du Minage war es einfach, sein Schaufenster besser zu beleuchten, den Laden zu modernisieren, die Wände und die Regale hell anzustreichen.
Nur wozu? Seine Freunde kauften selten einen Hut bei ihm, sie deckten sich lieber in Bordeaux oder in Paris ein. Er nahm damit vorlieb, ihre Hüte in seinem Hinterzimmer wieder in Form zu bringen, wobei er dann und wann den Wandschrank aufmachte, um an der Kordel zu ziehen.
»Madame Labbé ruft Sie«, sagte Valentin, als wäre er der Einzige, der die Klopfer auf den Fußboden hörte.
Monsieur Labbé zog die Brauen hoch, als er Kachoudas mit zögerlicher Stimme bei Gabriel bestellen hörte:
»Einen Cognac.«
Er hatte also beschlossen, sich volllaufen zu lassen, und wandte den Blick ab, um dem des Hutmachers auszuweichen.
Würde er später noch imstande sein, auf seinen Tisch zu klettern und nach einem Streifen Stoff zu langen, der nach Wollfett roch? Schließlich hatte er ja seinen Tisch, die an einem Draht befestigte Birne, das herabbaumelnde Kreidestück. Er hatte auch seinen Geruch, den er überall mit hinschleppte und der bloß den anderen lästig war, während er ihn bestimmt mit einer Art Wollust einatmete. Und seine Frau, immer schlampig, mit der schrillen Stimme, die er den ganzen Tag lang durch die angelehnte Küchentür hörte, die Gören, den Jungen, der nach vier Mädchen als Letzter gekommen war, die Älteste, die gewiss ab und zu schon einen Verehrer hatte.
Nicht lange, und Madame Kachoudas würde erneut schwanger sein. Erstaunlich genug, dass sie es drei Jahre lang nicht gewesen war. Oder sollte etwas in ihr drin nicht ganz beieinander sein?
Wenn sie nachher nach Haus gingen, konnte Monsieur Labbé den Schneider auf der Straße ansprechen, ihn beruhigen, ihn beschwichtigen, ihn bitten, eine Minute zu warten, und ihm zwanzigtausend Franc holen gehen. Im Schlafzimmersekretär war eine dicke Brieftasche, die mehr als das in Scheinen enthielt. Es stammte noch von Mathilde, dieses Geld, in nichts, in niemanden hatte sie Vertrauen gehabt und war vor Banken auf der Hut gewesen.
»Gabriel!«
»Ja, Monsieur Labbé. Das Gleiche?«
»Einen Cognac mit Wasser.«
Der Cognac von Kachoudas hatte ihm Lust auf einen eigenen gemacht, volllaufen lassen würde er sich aber nicht, selten in seinem Leben hatte er sich betrunken, außer als Student und während des Krieges, bevor er abhob zu einem Luftangriff.
»Ich schnappe und spiele das hohe Treff.«
Chantreau schluckte neben ihm eine zweite Pille, und Monsieur Labbé schlug dessen schlechter Atem ins Gesicht.
»Deine Frau?«
»Immer dasselbe.«
»Liegt sie sich nicht wund?«
Er schüttelte verneinend den Kopf.
»Sie hat Glück.«
Seit zehn Jahren hatte kein Arzt mehr das Haus betreten. Zu Beginn ihrer Lähmung hatte Mathilde sie noch alle konsultieren wollen, jede Woche einen anderen Arzt. Sie hatten Spezialisten kommen lassen aus Bordeaux, aus Paris. Alle möglichen Behandlungen hatte sie über sich ergehen lassen, dann waren die Priester, die Nonnen an die Reihe gekommen, und zwei Jahre in Folge war sie auch nach Lourdes gepilgert.
Alles in allem hatte dieser Trubel fünf Jahre gedauert, mit Höhen und Tiefen, Krisen voller Aberglauben, Phasen der Hoffnung und Phasen der Resignation.
»Schwör mir, dass du nicht wieder heiratest, wenn ich nicht mehr bin.«
Tags darauf nahm sie seine Hand, fürsorglich raunte sie:
»Hör zu, Léon. Wenn ich nicht mehr bin, darfst du nicht allein bleiben. Bestimmt findest du ein braves Mädchen, das du heiratest und das dir vielleicht Kinder schenkt. Du wirst ihr meinen Schmuck geben. Doch! Ich bestehe darauf.«
Acht Tage lang las sie von morgens bis abends, bevor sie in der Woche darauf ihre Zeit nur noch damit zubrachte, mit wildem Gesichtsausdruck die Vorhänge anzustarren.
Sie hatte den Geistheiler aus Charron rufen lassen, in den sie dann einen Monat lang ihren Glauben setzte. Sie war ihre fünf Krankenwärterinnen leid gewesen und hatte die letzte mit einem Schwall aus Beschimpfungen bedacht.
Eines Tages hatte sie beschlossen, keinen Arzt und keinen Priester mehr sehen zu wollen, und wenig später bedeutete sie Delphine, die seinerzeit ihre Haushälterin gewesen war, dass sie nicht mehr über die Schwelle ihres Zimmers zu treten brauche.
Chantreau, der keine Frau hatte, verbrachte seine Tage allein, mit Trinken. Julien Lambert hatte eine – eine große braune Stute – und Kinder, und er schlug die Zeit tot mit Kartenspielen.
Was Arnould betraf, der einmal geschieden war und sich neu verheiratet hatte mit einer Frau, die fünfzehn Jahre jünger war als er, so ging der Sardinen-Mann mindestens zweimal die Woche ins Bordell – es war sogar vorgekommen, dass er dort eingeschlafen war, nachdem er zu viel getrunken hatte.
Es war Caillé, der den Kommissar anhielt, als der an ihrem Tisch vorbeikam.
»Ihre Untersuchung, Pigeac?«
»Geht voran! Geht voran!«, erwiderte der andere mit undurchdringlicher Miene.
(Blödmann! Aufgeplusterter Blödmann!)
»Hat man Ihnen eine Kopie des Briefes übermittelt, den wir mit der Nachmittagspost erhalten haben?«
»Hab ihn gelesen.«
»Was halten Sie davon?«
»Dass er sich bald schnappen lassen wird.«
»Sie haben eine Spur?«
Monsieur Labbé sah Kachoudas an, dessen nervliche Anspannung mit anzusehen wehtat.
»Sollte er Montag etwas versuchen, wird das sein letzter Abgang gewesen sein. Doch er blufft, glauben Sie mir.«
»Jeantet meint, nein.«
»Na, dann nicht, wenn Monsieur Jeantet dieser Ansicht ist«, höhnte Kommissar Pigeac.
»Er behauptet, der Mann lügt nicht.«
»Ach wirklich?«
»Verwirrend ist doch die Notwendigkeit, von der er spricht. Verstehen Sie, was ich meine? Wie Jeantet es schon sehr richtig schrieb, hat man nicht den Eindruck, die Opfer wären einfach so ausgesucht worden.«
»Ich gratuliere Ihrem Reporter.«
Worauf der Kommissar das Ende einer Zigarre abbiss, indem er das Gesicht zu einem Lächeln verzog.
»Wieso sieben, und wieso Montag?«
»Ich empfehle mich, meine Herren. Entschuldigen Sie mich.«
Der Kommissar ging davon, Caillé grummelte:
»Er ist beleidigt. Ich weiß gut, dass Jeantet noch ein Bubi ist. Fast aus Barmherzigkeit hab ich ihn genommen, weil seine Mutter, die Witwe ist, putzen geht. Trotzdem möchte ich wetten, dass, wenn der Mörder ausfindig gemacht werden sollte, er es ist, der ihn ausfindig macht.«
»Können wir das Thema wechseln?«, schlug Julien Lambert vor. »Du bist dran, du gibst.«
Es war halb sieben, als Monsieur Labbé fragte:
»Der Rubber ist gespielt? Wenn es euch nichts ausmacht, geb ich meinen Platz ab.«
Bei ihm bestand man nie darauf, dass er blieb, anders als bei den anderen – was an Mathilde lag. Er genoss eine besondere Achtung. Man hatte eine ihm vorbehaltene Art, ihm »Bonjour« zu sagen, ihm die Hand zu drücken. Eine Gewohnheit war das geworden. Sobald er gegangen war, gab es immer einen, der murmelte:
»Armer Kerl!«
Widerstrebend. So wie man Julien Lambert kondoliert hatte, als dessen Schwester erwürgt worden war.
Es gab sogar einen unter ihnen – den Arzt, an einem Abend, als er viel getrunken hatte –, der hatte zwischen den Zähnen gegrummelt:
»Der hat’s bestimmt leidgetan, nicht vergewaltigt zu werden.«
»Bis morgen, meine Herren.«
»Du vergisst, dass morgen Sonntag ist.«
Das stimmte. Sonntags kam man nicht zusammen.
»Bis Montag also.«
Der Tag des letzten Opfers! Danach wäre es vorbei. Eine Zeitlang würde man noch darüber reden, dann aber an etwas anderes denken, und nach den alten Frauen, die peu à peu zur Legende wurden, würde keiner mehr fragen.
Es war fast schade. Er sah den kleinen Schneider an, und der nahm folgsam Kurs auf den Kleiderständer, an dem sein Mantel hing. Es war nicht der Regenmantel vom Vortag. Den anzuziehen hatte er sich nicht getraut. Er würde ihn nie wieder anziehen. Wer weiß, ob er ihn nicht hatte verschwinden lassen?
Bedächtig durchquerte Monsieur Labbé das Lokal und begegnete Mademoiselle Berthes Blick. Sie saß am Fenster, auf dem Platz, den am Vortag Jeantet eingenommen hatte. Sie kam öfter ins Café des Colonnes, zwei-, dreimal die Woche. Sofort roch man ihr Parfum. Sie war adrett gekleidet, immer in Schwarzweiß, was an einen Trauerfall denken ließ und sie umso aufregender machte.
Liebenswert trank sie ihren Portwein, ganz für sich. Ein diskretes Lächeln deutete sie an, sobald einer der Männer, die sie kannte, sie ansah, niemals jedoch richtete sie das Wort an sie.
Monsieur Labbé hätte ihr nur zuzuzwinkern und gemächlich vorauszugehen brauchen Richtung Rue Gargoulleau, wo sie ein hübsches Appartement hatte.
Damit hätte er Kachoudas einen schönen Streich gespielt. Was hätte der Schneider gedacht? Dass er Mademoiselle Berthe erwürgen würde, auch wenn sie gerade mal Mitte dreißig war?
Louise, sein Hausmädchen, erwartete ihn. Unabänderlich um sieben begab er sich zu Tisch – alles für nächste Woche, wenn das Ganze vorüber war und es dann eher nach kleiner Belohnung aussah.
Komm, mein Kachoudas! Mir nach, kleiner Mann! Weder eine Alte heute noch eine Junge. Wir gehen heim.
Die Schritte des kleinen Schneiders hinter ihm waren unsicher. Er musste wohl die Absicht gehabt haben, mit dem Hutmacher zu reden, denn irgendwann, als sie durch die Rue du Minage gingen, wurde sein Gang schneller, zielstrebiger. Im Nebel, der Monsieur Labbé zu einem übergroßen Phantom machte, näherte er sich ihm bis auf wenige Meter.
Im Grunde hatten sie beide Angst. Unwillkürlich beschleunigte Monsieur Labbé den Schritt. Gerade hatte er gedacht:
Und wenn er bewaffnet ist? Wenn er mich niederschießt?
Aufgeregt genug, um so etwas zu machen, war Kachoudas.
Aber nein. Er blieb stehen, ließ den Abstand zwischen ihnen beiden größer werden, setzte durch das Dunkel tappend seinen Weg fort.
Jeder blieb schließlich vor seinem Haus stehen, zog den Schlüssel aus der Tasche, woraufhin in der Stille der Straße, durch den Nebel hindurch, die ruhige Stimme Monsieur Labbés sagte:
»Guten Abend, Kachoudas.«
Er wartete, den Schlüssel im Schloss, ein Stechen in der Herzgegend. Ein paar Sekunden vergingen, ehe ein belegtes Stimmchen widerwillig stammelte:
»Guten Abend, Monsieur Labbé.«