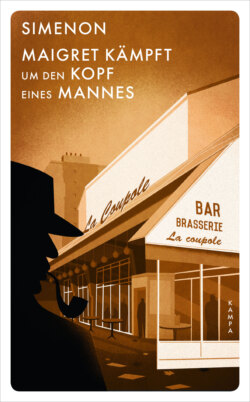Читать книгу Maigret macht Ferien - Georges Simenon, Georges Simenon - Страница 3
1
ОглавлениеDie holprige Pflasterstraße war so schmal wie alle Straßen in dieser Gegend, dem alten Viertel von Les Sables-d’Olonne. Von den Gehsteigen musste man hinuntertreten, sobald einem jemand entgegenkam. Das stattliche zweiflügelige Portal an der Ecke war von einem satten Dunkelgrün, das in der Sonne schimmerte, und mit zwei blankpolierten Messingklopfern versehen, wie man sie nur noch bei Landnotaren oder Klöstern vorfindet.
Davor parkten zwei große glänzende Wagen, die einen ähnlichen Eindruck von Makellosigkeit und Komfort hinterließen. Maigret kannte sie, sie gehörten den Chirurgen.
»Ich hätte auch Chirurg werden können«, dachte er, »und so einen Wagen besitzen.«
Vermutlich nicht gerade Chirurg, aber er wäre tatsächlich beinahe Arzt geworden. Er hatte ein Studium der Medizin begonnen und sehnte sich manchmal danach zurück. Wäre sein Vater nicht drei Jahre zu früh gestorben …
Bevor er auf das Tor zuging, zog er die Uhr aus der Tasche; es war drei. Im selben Augenblick ertönte dünn die Glocke der kleinen Kapelle und gleich darauf jene der Kirche Notre-Dame, deren voller Klang über die Dächer der kleinen Häuser der Stadt hinweggetragen wurde.
Er seufzte und drückte den Klingelknopf. Er seufzte, weil es ihm albern erschien, jeden Tag zur gleichen Zeit die Uhr aus der Tasche zu ziehen. Er seufzte, weil es ihm nicht weniger albern erschien, immer um Punkt drei zu kommen, als hinge das Schicksal der Welt davon ab. Und er seufzte, weil er sich nun, wie auch an den Tagen zuvor, während das Tor mit seiner gut geölten Mechanik geräuschlos aufsprang, in einen anderen Mann verwandeln würde.
Eigentlich nicht einmal in einen anderen Mann. Seine Schultern blieben dieselben wuchtigen Schultern des Kommissar Maigret, und auch sein Körper verlor nicht an Gewicht.
Aber kaum hatte er den hellen, weitläufigen Flur betreten, fühlte er sich wie ein Kind; wie der Junge, der in seinem Heimatdorf im Allier noch vor Sonnenaufgang, mit vor Kälte aufgesprungenen Händen und geröteter Nase, die Luft angehalten hatte und auf Zehenspitzen in die Sakristei geschlichen war, um sein Ministrantengewand anzulegen.
Die Atmosphäre hier war ganz ähnlich. Kein Weihrauch, dafür ein süßlicher Arzneigeruch, jedoch nicht der abscheuliche Gestank der Krankenhäuser. Ein unbestimmer Duft, feiner, erhabener. Man ging über einen unvergleichlich weichen Linoleumboden. Die mit Ölfarbe gestrichenen Wände waren glatter und ihr Weiß satter als an irgendeinem anderen Ort. Selbst diese laue Luft, diese tiefe Stille fand man sonst nur in einem Kloster.
Er wandte sich wie aufgezogen nach rechts, verbeugte sich zum Gruß wie der Ministrant vor dem Altar und murmelte:
»Guten Tag, Schwester.«
In einem blitzeblanken gläsernen Büro mit eingelassenem Schalter saß eine Schwester mit Haube vor einem Register, lächelte und sagte:
»Guten Tag, Monsieur 6. Ich frage gleich nach, ob Sie hinaufgehen dürfen. Unserer lieben Patientin geht es zunehmend besser …«
Das war Schwester Aurélie. Im gewöhnlichen Leben hätte sie vermutlich ausgesehen wie eine fünfzigjährige Frau, aber unter der weißen Haube erschien ihr Gesicht alterslos und glatt wie ein Karamellbonbon.
»Hallo …«, sagte sie leise. »Sind Sie es, Schwester Marie des Anges? Monsieur 6 ist hier …«
Maigret ärgerte sich nicht, er wurde nicht einmal ungeduldig. Weiß Gott, wozu dieses wiederkehrende Zeremoniell nötig war. Man erwartete ihn wie immer. Man wusste, dass er Punkt drei kommen würde, und den Weg in den ersten Stock fand er auch allein.
Aber nein, sie hielten an ihren Gewohnheiten fest. Schwester Aurélie lächelte ihm zu, und er blickte zur Treppe mit dem roten Läufer, auf der jeden Moment Schwester Marie des Anges erscheinen würde.
Auch sie lächelte, die Hände in den weiten Ärmeln ihrer grauen Tracht.
»Wenn Sie mir folgen wollen, Monsieur 6?«
Gleich würde sie ihm zuflüstern:
»Unserer lieben Patientin geht es zunehmend besser …«
Als wäre das eine überwältigende Neuigkeit oder sogar ein Geheimnis.
Er ging auf Zehenspitzen und wäre womöglich rot geworden, wenn unter seinem Gewicht eine Stufe geknarzt hätte. Beim Sprechen wandte er sich ab, weil er um seinen Calvados-Atem fürchtete; nach dem Essen genehmigte er sich immer ein Gläschen.
Breite spindelförmige Sonnenstrahlen fielen schräg in den Gang, wie auf einem Heiligenbild. Hin und wieder kam ihm ein Rollbett mit einer Patientin entgegen, die zum Operationssaal geschoben wurde und von der er nur den starren Blick in Erinnerung behielt.
Und wie zufällig stand Schwester Aldegonde wieder einmal in der Tür des großen Saals mit den zwanzig Betten, als hätte sie dort etwas zu tun, nur um ihn im Vorübergehen mit einem ergebenen Lächeln zu grüßen:
»Guten Tag, Monsieur 6 …«
Ein paar Schritte weiter stieß Schwester Marie des Anges die Tür mit der Nummer 6 auf und trat zur Seite.
Aufrecht im Bett sitzend, mit einem merkwürdigen Ausdruck auf dem etwas blassen Gesicht, blickte ihm eine Frau entgegen. Es war Madame Maigret. Immer schien sie sagen zu wollen:
»Mein armer Maigret, wie hast du dich verändert …«
Warum ging er noch immer auf Zehenspitzen, sprach mit leiser Stimme, die gar nicht zu ihm passte, und bewegte sich so umsichtig wie in einem Porzellanladen? Er küsste sie auf die Stirn, sah die Orangen und die Kekse auf dem Nachttisch und auf der Bettdecke das Strickzeug, das ihn augenblicklich in Wut versetzte.
»Schon wieder?«
»Schwester Marie des Anges hat mir erlaubt, ein wenig zu stricken …«
Ein weiteres Ritual war, der alten Dame im Bett nebenan Guten Tag zu sagen. Madame Maigret hatte kein Einzelzimmer.
»Guten Tag, Mademoiselle Rinquet.«
Sie sah ihn mit ihren kleinen lebhaften und kalten Augen an. Seine Besuche vergrätzten sie. Während er da war, behielt ihr zerknittertes Gesicht einen mürrischen Ausdruck.
»Setz dich, mein armer Maigret …«
Sie war die Kranke. Und sie hatte man dringend operieren müssen, drei Tage nachdem sie in Les Sables eingetroffen waren, um ihre Ferien dort zu verbringen. Und nun war er der »arme« Maigret.
Es war viel zu heiß. Und dennoch hätte er um keinen Preis das Jackett ausgezogen.
Schwester Marie des Anges trat von Zeit zu Zeit ein, um ein Glas Wasser zu verrücken, ein Thermometer zu bringen oder irgendetwas anderes, weiß Gott warum.
Jedes Mal flüsterte sie:
»Verzeihung …«, und warf einen Blick auf Maigret.
Madame Maigret hingegen stellte ihm jeden Tag die gleiche Frage:
»Was hast du gegessen?«
Die Frage war durchaus nicht abwegig. Was hätte er denn anderes tun können als essen und trinken? Und in der Tat hatte er in seinem ganzen Leben noch nie so viel getrunken.
Am Tag nach der Operation hatte der Chirurg gesagt:
»Nur eine halbe Stunde!«
Nun war es zur Regel geworden. Er blieb eine halbe Stunde und hatte nichts zu sagen. Allein die Anwesenheit der zornigen alten Jungfer hinderte ihn daran, den Mund aufzumachen. Was erzählte er seiner Frau eigentlich sonst, wenn sie allein waren? Die Frage drängte sich ihm auf. Nichts, im Grunde. Warum also fehlte sie ihm den lieben langen Tag so sehr?
An ihrem Bett tat er nichts anderes als warten. Er wartete, bis die halbe Stunde um war. Nach wenigen Minuten nahm Madame Maigret ihr Strickzeug zur Hand, um Haltung zu wahren. Da sie Mademoiselle Rinquets Anwesenheit Tag und Nacht ertragen musste, nahm sie auf sie Rücksicht. Wann immer sie etwas sagte, beeilte sie sich hinzuzufügen:
»Nicht wahr, Mademoiselle Rinquet?«
Dann zwinkerte sie Maigret zu, und er erriet, dass die Damen einander ihre Wehwehchen nicht zumuten mochten. Vor allem Madame Maigret scheute sich davor, umso mehr, als sie nebeneinander ans Bett gefesselt waren.
»Ich habe meiner Schwester eine Karte geschrieben. Sei so gut und bring sie zur Post.«
Er hatte die Ansichtskarte, auf der die Klinik mit ihrer hübschen weißen Fassade und dem grünen Tor zu sehen war, in die linke Tasche seines Jacketts gesteckt.
Ein belangloses Detail. Linke Tasche? Rechte Tasche? Diese Frage sollte ihm am selben Abend um elf Uhr noch zu schaffen machen.
Seit vielen Jahren, seit jeher sozusagen, hatte jede seiner Taschen eine eigene Bestimmung. In die linke Hosentasche gehörten der Tabakbeutel und das Taschentuch – sodass es immer voller Tabakkrümel war. In die rechte die beiden Pfeifen und das Kleingeld. Hinten links, vollgestopft mit unnützen Papieren, die Brieftasche, die eine Gesäßhälfte dicker erscheinen ließ.
Schlüssel trug er nie bei sich. Und wenn doch, verlor er sie. In die Taschen seines Jacketts steckte er kaum etwas, vielleicht eine Streichholzschachtel in die rechte. So hatte er Platz für Zeitungen oder Briefe, die er in die linke Tasche schob.
Hatte er das auch an diesem Tag getan? Vermutlich. Er hatte am Milchglasfenster gesessen. Schwester Marie des Anges war zwei- oder dreimal hereingekommen und hatte verstohlen, jedoch mit Nachdruck in seine Richtung geblickt. Sie war sehr jung, ihr Gesicht glatt und rosig.
Ein Dummkopf hätte vielleicht behauptet, sie sei in ihn verliebt, denn sie hatte es immer sehr eilig, ihn an der Treppe abzuholen, und verhielt sich ungeschickt, wenn er im Zimmer war.
Er wusste es besser, im Grunde rührte ihr Verhalten von einer kindlichen Naivität und Unbedarftheit.
Allein ihr Einfall, ihn Monsieur 6 zu nennen, um ihn vor der Neugier der Leute zu schützen, die ihm zuwider war. Er mochte es nicht, wenn man mit seinem Namen hausieren ging. Er hatte schließlich Ferien.
Aber womöglich gefielen ihm die Ferien in Wahrheit überhaupt nicht. Das ganze Jahr hatte er geklagt, sich nach ein paar ruhigen Tagen gesehnt, nach leeren Stunden, die sich endlos aneinanderreihten und über die er frei verfügen konnte, Tage ohne Verpflichtungen, ohne Termine. In Paris, in seinem Büro am Quai des Orfèvres war ihm das wie ein unvorstellbares Glück vorgekommen.
Fehlte ihm nun etwa Madame Maigret?
Nein. Er kannte sich. Er grummelte. Er grollte. Und wusste doch, dass es ihm mit diesem Urlaub nicht anders ergehen würde als mit allen anderen. In sechs Monaten, in einem Jahr würde er denken:
»Du lieber Himmel, wie gut ging es mir doch in Les Sables …«
Diese Klinik, in der er sich so unbehaglich fühlte, würde ihm wie ein zauberhafter Ort vorkommen, und mit Rührung würde er an das unschuldige, leicht errötende Gesicht von Schwester Marie des Anges zurückdenken.
Er zog niemals seine Uhr hervor, bevor die Glocke der kleinen Kapelle nicht halb vier geschlagen hatte. Er gab sogar vor, er hätte sie nicht gehört. Ob Madame Maigret sich tatsächlich täuschen ließ? Denn immer war sie es, die sagte:
»Es ist Zeit, Maigret …«
»Ich rufe dich morgen früh an«, erklärte er, während er sich erhob. Als wäre das eine große Neuigkeit.
Er rief jeden Morgen an. Im Zimmer gab es kein Telefon, aber Schwester Aurélie am Empfang antwortete stets:
»Unsere liebe Patientin hatte eine ausgezeichnete Nacht.«
Bisweilen fügte sie hinzu:
»Der Herr Pfarrer wird ihr gleich Gesellschaft leisten.«
Seine Tage verliefen geregelter als die eines Häftlings im Zuchthaus von Fresnes. Er verabscheute Verpflichtungen. Allein der Gedanke, sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einfinden zu müssen, brachte ihn in Rage. Nun hatte er sich selbst einen Zeitplan erstellt und folgte ihm gewissenhafter als die Eisenbahn.
In welchem Augenblick mochte wohl der Zettel in seine linke Jackentasche gesteckt worden sein?
Er war kariert, wahrscheinlich aus einem Notizbuch gerissen. Die Wörter darauf waren mit Bleistift geschrieben, in einer gleichmäßigen und, wie ihm schien, weiblichen Handschrift.
Suchen Sie aus Barmherzigkeit die Patientin in Zimmer 15 auf.
Die Unterschrift fehlte. Nur diese Worte. Er hatte die Ansichtskarte seiner Frau in die linke Tasche gesteckt. War der Zettel schon dort gewesen? Möglich. Er hatte seine Hand vielleicht nicht sehr tief in die Tasche geschoben.
Aber als er die Karte schließlich in den Briefkasten an der Markthalle geworfen hatte?
Vor allem irritierten ihn zwei Wörter: aus Barmherzigkeit.
Warum aus Barmherzigkeit? Wer ihn sprechen wollte, konnte es einfach tun. Er war doch nicht der Papst.
Aus Barmherzigkeit … Das passte zu der süßlichen Atmosphäre, die ihn jeden Nachmittag einhüllte, zu dem wie mit einem Radiergummi verwischten Lächeln der Schwestern und den scheuen Seitenblicken von Schwester Marie des Anges.
Nein! Er zuckte mit den Schultern. Die Vorstellung, Schwester Marie des Anges könnte ihm einen Zettel in die Tasche gesteckt haben, lag im fern. Eher noch Schwester Aldegonde, die immer genau dann im Flur vor dem großen Saal etwas zu schaffen hatte, wenn er vorüberging. Schwester Aurélie hingegen saß immer hinter ihrer Scheibe am Empfang.
Obwohl … Ihm fiel ein, dass sie, als er hinausgehen wollte, vor ihrem Büro gestanden und ihn bis zur Tür begleitet hatte.
Und da er schon einmal dabei war – warum nicht die alte Mademoiselle Rinquet? Er hatte ihr Bett gestreift. Oder Doktor Bertrand? Ihm war er auf der Treppe begegnet …
Er wollte nicht darüber nachdenken. Im Übrigen war es sinnlos. Er hatte den Zettel abends um halb elf gefunden. Kaum war er im Hôtel Bel Air auf seinem Zimmer angelangt, hatte er wie immer, bevor er sich auszog, seine Taschen geleert und den Inhalt auf die Kommode gelegt.
Wie an den Tagen zuvor hatte er viel getrunken. Das war weder seine Schuld noch seine Absicht gewesen. Die Tage in Les Sables hatten ihm diesen Rhythmus vorgegeben.
So musste er zum Beispiel schon morgens um neun, kaum dass er die Treppe heruntergekommen war, ein Glas trinken.
Um acht brachte ihm Julie, das kleinere der beiden Zimmermädchen mit den dunkleren Haaren, den Kaffee ans Bett. Warum stellte er sich schlafend, wo er doch schon seit sechs Uhr wach war?
Auch so eine Angewohnheit. Urlaub bedeutete auszuschlafen. Dreihundertzwanzig Tage im Jahr und öfter stand er im Morgengrauen auf, und jedes Mal schwor er sich:
»Wenn ich erst in den Ferien bin, werde ich mich richtig ausschlafen!«
Sein Zimmer lag zum Meer hin. Es war August. Er schlief bei offenem Fenster. Die Vorhänge aus altem rotem Rips ließen sich nicht zuziehen, und so sorgten sowohl das Sonnenlicht als auch das Rauschen der Brandung am Sandstrand dafür, ihn zu wecken.
Gleich darauf übernahm die Dame aus Nummer 3. Sie hatte gemeinsam mit ihren vier Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und acht Jahren das Zimmer zu seiner Linken bezogen.
Eine Stunde lang Gebrüll, Gezeter, ein Hin und Her. Maigret sah deutlich vor sich, wie sich die Dame mit ihrer nörgelnden Brut herumschlug: halb angekleidet, barfuß in Latschen, mit offenen Haaren. Den einen steckte sie in die Ecke, den anderen ins Bett, der Älteste fing sich eine Ohrfeige und weinte, den Schuh der Kleinen konnte sie nirgendwo finden und verzweifelte schließlich daran, den Kocher in Gang zu bringen, um das Fläschchen für das Jüngste aufzuwärmen. Der Spiritusgeruch drang unter der Verbindungstür hindurch bis zu seinem Bett.
Die beiden Alten zu seiner Rechten veranstalteten ein anderes Theater. Sie redeten ununterbrochen, mit gedämpften Stimmen und so monoton, dass man die des Mannes von der der Frau nicht unterscheiden und bald meinen konnte, sie beteten Psalmen herunter.
Wollte man in das Etagenbad, musste man den Geräuschen des Abflusses und der Wasserspülung lauschen, um den richtigen Moment abzupassen. Maigrets Zimmer hatte einen kleinen Balkon, und er trat im Morgenmantel hinaus. Die Aussicht war herrlich: der breite, blendende Strand und auf dem Meer blaue und weiße Segel. Er sah zu, wie man die gestreiften Sonnenschirme aufstellte und die ersten Knirpse in ihren roten Badeanzügen auftauchten.
Wenn er hinunterging, frisch rasiert, einen Rest Seifenschaum an den Ohren, war er schon bei der dritten Pfeife.
Was trieb ihn dazu, den Weg durch die Hinterräume zu nehmen? Er hätte, wie alle anderen, durch den hellen Speisesaal hinausgehen können, den Germaine, das dickliche Zimmermädchen mit dem unerhörten Busen, gerade bohnerte.
Aber nein. Er stieß die Tür zum Esszimmer der Wirtsleute auf und dann die zur Küche. Um diese Zeit trug Madame Léonard die Brille auf der Nase und besprach mit dem Koch die Speisekarte. Wie auf Knopfdruck tauchte Monsieur Léonard aus dem Keller auf. Man sah ihn immer aus dem Keller kommen, ganz gleich zu welcher Tageszeit, dabei machte er einen eher nüchternen Eindruck.
»Schöner Tag heute, Herr Kommissar …«
Monsieur Léonard trug Pantoffeln und hatte seine Hemdsärmel aufgekrempelt. Schüsseln voller grüner Erbsen, frisch geschälter Karotten, Porree, Kartoffeln standen bereit. Auf der weißen Tischplatte lagen blutige Fleischstücke; Seezungen und Steinbutte warteten darauf, geschuppt zu werden.
»Wie wäre es mit einem Schluck Weißen, Herr Kommissar?«
Das war der erste am Tag. Der Schluck Weißwein vom Wirt. Übrigens ein ausgezeichneter leichter Wein, der ins Grünliche hinüberspielte.
Maigret konnte sich doch nicht zwischen all die Mütter an den Strand setzen. Er spazierte über die Uferpromenade, den Remblai. Hin und wieder blieb er stehen und betrachtete das Meer, die zunehmende Anzahl bunter Gestalten in der seichten Brandung. Beim Stadtzentrum bog er rechts ab und gelangte über einen schmalen Weg zur Markthalle.
Andächtig schlenderte er von Stand zu Stand, ganz so, als hätte er vierzig Personen zu versorgen. Besonders aufmerksam betrachtete er die zappelnden Fische, die Schalentiere, hielt einem Hummer ein Streichholz hin, der sogleich mit seinen Scheren danach griff …
Der zweite Weißwein. Denn gleich gegenüber gab es ein kleines Bistro, zu dem es eine Stufe hinunterging. Es bildete sozusagen die Verlängerung des Marktplatzes, der seine angenehmen Gerüche bis dorthin verströmte.
Anschließend ging er an der Kirche Notre-Dame vorbei, um eine Zeitung zu kaufen. Sollte er die etwa auf seinem Zimmer lesen?
Er kehrte auf den Remblai zurück und setzte sich vor ein Café, immer an denselben Tisch. Und immer zögerte er, wenn der Kellner seine Bestellung aufnehmen wollte. Als müsste er darüber nachdenken!
»Ein Glas Weißwein, bitte …«
Es hatte sich eben so ergeben. Zu Hause trank er bisweilen monatelang keinen Weißwein.
Um elf Uhr ging er ins Café hinein, um die Klinik anzurufen und Schwester Aurélie mit ihrer butterweichen Stimme sagen zu hören:
»Unsere liebe Patientin hatte eine ausgezeichnete Nacht …«
So hatte er es eingerichtet, sich tagaus, tagein zu einer gewissen Stunde an einem gewissen Ort einzufinden. Auch im Speisesaal des Hotels hatte er sein Plätzchen gefunden, am Fenster, gegenüber dem Tisch seiner beiden alten Zimmernachbarn.
Am ersten Tag hatte er nach dem Kaffee einen Calvados bestellt. Seither fragte ihn Germaine zwangsläufig:
»Einen Calvados, Herr Kommissar?«
Er traute sich nicht, Nein zu sagen, und fühlte sich bald wie benommen.
Die Sonne brannte manchmal so stark, dass der Asphalt der Promenade unter den Sohlen schmolz und sich das Profil der Autoreifen darin eindrückte.
Maigret ging in sein Zimmer hinauf, um Mittagsschlaf zu halten, allerdings nicht in seinem Bett, sondern im Sessel, den er auf den Balkon zog, und mit einer Zeitung, die er über sein Gesicht breitete.
Suchen Sie aus Barmherzigkeit die Patientin in Zimmer 15 auf …
Wie er nun von Stunde zu Stunde von einem Stammplatz zum nächsten wanderte, hätte man meinen können, er gehöre ebenso zum Stadtbild wie die Kartenspieler am Nachmittag. Dabei waren seine Frau und er erst vor neun Tagen angereist. Am ersten Abend hatten sie Muscheln gegessen. Darauf hatten sie sich schon in Paris gefreut: eine große Schüssel fangfrischer Muscheln.
Prompt wurde beiden schlecht, und die Nachtruhe ihrer Zimmernachbarn war dahin. Am nächsten Tag ging es ihm besser, aber Madame Maigret beklagte sich am Strand über Bauchschmerzen. In der zweiten Nacht bekam sie Fieber. Noch immer glaubten sie, es sei nichts Schlimmes.
»Ich hätte es besser wissen müssen. Muscheln sind mir noch nie bekommen …«
Am übernächsten Tag litt sie solche Schmerzen, dass man Doktor Bertrand rufen musste, der sie als Notfall in die Klinik einwies. Das waren schwere Stunden gewesen, Stunden der Ungewissheit, ein Kommen und Gehen, neue Gesichter, Röntgenaufnahmen, Untersuchungen.
»Ich versichere Ihnen, Herr Doktor, es waren die Muscheln«, sagte Madame Maigret immer wieder und lächelte schwach.
Aber die Ärzte lächelten nicht, als sie Maigret beiseitenahmen.
Eine akute Blinddarmentzündung, die sofort operiert werden müsse, sonst drohe ein Durchbruch.
Während des Eingriffs ging er mit langen Schritten den Gang auf und ab, zusammen mit einem jungen Mann, der auf die Entbindung seiner Frau wartete und sich die Fingernägel blutig biss.
So war er zu Monsieur 6 geworden.
Sechs Tage reichen aus, um neue Gewohnheiten anzunehmen. Man lernt, geräuschlos zu gehen, Schwester Aurélie ein zuckersüßes Lächeln zu schenken, und auch Schwester Marie des Anges. Man ringt sich sogar ein Lächeln für die unausstehliche Mademoiselle Rinquet ab.
Woraufhin jemand die Gelegenheit nutzt, um einem einen albernen Zettel zuzustecken.
Wer lag überhaupt auf Nummer 15? Madame Maigret wusste es bestimmt. Sie alle kannten einander, ohne sich je zu Gesicht zu bekommen, wussten über fremde Angelegenheiten Bescheid. Manchmal erzählte sie ihrem Mann davon, diskret und mit gedämpfter Stimme wie in der Kirche.
»Die Dame auf Nummer 11 ist sehr nett und so lieb … Und dabei … Die Ärmste … Komm ein wenig näher …«
Und rasch murmelte sie:
»Brustkrebs …«
Dann warf sie einen Blick auf Mademoiselle Rinquet und senkte die Lider, um anzudeuten, dass auch sie Krebs hatte.
»Wenn du die hübsche junge Frau gesehen hättest, die man in den Saal gebracht hat …«
Der Saal war das große Mehrbettzimmer. Auch in der Klinik gab es drei Klassen, wie in den Zügen: Der Saal entsprach der dritten Klasse, die Zimmer mit zwei Betten der zweiten, und an der Spitze waren die Einzelzimmer.
Wozu sich den Kopf zerbrechen? Das alles war doch lächerlich. In der Klinik ging es schon etwas albern zu. Verhielten sich die Schwestern nicht geradezu kindisch?
Und die Patienten erst, mit ihren Eifersüchteleien und ihrer Geheimniskrämerei und der grenzenlosen Gier nach Süßigkeiten, immer die Ohren gespitzt, ob nicht jemand durch den Gang kam.
Aus Barmherzigkeit …
Durch diese beiden Wörter hatte sich die Frau verraten. Warum sollte die Patientin auf Nummer 15 ihn brauchen? Das konnte er doch nicht ernst nehmen, er würde sich keinesfalls an Schwester Aurélie wenden und sie um die Erlaubnis bitten, jemanden zu besuchen, dessen Namen er nicht einmal kannte.
Die Sonne schien unerträglich heiß auf den Strand und die Stadt. Manchmal flirrte die Luft, und wenn man plötzlich in den Schatten trat, sah man eine ganze Weile nichts als Rot.
Nun denn! Maigret hatte seinen Mittagsschlaf beendet. Er faltete die Zeitung zusammen, warf das Jackett über die Schulter, zündete die Pfeife an und ging hinunter.
»Bis nachher, Herr Kommissar …«
Ein Gruß folgt auf den nächsten wie Segenssprüche, den lieben langen Tag. Alle waren sie freundlich und lächelten. Es ging ihm allmählich auf die Nerven, und er wurde mürrisch. Ein tüchtiger Platzregen, ein Streit mit jemandem, der darauf aus war, das hätte ihn erleichtert.
Das grüne Tor, der Glockenschlag um drei. Er brachte es nicht einmal fertig, die Uhr stecken zu lassen!
»Guten Tag, Schwester …«
Er hätte ebenso gut noch einen Knicks machen können. Auf zur Nächsten, Schwester Marie des Anges, die ihn bereits auf der Treppe erwartete.
»Guten Tag, Schwester …«
Und Monsieur 6 trat auf Zehenspitzen in das Zimmer von Madame Maigret.
»Wie geht es dir?«
Sie bemühte sich zu lächeln.
»Du hättest mir keine Orangen mitbringen müssen. Ich habe noch welche …«
»Du kennst doch sicher alle Patienten hier …«
Warum gab sie ihm ein Zeichen? Er drehte sich zu dem Bett von Mademoiselle Rinquet. Die alte Dame hatte ihren Kopf im Kissen vergraben und lag zur Wand gekehrt.
Er flüsterte:
»Geht es ihr nicht gut?«
»Es geht nicht um sie … Pst … Komm ein wenig näher.«
Eine Tuschelei wie in einem Mädchenpensionat.
»Heute Nacht ist jemand gestorben …«
Sie achtete auf Mademoiselle Rinquet, deren Bettdecke sich bewegte.
»Es war grauenhaft, man konnte ihre Schreie bis hierher hören. Und dann ist die Familie gekommen. Es hat über drei Stunden gedauert … Ein einziges Hin und Her. Wir haben uns fürchterlich erschreckt … Vor allem, als der Pfarrer zur Letzten Ölung kam. Sie hatten zwar das Licht im Flur gelöscht, aber alle wussten Bescheid …«
Fast gehaucht fügte Madame Maigret hinzu, wobei sie auf ihre Zimmernachbarin deutete:
»Sie glaubt, sie sei die Nächste …«
Maigret wusste nicht, was er sagen sollte. Er stand da, schwerfällig und ungelenk, um ihn herum eine fremde Welt.
»Es war eine junge Frau. Eine sehr hübsche, heißt es. Zimmer 15 …«
Sie fragte sich, warum er seine dichten Augenbrauen hochzog und unwillkürlich eine Pfeife aus der Tasche zog, die er dann aber doch nicht stopfte.
»Bist du sicher, dass es Zimmer 15 war?«
»Aber ja … Warum denn?«
»Einfach so.«
Er setzte sich. Es hatte keinen Sinn, Madame Maigret von dem Zettel zu erzählen, sie würde sich sofort aufregen.
»Was hast du gegessen?«
Mademoiselle Rinquet hatte angefangen zu weinen. Ihr Gesicht war nicht zu sehen, nur die spärlichen Haare auf dem Kopfkissen, aber die Decke bewegte sich rhythmisch, zuckend.
»Du solltest nicht allzu lang bleiben …«
Ganz offensichtlich hatte er mit seiner Rossnatur in diesem Haus der Kranken und Ordensschwestern, die auf leisen Sohlen herumhuschten, nichts verloren.
Bevor er ging, fragte er:
»Weißt du, wie sie hieß?«
»Wer?«
»Die junge Frau von Zimmer 15.«
»Hélène Godreau.«
Jetzt erst bemerkte er, dass Schwester Marie des Anges gerötete Augen hatte und ihm böse zu sein schien. Hatte sie ihm den Zettel zugesteckt?
Er fühlte sich außerstande, sie danach zu fragen. Alles in diesem Haus unterschied sich so entschieden von der Umgebung, in der er sich sonst aufhielt, den staubigen Fluren im Polizeipräsidium, den Leuten, denen er in seinem Büro einen Platz anwies, ihm gegenüber, und denen er lange in die Augen sah, bevor er ihnen mit seinen unerbittlichen Fragen zusetzte.
Außerdem ging ihn das gar nichts an. Eine junge Frau war gestorben. Na und? Jemand hatte ihm einen Zettel in die Tasche gesteckt, mit einer Nachricht, die nichts besagte …
Im Grunde verbrämte er seine Tage damit, dass er im Kreis lief wie ein Zirkuspferd. Genau jetzt war es zum Beispiel höchste Zeit für die Brasserie du Remblai. Als hätte er dort eine wichtige Verabredung.
Der Saal war geräumig und hell. An den Tischen vor den breiten Fenstern, die auf den Strand und das Meer gingen, saßen Gäste, die er mit keinem Blick würdigte; Unbekannte, Sommerfrischler, die nur gelegentlich hierherkamen und auch keine Stammplätze hatten.
Im hinteren Bereich, in einer großen Ecke hinter dem Billardtisch, war es ganz anders: An zwei Tischen saßen dort schweigsame Männer mit ernsthafter Miene, deren kleinste Gesten den aufmerksamen Kellner in Bewegung setzten.
Das waren die Honoratioren, die Reichen und Alten. Einige hatten noch erlebt, wie man die Brasserie erbaut hatte, und manche hatten Les Sables schon gekannt, bevor der Remblai errichtet worden war.
Jeden Nachmittag fanden sie sich hier ein, um Bridge zu spielen. Jeden Nachmittag gaben sie sich die Hand, schweigend oder mit immer denselben wenigen Worten, ein Ritual.
Sie hatten sich an die Anwesenheit von Maigret gewöhnt, der nicht mitspielte, sondern rittlings auf einem Stuhl saß und zusah, wobei er seine Pfeife rauchte und Weißwein trank.
Die meisten hoben die Hand zum Gruß. Nur der örtliche Polizeikommissar, Monsieur Mansuy, der ihn jenen Herren vorgestellt hatte, stand auf, um ihm die Hand zu geben.
»Und Ihrer Frau geht es allmählich besser?«
»Ja.«
Die Antwort erfolgte mechanisch, und er setzte beiläufig hinzu:
»Heute Nacht ist in der Klinik eine junge Frau gestorben.«
Er hatte leise gesprochen, aber selbst mit halber Kraft tönte seine Stimme noch voluminös, umso mehr, als an beiden Tischen Stille herrschte.
An der Reaktion der Männer merkte er, dass er einen Fehler begangen hatte. Zudem deutete ihm der Polizeikommissar an, nicht weiter darüber zu sprechen.
Obwohl er dem Spiel seit sechs Tagen zusah, begriff er die Regeln noch immer nicht. An diesem Tag begnügte er sich damit, die Gesichter zu beobachten.
Monsieur Lourceau, der Reeder, war uralt, aber groß und noch immer kräftig, mit hochrotem Gesicht unter den weißen Haaren. Er konnte von allen am besten Bridge spielen, und wenn sein Partner einen Fehler machte, warf er ihm einen nicht eben ermutigenden Blick zu.
Depaty, der Grundstücksmakler, der sich vor allem mit Villen und Siedlungen befasste, war lebhafter, mit verschmitzten Augen, trotz seiner siebzig Jahre.
Es gab noch einen Bauunternehmer, einen Richter, einen Schiffbauer und den stellvertretenden Bürgermeister.
Der Jüngste musste zwischen fünfundvierzig und fünfzig sein. Gerade beendete er eine Partie. Er war von schmaler Gestalt, ausdrucksstark und entschlossen, mit lebhaften Augen und glänzend braunen Haaren. Seine Kleidung schien äußerst sorgfältig gewählt und von erlesener Eleganz.
Als er seine letzte Karte gespielt hatte, erhob er sich wie üblich und ging zur Telefonkabine. Maigret sah auf die Wanduhr. Es war halb fünf. Jeden Tag um halb fünf telefonierte er.
Kommissar Mansuy, der für die nächste Partie mit seinem Nachbarn den Platz tauschte, beugte sich zu seinem Kollegen hinüber und flüsterte:
»Die Tote ist seine Schwägerin …«
Der Mann, der jeden Tag während der Partie in der Brasserie seine Frau anrief, war Doktor Bellamy. Er wohnte kaum dreihundert Meter entfernt, in einem großen weißen Haus hinter dem Kasino, genau genommen zwischen Kasino und Mole, dort, wo sich die drei oder vier schönsten Anwesen der Stadt befanden. Man konnte seine Villa vom Fenster aus sehen. Die ebene, makellose Fassade, durchbrochen von hohen, breiten Fenstern, erinnerte an die Klinik. Auch sie strahlte Ruhe und Würde aus.
Doktor Bellamy kam scheinbar ungerührt zum Tisch zurück, wo man ihn erwartete und die Karten schon verteilt hatte. Monsieur Lourceau, dem es missfiel, wenn der feierliche Ernst des Bridgespiels durch Belanglosigkeiten gestört wurde, zuckte mit den Schultern. Vermutlich ging das schon seit Jahren so.
Der Doktor war kein Mann, der sich beeindrucken ließ. Seine Miene zeigte keine Regung. Er überblickte sein Blatt und sagte dann knapp:
»Zwei Kreuz.«
Während des Spiels begann er zum ersten Mal, Maigret verstohlen zu mustern. Seine Blicke gingen so rasch, dass man sie kaum bemerkte.
Aus Barmherzigkeit …
Warum schlich sich plötzlich ein Satz in Maigrets Gedanken, ganz ohne sein Zutun, und setzte sich dort fest?
»Jedenfalls ist das mal einer, der nicht aus Barmherzigkeit handeln würde …«
Selten hatte er in die Augen eines Menschen geblickt, die eine solche Härte ausstrahlten und gleichzeitig glühten, eines Menschen, der seine Gefühle in einem solchen Maß beherrschte, dass er gar nichts preisgab.
An den Tagen zuvor hatte Maigret das Ende des Spiels nicht abgewartet. Er hatte noch seine übrigen Stammplätze aufsuchen müssen. Der Gedanke, auch nur das Geringste an seinen Gewohnheiten zu ändern, erschütterte ihn.
»Sind Sie um sechs noch hier?«, fragte er Kommissar Mansuy.
Der warf einen Blick auf seine Uhr, weiß Gott warum, und nickte.
Diesmal ging er den Remblai bis zum Ende und am Haus von Doktor Bellamy vorbei, eines jener Anwesen, vor dem die Spaziergänger sehnsüchtig und voller Neid stehen bleiben.
Und weiter zum Hafen, vorbei an der Werkstatt des Segelmachers, den am Weg ausgebreiteten Segeln, vorbei an der Fähre, den Blick auf die Schiffe gerichtet, die aus- und einliefen und gleich gegenüber dem Fischmarkt Seite an Seite festmachten.
Dort war ein kleines grün angestrichenes Café, zu dem man vier Stufen hinuntergehen musste: eine dunkle Theke, zwei, drei Tische mit braunem Wachstuch. Die Männer, alle blau gekleidet, hatten ihre hohen Gummistiefel an den Oberschenkeln umgeschlagen.
»Einen kleinen Weißwein, bitte …«
… der weder so schmeckte wie jener im Hôtel Bel Air noch wie der in der Markthalle oder der in der Brasserie du Remblai.
Nun blieb ihm noch, den Quai entlangzuspazieren, an seinem Ende rechts abzubiegen und durch die schmalen Straßen mit ihren einstöckigen Häusern voller Leben, Geräusche und Gerüche zurückzuschlendern.
Als er um sechs Uhr die Brasserie du Remblai erreicht hatte, war Kommissar Mansuy soeben auf den Gehsteig getreten und zog seine Uhr auf.