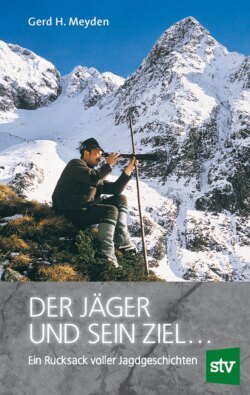Читать книгу Der Jäger und sein Ziel ... - Gerd H Meyden - Страница 7
Wilderer
Оглавление„Halt! Stehen bleiben! Gewehr weg! Hände hoch!“
Dieser Ausruf gehört einfach in eine richtige Wilderergeschichte. In meinem Fall hätte es aber heißen müssen: „Hände hoch! Steinschleuder weg!“ Das war mein Werkzeug, bis später das Luftgewehr dazukam.
Doch nun der Reihe nach. In den ersten Nachkriegsjahren war ich mit knapp elf Jahren ein Meister der Steinschleuder. Die war nicht so einfach herzustellen, denn der Gummi dazu musste wegen seiner Zugkraft aus Schläuchen von Autoreifen stammen. Heutzutage haben Autos schlauchlose Reifen, die waren damals noch nicht einmal Zukunftsmusik. Neue Autoreifenschläuche waren kaum zu bekommen, die alten wurden deshalb geflickt und geflickt, bis sie regelrecht bunt vor lauter Flickstellen waren. Solche Schlauchfragmente wurden unter uns Buben hoch gehandelt und wir, das heißt mein Bruder und ich, hatten einen Freund, dessen Eltern ein Fuhrunternehmen besaßen. Ein Fuhrunternehmen zwar ohne Autos, doch es fanden sich in der Garage Gummireste einstiger Herrlichkeit.
Man brauchte obendrein für die Schleuder eine hölzerne Gabel, die im richtigen Wuchs vornehmlich in Fliedersträuchern zu finden ist. Das Lederstück für die Geschoße zwischen den beiden Gummienden war zwar auch Mangelware, doch nicht ganz so rar wie der Gummi.
Mit der Zeit gewann ich an Treffsicherheit. Geübt wurde ja genug in der reichlichen Freizeit. Die oft taumelnde Flugbahn der geschleuderten Steine lag an deren unregelmäßiger Oberfläche. Rund waren die Steine nie, und so wurde die Ballistik mit wachsender Entfernung unberechenbar.
Spatzen oder Amseln konnte man nur auf nahe Entfernung beschießen und treffen. Eichkatzeln, Ringeltauben oder gar Häher und Krähen – kein Gedanke, die waren zu weit weg, und die Durchschlagskraft hätte auch nicht ausgereicht.
Ich jagte nach meiner Ansicht streng weidgerecht. Mein Wissen darüber hatte ich aus einem uralten Buch von Ludwig Ernst Hartig: „Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen“. Da wurde noch klar unterschieden zwischen „schädlichem“ und „nützlichem“ Jagdwild. So rangierten Meisen, Spechte, Rotkehlchen und andere Singvögel unter „nützlich“ und wurden geschont. Dieses über zweihundert Jahre alte Buch bereichert meine Jagdbibliothek und trägt immer noch die verschandelnden Vermerke, die ich als Bub damals zu den einzelnen Kapiteln glaubte hineinschmieren zu müssen.
Da kam mir zur Perfektionierung meiner Treffsicherheit das Kriegsende zur Hilfe. In der Nähe unseres Wohnorts führte eine, nun stillgelegte, Bahnstrecke vorbei. Auf den leise vor sich hin rostenden Gleisen standen von Tieffliegern der Amerikaner zerschossene, ausgebrannte Waggons. In einer dieser brandgeschwärzten Ruinen fand ich, was ich dringend brauchte. Es muss wohl seinerzeit ein Munitionszug gewesen sein, denn ich fand eine Unmenge von Projektilen für die 08-Wehrmachtspistole. Diese Stahlmantelgeschoße hatten einen Bleikern. Das war’s! Obwohl auch die Bleikerne nicht rund waren, war ihre Flugbahn durch das hohe Gewicht bei geringem Volumen gestreckt wie bei einer Hochrasanzpatrone. Natürlich immer in den Grenzen der Schleuder-Reichweite. Das eröffnete mir neue, in jener jagdgesetzlosen Zeit nun nicht mehr ganz so harmlose Jagd-(sprich: Wilderer)möglichkeiten.
Die Treffsicherheit war so hoch, dass „fast“ jeder Spatz, der auf der Strom- oder Telegrafenleitung saß, steintot herunterfiel. Wobei „steintot“ mit der neuen Munition besser „bleitot“ hätte heißen müssen. Jetzt ging’s auf die Tauben und Eichkatzeln los.
Gleich das erste Opfer, ein schönes rotbraunes Eichkatzel, fiel voll getroffen aus einer Kiefer vor meine Füße. Mit einem Triumphschrei packte ich meine Beute. Doch der Triumphschrei wurde zum Schmerzensschrei, denn das Tier biss mich im Verenden in die linke Hand. Voll in das Dreieck zwischen Daumen und Zeigefinger. Und zwar absolut durch, mit allen vier Nagezähnen. Es schweißte höllisch, das war mein Glück. Denn nachdem ich die Bissstelle ausgesaugt, das Blut ausgespuckt und die Hand eine Zeit lang hochgehalten hatte, kam auch die Blutung zum Stillstand. Von Tetanus und Wundinfektion hatte ich keine Ahnung. Kinder und Narren haben Glück, es geschah nichts dergleichen, nur die Narbe ist mir bis heute geblieben.
Beute zu machen und sie nicht zu verwerten war absurd. So balgte ich das Tierlein ab und es wurde, wie schon die Amseln und Spatzen vorher, in unserem Garten am offenen Feuer gebraten. Sicher schmeckte es ein wenig bitter, denn wie unsere „Brathühner“ war auch das Nagetier schwarz verbrannt. Wir Buben kamen uns vor wie Indianer oder Urmenschen, die waren auch nicht so zimperlich. Und wir fanden, dass es toll schmeckte.
Nach diesem Anfangserfolg wollte ich etwas für die „echte“ Küche beitragen. Das waren vorerst Ringeltauben. Doch die waren in unserem Garten selten, bis auf eine, die dann, stolz erlegt, den Geschmack der Familie geweckt und die Nachfrage angekurbelt hatte.
Bei meinen Streifzügen ins nahe Dachauer Moos und in die Amper Auen (die Gegend heißt heute – noch nicht zu Unrecht – „Himmelreich“) war mir ein einsam im weiten Moos stehender kleiner Fichtenhain aufgefallen. Nur einzelne Birken und neben Torfstichen stehende windschiefe Hütten unterbrachen das eintönige Landschaftsbild. Dorthin strichen am Abend die Tauben auf ihre Schlafbäume. Bei uns hieß es darum das „Taubenhölzl“. Dort wollte ich mein Weidmannsheil probieren. Mit meinem abenteuerlichen, aus lauter Schrottteilen zusammengebastelten Fahrrad schob ich mich dort in den Schatten ein.
Bei all meinen meist erfolglosen Beutezügen war unser Dackel „Strolchi“ dabei. Da die Entfernung bis zu den Amper Auen für die kleinen Dackelbeine zu groß war, um neben dem Radl herzulaufen, kam er in einen Rucksack. Dies war ein khakifarbener Beuterucksack eines fremden Heeres in Form eines Schulranzens. Der war ideal für den kleinen Insassen, da konnte er aus einer Seitenklappe den Kopf rausstrecken und schauen, wohin es ging.
Zuvor möchte ich Ihnen erzählen, wie er zu mir kam. Mein Mathe-Nachhilfelehrer (leider mussten meine lieben Eltern wegen meiner Lernfaulheit immer neue „Pädagogen“ finanzieren) hatte einen Wurf garantiert rassereiner Rauhaardackel. Da blieb es nicht aus, dass ich die geplagten Eltern, die in dieser Zeit ganz andere Sorgen hatten, so lange quälte, bis sie 50 nigelnagelneue D-Mark für den Welpen locker machten. Bald stellte sich heraus, dass es ein „mopsgedackelter Windhund“ mit einem prachtvoll geringelten Posthornschwanz – oder richtiger „Jagdhornschwanz“ – werden würde. Alle Versuche, die Rute mit einer Schiene gerade zu kriegen, scheiterten kläglich. Das tat jedoch meiner Liebe keinen Abbruch, und so wurde der Kleine zum Jagdhund ausgebildet – was das genau war, davon hatte ich allerdings noch wenig Ahnung. Fährten- oder besser Schleppenarbeit und Apportieren meisterte er bald vortrefflich.
So war er auch auf dieser Jagdfahrt mit dabei. Schon am Mittag fielen einige Tauben auf den Randbäumen ein. Aber selbst wenn ich mich auf Schussentfernung hätte anpirschen können, waren die vielen hinderlichen Äste vor dem Ziel ein Problem. Für einen Schrotschuss wären sie kein Hindernis gewesen, doch so eine Pistolenkugel, von der Schleuder abgeschnalzt, käme niemals durch das Gitterwerk.
Ich setzte mich dennoch an. Klatschenden Flügelschlags fielen immer wieder einige der rosenbrüstigen, zartblau gefiederten Köstlichkeiten ein. Für mich jedoch immer unerreichbar. Ich hörte, wie sie sich mit dem typischen, leise wiehernden Laut des Taubenflügelschlags immer wieder im Geäst umstellten. Dann aber zahlte sich meine Geduld – des Jägers wichtigste Eigenschaft, an der es mir oft mangelt – aus. Ein balzendes Taubenpaar flatterte plötzlich bis auf eine kaum beastete Stelle knapp vor mir herab. Dumpf schlug die Kugel auf und getroffen taumelte mein Opfer zu Boden. Schnell sauste mein kleiner Helfer los, und bevor der benommene Vogel wieder zu sich kommen konnte, war er unser.
Doch leider blieb dies ein Einzelfall. Sooft ich es probierte, diese Chance wiederholte sich nie mehr. Aber etwas anderes erweckte meine Neugier. Es waren nämlich mehrere Schüsse zu hören.
Dem Schall nach musste in etwa fünfhundert Meter Entfernung an der Amper jemand geschossen haben. Ich radelte hin. Da stand ein offener Ami-Militärjeep. Wo war der Jäger? Ein deutscher Jäger konnte es in diesen Endvierzigerjahren niemals sein, denn es herrschte durch das Jagdverbot jagdliche Anarchie. Amerikaner und auch manchmal sogenannte „DPs“ (Displaced Persons, also entlassene Gefangene, die sich das holten, was, wie sie glaubten, ihnen zustand) machten die Wälder unsicher. Wer da in „meinen Jagdgründen“ damals wirklicher Jagdberechtigter war, interessierte nicht, denn der konnte und durfte ja nicht jagen, geschweige denn eine Waffe besitzen.
Bald sah ich auch den Schützen. Er trug eine frisch erlegte Stockente in der Hand und kam auf mich zu, der ich neben seinem Jeep stand. Er sagte irgendetwas, was ich nur bruchstückweise verstand. Zwar hatte ich, gerade im ersten Gymnasiumsjahr, auch Englisch als Schulfach, doch was dieser Mann sprach, war ein dieser Kultursprache nur entfernt ähnliches Kauderwelsch – halt Amerikanisch.
Mühevoll machte er mir klar, dass er einen Helfer bräuchte, er hätte noch zwei weitere Enten geschossen, die er aber nicht finden konnte. Da sah ich meine Chance. „Dir werde ich helfen“, dachte ich mir, „aber nichts ist umsonst.“
Um es kurz zu machen: Eine Ente fand der brave Strolchi, die lieferte ich dem Soldaten ab, die zweite versteckte ich und verstaute sie, nachdem der Ami fort war, stolz in meinem Rucksack.
Das Zusammentreffen mit dem Major – als solcher gab er sich zu erkennen – wiederholte sich noch ein paar Male. Jedes Mal gelang es mir zwar nicht, Beute für mich abzuzweigen, doch wir verabredeten uns immer auf das nächste Zusammentreffen.
Eines Tages musste er lange auf mich warten, denn mein Radl war auf den letzten Kilometern regelrecht zusammengebrochen. Es waren halt irgendwelche Ersatzteile, die gar nicht in ihrer Norm zusammengehörten.
So hatte sich beispielsweise mein Bruder einen sportlichen Vorbaulenker für sein Rad eingehandelt. Der übliche Gesundheitslenker galt als „flaschig“ und war nur was für Opas. Doch, o weh, der Stiel des Lenkers, der in den Rahmen eingesteckt werden sollte, war zu dünn. So hatte mein Bruder den mangelnden Umfang mit einer Blechmanschette ausgeglichen. Er fuhr wie immer rasant dahin, doch irgendwann rutschte die Manschette herunter, der Lenker steckte nun kontaktlos und leer im Rahmen, und mein Bruder sauste in voller Fahrt gegen einen Strommasten. Kopfüber flog er – zum Glück – am Mast vorbei, doch der Rahmen des Radls wurde durch den Aufprall so gestaucht, dass das Rad um etliche Zentimeter kürzer und nun unbrauchbar geworden war.
Als ich an jenem Tag am Treffpunkt eintraf, wartete der Major bereits auf seinen Jagdhelfer. Ich machte ihm klar, dass ich sofort meinen Heimweg antreten müsse, denn mit dem Rest-Radl wäre es zu Fuß doch ein zu weiter Weg, um noch bis abends mitzujagen.
„Don’t worry!“, meinte er. Er würde mich samt Fahrrad mit seinem Jeep nach Hause bringen. Und so geschah es auch. Als er mich daheim ablieferte, kam er noch mit ins Haus und brachte als Gastgeschenk einen frisch geschossenen Hasen mit.
Mein Vater war zufällig daheim und kam aus dem Staunen über seinen Sprössling und dessen Umgang nicht mehr heraus. Allerdings war mein Staunen ebenfalls riesengroß, denn mein Erzeuger unterhielt sich mit dem Ami in fließendem Englisch.
Als unser Gast wieder fort war, fragte ich ihn verwundert, warum ich von seiner Sprachkenntnis bisher nichts gewusst hatte und forderte ihn auf, nochmals Englisch zu reden. Da sagte er, ich werde es nie vergessen: „I never saw such an idle boy as you.“
„Bitte, was heißt das?“
„Ich habe noch nie einen so faulen Burschen wie dich gesehen.“
Da hatte ich’s! Und zwar deutlich und zweisprachig.
Der Amerikaner tauchte nach ein paar Tagen wieder auf, und zwar in tadelloser Uniform mit allen Ordensspangen und in Begleitung seiner erzengelhaft blonden Gattin.
Verwundert ob dieser Förmlichkeit baten meine Eltern die zwei, Platz zu nehmen. Bald jedoch rückten sie mit dem Grund ihres Besuchs heraus: Sie wollten mich adoptieren und nach Amerika mitnehmen.
Ich sehe noch, wie meine Eltern nach Luft schnappten, sehe noch die entschiedenen Handbewegungen meines Vaters. Das war denn doch zu viel der Fraternisierung. Irgendwann fiel immer wieder das Wort „dog“. Hernach sagte mir mein Vater, er hätte den Amerikanern klargemacht, sein Sohn sei doch kein Hund, den man weiterverkaufe. Anschließend verbot er mir weitere Begegnungen mit dem jagenden Ami. Die Fahrten ins Amper-Moos waren sowieso vorerst vorbei, denn ich hatte ja nun kein Radl mehr.
Ein Jahr ging ins Land, da bekam ich nicht nur ein gebrauchtes Fahrrad, sondern es war mir gelungen, auf finsteren Tauschhandelswegen ein Luftgewehr zu ergattern.
Das war ein sogenannter Bügelspanner. Der Luftkolben auf dem Schaft wurde mit einem seitlich ausschwenkbaren Hebel – dem Bügel – gespannt und mit Pressluft gefüllt. Man musste höllisch achtgeben, dass der Bügel auch wieder am Lauf eingerastet war, denn wenn er noch ein wenig herausstand, dann schnappte er bei Abgabe des Schusses gefährlich zurück und konnte einem ernstlich die Hand verletzen. Geschossen hat das Ding sehr genau und mit enormer Durchschlagskraft. Das eröffnete mir ungeahnte Jagdmöglichkeiten. Jetzt konnte ich jagen, ganz nach dem schönen Lied, in dem es heißt: „Ich bin ein freier Wildbratschütz und hab ein weit’ Revier. So weit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir.“
Zu meinen Streifzügen band ich die Büchse an die obere Rahmenstange des Radls und konnte sie, wenn ich ein „Wild“ entdeckt hatte, schnell losbinden und schussfertig machen.
Nun waren Tauben und Häher nicht mehr sicher. Doch mir stand der Sinn nach Höherem.
Wir hatten Freunde in Leoni am Starnberger See. Dorthin fuhr die Familie oftmals zu Besuch. Diese Freunde hatten ein eigenes Bootshaus direkt an ihrem Grundstück am See. Und dort gab’s – Enten!
In den Ferien war ich schon öfter dort gewesen und bat nun die Freunde, ob ich nicht übers Wochenende kommen dürfe.
Die Büchse wurde, wie immer, an der oberen Stange des Radls vertäut, meine sonstigen Sachen kamen in den Rucksack – und ab ging die Fahrt, diesmal ohne Strolchi, zum Starnberger See.
Die Reise führte durch das malerische Mühltal, durch das sich die Würm, der Abfluss des Starnberger Sees, daher auch Würmsee genannt, schlängelt. Da erblickte ich ein ganz seltenes Jagdwild. Eine Wasseramsel. Die zu erlegen entsprach keinesfalls der Weidgerechtigkeit, von welcher der alte Lehrmeister Hartig geschrieben hatte, und der ich mich verpflichtet fühlte. Doch Weidgerechtigkeit hin oder her, dieser seltene Vogel ließ alles vergessen.
Ich stellte mein Radl ab, löste aus der Verschnürung das Luftgewehr und pirschte mich an. Doch wo war nun der Vogel? Bald tauchte die Wasseramsel mal hier, mal dort auf, saß kurzzeitig mit wippendem Schwänzchen auf einem Stein, und bis ich schießen konnte, war sie erneut abgetaucht. Das konnte nicht gut gehen. Endlich kam ich zu Schuss, doch da war sie schon wieder weggetaucht, und bei ihrem erneuten Erscheinen schwirrte sie unerreichbar weit davon. Ein wenig enttäuscht band ich meine Büchse wieder an die Radlstange und strampelte, diesmal ohne Unterbrechung, weiter nach Leoni.
Dort war man ein wenig erstaunt über meine Bewaffnung, doch in jener Zeit wurde nicht viel nachgefragt oder sich gar gewundert.
Mein Plan war, vom Bootshaus aus die Enten anzufüttern und dann eine nach der anderen „abzuknipsen“. Man verzeihe mir diesen respektlosen Ausdruck, doch gierig, wie ich war, passt kein anderer Ausdruck besser.
Es klappte. Aber leider nur ein erstes und einziges Mal. Die mit Kopfschuss – es musste auch einer sein, denn das Kügerl wäre nie durchs Gefieder gedrungen – getroffene Ente machte mit klatschendem Flügelschlagen und im Kreis herumrudernd einen gewaltigen Aufstand. Die anderen Enten flohen und kamen vorerst nicht wieder.
Als ich anderntags, wieder daheim, stolz meine Beute ablieferte, machte nun mein Vater den Aufstand. Das Luftgewehr wurde vorerst eingezogen. Er hatte bislang nichts von den heimlichen Aktivitäten seines Sprösslings geahnt. Kein Wunder auch, denn die Eltern hatten nach Verlust von Hab und Gut, Haus und Heimat mit dem Wiederaufbau andere Probleme, als nachzufragen „was machst du denn so in der Freizeit?“
Es dauerte nicht lange, da kam ich in eine kleine Jungjäger- und Jagdhornbläsergruppe – einer der ersten in Bayern – und in den Kreis des Grafen von Bülow-Dennewitz. Mein Vater kannte ihn bereits von früher. Da hatte ich den allerbesten Lehrmeister gefunden. Er lenkte die überschäumende Jagdpassion des Heranwachsenden in die richtigen Bahnen. Er lehrte mich, anständig mit Ethik und Respekt vor den Mitgeschöpfen zu jagen. Die Ansichten des ehrenwerten Forstmeisters Hartig waren die von vor über 200 Jahren. Seitdem hat sich in dieser Richtung viel, und, wie mir Graf Bülow zeigte, positiv verändert.
Mein Vater unterstützte die Führung durch diesen untadeligen Weidmann nach Kräften. Er sah, dass eine Wildererkarriere böse enden würde. Als ich dann, noch bevor mein 16. Lebensjahr vollendet war, ihm stolz das Zeugnis der bestandenen Jägerprüfung auf den Tisch legte, versprach er mir einen großzügigen Zuschuss zum Kauf einer ersten Jagdwaffe. Den Rest sollte ich mir selber zuverdienen. Im Jahr darauf brachte er von einer Geschäftsreise eine Deutsch-Kurzhaar-Hündin – Alexa v. d. Römerstraße – mit. Er hatte sie zufällig bei der Wasserarbeit beobachten können, worauf er sie spontan dem Besitzer, einem ehemaligen Berufsjäger des Grafen Silva-Tarouca, abkaufte. Sie wurde dann die Begründerin einer überaus erfolgreichen „Hundedynastie“, könnte man sagen. Eine ihrer Nachkommen, meine „Cita“, war der seinerzeit höchstprämierte Deutsch-Kurzhaar.
Mein kleiner Strolchi hingegen endete tragisch. Eine Tante, die auf Besuch bei uns weilte, begleitete mich zum Vorortszug, der mich wie jeden Tag ins Gymnasium nach München bringen würde. Dabei entkam ihr der kleine Hund und rannte dem Zug hinterdrein, der sein Herrchen entführte. Seine Anhänglichkeit endete dramatisch, und ich versank in tiefer Trauer.
Jagdwaffe und Jagdhund haben sich geändert, aber das Steinschleuderschießen habe ich bis heute nicht verlernt. Es kam mir stets bei der Erziehung meiner vielen Jagdhunde zur Hilfe. Es war und ist mein verlängerter Arm. Natürlich mit anderer „Munition“ als Steine oder Pistolengeschoße. Ich nehme Splitt oder Reiskörner. Das gibt keine Verletzungen, aber der Effekt ist „schlagartig“.
Und zu wildern brauchte ich seitdem auch nie mehr.