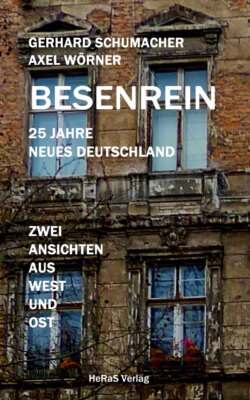Читать книгу Besenrein - Gerhard Schumacher Axel Wörner - Страница 3
Vorwort
Оглавление25 Jahre sind seit 1989 wie im Fluge vergangen. Die 40 Jahre DDR davor – sind sie nun vergessen oder nicht?
Der 25. Jahrestag des Mauerfalls bringt eine Flut vor allem offizieller Veröffentlichungen über die DDR, die nur eines kennen, den sogenannten Unrechtsstaat zu schmähen. Dem müssen Linke, Sozialisten und alle, die sich das nicht gefallen lassen wollen - auch, weil es nicht stimmt - etwas entgegensetzen.
In diesen Chor stimmen auch die beiden Essayisten Gerhard Schumacher und Axel Wörner ein. Der Schriftsteller Schumacher und der gelernte, aber ehemalige Historiker Wörner, der sich zum Schriftsteller gemausert hat, vertreten paritätisch West und Ost. Dabei singen sie ihre je eigene Melodie, aber doch das gleiche Lied. Wer das Feuilletonistische mit Situationsschilderung im lockeren Stil liebt, sei auf die mit etwas Ironie und historischen Rückblicken mit unterschiedlicher Reichweite angerichteten Geschichten von Schumacher verwiesen. Wer nach historischen Perspektiven in großen gedanklichen Bögen und Analysen mit einem gewissen theoretischen Anspruch sucht, möge sich an Wörner halten. Dieser entwickelt z. B. eine interessante und überzeugende Analyse der Situation in der DDR im Wendejahr 1989, indem er die von Lenin formulierten allgemeinen Merkmale einer revolutionären Krise anwendet.
Aber die DDR wird uns über dieses Jubiläumsjahr hinaus noch lange beschäftigen. Denn das Nachdenken über das Gewesene wird nicht aufhören, besonders bei denen, die sich aus irgendeinem Grunde mit der DDR verbunden fühlten und noch fühlen, wenn die Fragen nach den Ursachen des Verschwindens der DDR unbeantwortet bleiben.
Nach dem Bruch vom 1989/90 schien es so, als ob es nur Kritik am gescheiterten Versuch geben konnte, auch wenn ein begabter Politiker uns ermunterte: Kopf hoch, nicht die Hände!
Ohne Zweifel muß an erster Stelle jetzt und weiterhin die radikale Kritik am realen Sozialismus (lassen wir es bei diesem selbsterfundenen Eigennamen, auch wenn er unlogisch ist), an der DDR, der Sowjetunion, am Marxismus-Leninismus usw. stehen. Es darf keine Tabus geben. Auch Wertungen wie "es gab Fehler oder Schwächen, aber die Grundlinie war richtig" sind mehr als beschönigend. Sie bedeuten nur ein Ausweichen und sind fehl am Platze.
Eigentlich sollten oder müßten Sozialisten die schärfsten und konsequentesten Kritiker sein und diese Rolle nicht ihren Gegnern überlassen. Sie wissen, wie das System funktioniert hat, im Guten wie im Schlechten. Ist es nicht so, daß die Verbrechen im Namen des Sozialismus die Anhänger des Sozialismus am meisten geschmerzt haben? Dabei ist schon viel Vorarbeit geleistet worden. Kritische Denker aus den eigenen Reihen haben von Anfang an auf Fehler und Schwächen hingewiesen. Diese Kritik wurde von den jeweiligen Machthabern nicht genutzt, sondern unterdrückt, die Kritiker wurden verfolgt.
Warum fällt (Selbst)Kritik so schwer?
Es scheint einen Widerspruch zwischen der notwendigen historisch-kritischen Haltung zur Geschichte und der persönlichen Sympathie für Soziales und Linkes zu geben. Das Gefühl hängt an der Tradition der Arbeiterbewegung, den erstrebenswerten Idealen einer gerechten Gesellschaft. Wer sich in das gewaltige Gedankengebäude des Marxismus hineinbegeben hat, kann ihm so leicht nicht wieder entkommen. Der Verstand sagt: Es konnte so nicht weitergehen. Die ganze Sache muß überprüft werden. Sie ist gescheitert. Dann setzt der Gegendruck ein: Die ununterbrochene Propaganda der heute herrschenden Schichten und ihrer Medien gegen den Sozialismus und die DDR. Sie zwingt zur Selbstverteidigung. Die angeklagte Linke betont ihre Verdienste und positiven Seiten, prangert die Fehler der anderen Seite an und verdrängt die eigenen Versäumnisse.
Da stellt sich noch eine weitere Grundsatzfrage, die nur noch hypothetischen Charakter hat: Wäre ein anderer Ausweg möglich gewesen? Aber selbst die große Sowjetunion, die ja im Unterschied zur DDR Eigenständigkeit aufweisen konnte, war nicht zu reformieren in Richtung eines demokratischen Sozialismus. Der Stalinismus war ein Irrweg der Geschichte. Das Sowjet-System hatte sich überlebt und mußte zerbrochen werden. Dies war das Verdienst Gorbatschows, auch wenn sein Verhalten seit den 1990er Jahren nur noch Kopfschütteln hervorruft.
Erinnerungsarbeit ist notwendig auf allen Ebenen und in allen Bereichen.
Sie muß die Dinge beim Namen nennen - ohne Nostalgie, aber auch ohne Kleinmut.
Wenig blieb übrig von dem kleinen Land, das sich „Deutsche Demokratische Republik“ nannte. War dieser Name nicht schon paradox?
Das materielle Erbe verschwand schnell. Gebäude und Einrichtungen kann man zerstören, ideelle Werte nicht.
Dabei haben die viel mit Pro und Contra beredeten Errungenschaften des Sozialismus einen Doppelcharakter. Als ob man den Wahrheitsbeweis für das Sprichwort „Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“ antreten wollte, hatten die erreichten Fortschritte (zu viele?) schwache Seiten oder enge Grenzen.
Paradebeispiel ist das Bildungswesen einschließlich der Hochschulen. Der allgemeine, gleiche, kostenlose, weltliche und polytechnische Charakter wiesen es als modern und attraktiv aus; negativ schlugen übertriebene Gleichmacherei und fehlende Internationalität (zu wenig Fremdsprachen!), der überpolitisierte, ja überideologisierte Zug zu Buche, besonders schlimm der geistige Druck auf Kinder und Jugendliche zu formalen politischen Bekenntnissen.
Grundsätzlich nicht anders war der geschilderte Zustand in anderen gesellschaftlichen Bereichen. So auch im Wohnungsbau. Die Lösung der Wohnungsfrage bis 1990 gelang nicht. Im Unterschied zu Wörner ist der Niedergang der DDR nicht am Beispiel des Neubaugebietes Leipzig-Grünau zu erkennen. Eine deutlichere Sprache ging von den verfallenden Altbauquartieren aus. Es stimmt einfach nicht, daß die Neubausiedlungen nicht mal für eine Generation halten sollten. Die besagten Bauten stehen noch, inzwischen allerdings saniert und auch aufgehübscht.
Zu kritisieren ist dagegen, daß man nach 1990 die staatlichen Kredite der DDR für Wohnungsbau den Wohnungsgenossenschaften als Schulden westlicher Banken auflud und dann die Genossenschaften zwang, zur Tilgung dieser Schulden leerstehende Hochhäuser abzureißen und das noch demagogisch als „Stadtumbau“ bezeichnete.
Die Leistungen im Ideellen und Kulturellen müssen mehr beachtet werden.
Hier ist, ergänzend zu den Essayisten, auf zwei spezielle Aspekte zu verweisen.
Die DDR war das Land mit der größten Dichte an Theatern und Orchestern. An den führenden Häusern blühte die Theaterkunst: Deutsches Theater und Kammerspiele, Volksbühne, Berliner Ensemble, Deutsche Staatsoper, Komische Oper in Berlin; die Schauspielbühnen in Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Weimar, Halle, die Opernhäuser in Dresden, Halle (Händel-Renaissance) und Leipzig (Wagner-Opern).
Es können aus Platzgründen nicht alle genannt werden.
Sicher, nur die Zuhörer und Zuschauer konnten daran teilhaben, insgesamt ein kleiner Teil der Bevölkerung. Aufzeichnungen und Dokumentationen können die Vorstellungen nicht vollständig wiedergeben, sie sind auch nicht wiederholbar.
Die knisternde, atemlose oder berauschende Atmosphäre dieser Kunstereignisse war unvergeßlich. Hier waren das Ideal der Harmonie oder der tragische Konflikt zu erleben. Ja, es war nur ein Spiel auf der Bühne, aber mit Widerhall in Kopf und Herz. Für einen Moment waren Kunst und Leben vereint, ehe die harte oder banale Realität in das Idyll einbrach.
Der Erfolg dieser Inszenierungen beruhte - in der Tradition der Klassik: - auf Interpretationen im Sinne des jeweiligen Werkes und zugleich mit einem echten, d. h. inneren Bezug zur Gegenwart, soweit dies möglich war.
Während Kunst und Kultur eine besondere Realität bilden, die im Laufe der Zeit verblaßt, gibt es eine Nachwirkung der DDR, die besonders bemerkenswert ist: Die andauernde Säkularisierung. Die Mehrheit der Bevölkerung ist in der DDR zu Atheisten geworden und es bis heute geblieben, wahrscheinlich der größte Erfolg der SED. Die Bevölkerung auf dem heutigen Territorium der ehemaligen DDR hat prozentual weltweit den höchsten Anteil von Atheisten, im Schnitt 2/3, in Leipzig sollen es 80% der Bewohner sein. Darauf könnte man doch stolz sein?
Was ist sonst im Denken und Verhalten der Menschen an sozialistischen Werten geblieben? Die DDR eine Hochburg des Antifaschismus, leider nicht. Der Ausbruch des Rechtsradikalismus nach 1990 war schlimm. Wenn auch die Führungsfiguren aus dem Westen stammten, so gewannen sie doch zum allgemeinen Erschrecken einen gewissen Anhang. Nur bei manchen Umfragen, wenn es um Frieden oder Krieg, Solidarität und soziale Gerechtigkeit geht, blitzt in den besseren Ergebnissen (im Vergleich zum Westen) ein positives Signal auf und bezeugt, daß im Osten einmal anders gedacht wurde. Ein schwacher Trost, aber immerhin.
Es entstand sogar eine nachträgliche DDR-Identität. In der letzten Zeit soll sie zugenommen haben.
Über die Ursachen des Stimmungsumschwungs im Herbst 1989 ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im rasanten Tempo, das für den einzelnen Zeit-Genossen, ob passiv oder aktiv, keine Zeit zum Überlegen oder Innehalten ließ, veränderten sich die Losungen von der Demokratisierung des Sozialismus in eine völlig andere Richtung, was sich in den berühmten "Wir sind..."-Losungen symbolisierte und im Wahlkampf-Motto der CDU von 1990 "Nie wieder Sozialismus" gipfelte. Das bedeutete die totale Unterwerfung unter die BRD und dürfte als bürgerlich-demokratische Revolution eine treffende Charakterisierung durch Axel Wörner erhalten haben.
Das rückt auch die Idealisierung der Bürgerbewegung zurecht, die mit staatlicher Förderung penetrant betrieben wird. Ihr Vorrecht, in der Öffentlichkeit als erste für bürgerliche Freiheiten eingetreten zu sein, wird nicht bestritten. Daß aber behauptet wird, allein Kirche und Kerzenhalter hätten den friedlichen Verlauf der Revolution erzwungen und die SED-Herrschaft zum Einsturz gebracht, ist Geschichtsklitterung. Das Mitwirken von Hunderttausenden SED-Mitgliedern von innen, wenn auch aus anderen Motiven und mit anderen Zielen, wird verschwiegen. Selbst die zu Recht vielgeschmähten Honecker & Co. sollten nicht nur einseitig gesehen werden. Ihr Verzicht auf Gewalt und nachfolgender Rücktritt, ob freiwillig oder erzwungen, steht dahin, war einmalig. Ob heutige Machthaber eine analoge Haltung in einer vergleichbaren Situation einnehmen würden, kann stark bezweifelt werden.
Wir können nicht mehr wie vor hundert Jahren zur Zeit August Bebels, unbeschwert in die Zukunft schauen. Damals war gewiß, der Sozialismus ist die Lösung der Geschichte. Er war das Ideal, das einmal Wirklichkeit würde. Heute ist das nicht mehr so einfach. Der Glauben ist dahin. Es ist zu viel passiert. Die Verbrechen der großen und kleinen Stalins lasten schwer. Haben die sozialistischen Ideale die stalinistischen Torturen überstanden? Die Antwort ist offen.
In die Zukunft möchte man gern schauen, aber niemand kann oder will sie voraussagen. Deshalb muß Zuspruch wieder aus der Vergangenheit geholt werden. Erinnern wir uns daran, daß auch in anderen Zeiten mutige Männer wie der englische Schriftsteller Percy Shelley an ihrem Ideal festhielten:
„…und daß die Menschen / Nun friedlich einer mit dem andern gingen, / …Und keiner kroch / Und keiner trat den andern; weder Haß / Noch Furcht noch Stolz noch eitel Eigensucht / Noch Selbstverachtung standen mehr geschrieben / Auf Menschenstirnen…keiner / In banger Furcht erhob nach eines andern / Gebieterischen Aug` den scheuen Blick…/ … Keiner frechen Hohns / Zertrat die Funken in dem eignen Herzen / Von Lieb´ und Hoffnung, bis nur bittre Asche / Zurückgeblieben als der Seele Rest…/ Befreit nun bleibt der Mensch scepterlos, / Beengt durch keine Schranke, jeder gleich / Dem anderen, ohne Rang und Stamm, gebunden / an keine Scholle – Bürger nur der Welt…/ Sein eigner König, mild, gerecht und weise“. (Shelley, Percy: Der entfesselte Prometheus. Drama. Den zitierten Text spricht der Geist der Stunde. Zitiert nach: Bahro, Rudolf: …die nicht mit den Wölfen heulen. Das Beispiel Beethoven. Und sieben Gedichte, Europäische Verlagsanstalt. Köln und Frankfurt a. M. 1979, S. 111. Hervorhebung M. H.)
Das schrieb kein alter Mann, sondern ein junges Genie im Alter von 26 Jahren im Jahre 1818.
Leipzig, Juli 2009
Manfred Hötzel
Gerhard Schumacher