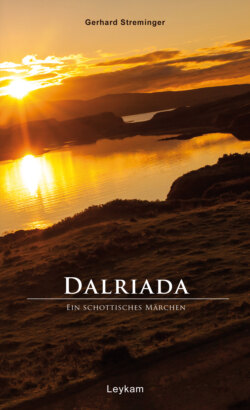Читать книгу Dalriada - Gerhard Streminger - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel Die Heide, so nah
ОглавлениеHochgestimmt verbrachte ich den Abend allein, spazierte lange durch den Park und schließlich zum Temple of the Four Winds. Dieser erinnerte mich allerdings an den obersten Teil eines barocken Glockenturms mit einem Gerüst davor. Ich empfand es daher als durchaus angenehm, bereits nach wenigen Schritten von der Einzäunung weg wieder frei in die Landschaft blicken zu können. Da mein Kopf ansonsten voll erlesener Eindrücke war, genoss ich diesen Erkundungsspaziergang besonders: Während auf verschlungenen Pfaden der einen großartigen Naturkulisse die andere folgte, wogten meine Gedanken hin und her und ergänzten das Gesehene gelegentlich noch mit Vorstellungen und Träumereien.
So imaginierte ich eine einsame Eiche in der Wiese vor mir, die ihre Äste besonders weit ausgebreitet hatte, als blattlos im Raureif vor blauem Himmel. Ihre Äste wurden so zu riesigen Armen, die nach der Nähe anderer suchten. Ein Gärtner hatte mir einmal erzählt, dass er zwar noch nie verreist sei, dass ihm aber bei seiner Arbeit die verschiedenen Zyklen der Natur praktisch immer unmittelbar präsent seien. Denn er müsse räumlich und zeitlich vorausschauend und, wie er es nannte, ins Gleichgewicht setzend durch den Park gehen und handeln. Ständig erlebe er so die großen Zusammenhänge zwischen Regen, Sonne, Schnee, Steinen, Pflanzen, Erde und Wind. Gärtnern sei, so meinte er abschließend, ehe er mit seinem Schubkarren vom Hauptweg abbog und im Dickicht verschwand, eine lebenslange Übung im Werden und in Bescheidenheit. Gelegentlich konnte ich ihn und dieses spezielle Wissen über die natürlichen Lebenszyklen, so hoffe ich jedenfalls, recht gut verstehen.
Besonders wohl fühlte ich mich an einem der kleinen, etwas vom Schloss entfernten Weiher, wo ich noch am ersten Tag meinen Lieblingsplatz für die nächsten zwei Wochen gefunden hatte. Der Teich lag ein wenig hinter Büschen und Bäumen versteckt, und zu ihm führte auch kein Brezelweg wie zu den kleinen Seen nahe dem Schloss. Solche Brezelwege sind unnötig geschlungen, und ihre Funktion dürfte allein darin bestehen, dass die Kindermädchen mit den ihnen anvertrauten jungen Herrschaften in den Kinderwägen nicht auf schnellstem Wege von a nach b gelangen. Vielmehr sollten sie sich eine Zeitlang außer Haus, aber in Sichtweite des Schlosses aufhalten.
Mein Lieblingsplatz also, an dem ich mich fast täglich aufhielt, lag an einem kleinen Teich, der nicht nur von Büschen und Bäumen, sondern auch noch von einem dichten Schilfgürtel umgeben war. Dieser beherbergte mindestens eine Familie schwarzer Blesshühner. Da der Weiher in einer kleinen, daher relativ windgeschützten Senke lag, konnte man das seltsame Knistern des Schilfes nur selten hören. Einmal wogte ein einzelnes Schilfgras im Lufthauch hin und her, während alle anderen Halme reglos wie Soldaten da standen.
Außer Blesshühnern sah ich seltene Eisvögel, die kleinen blauen Juwelen der Lüfte, die nach Insekten und Fischen jagten, und ich hörte einmal – leicht gespenstisch – knapp hinter mir einen Hasen oder ein Kaninchen hingebungsvoll Gras fressen. Das kleine Lebewesen kam mir so nahe, dass ich es deutlich atmen hörte. Ein andermal musterten mich einige Libellen mit ihren knisternden Flügelschlägen und machten nur wenige Zentimeter vor meinen Augen Halt; und einmal strampelte ein Fahrrad, bestehend aus zwei Libellen, durch die Lüfte. Als ich an einem Nachmittag recht spät und ziemlich aufgewühlt zu meinem Weiher kam, lullten mich Bienen, die am Teichrand Wasser holten, mit ihrem Summen derart ein, dass ich einschlief. Wenn Bienen von hinten über meinen Kopf flogen, so wurde der Ton ihrer Flügelschläge für kurze Zeit immer höher und dann, wenn sie sich entfernten, rasch wieder tiefer.
Mächtige Bäume, denen man die häufigen Stürme ansah, säumten den kleinen See und spiegelten sich im bräunlichen, algenreichen Wasser. Aufgrund der vielen Blätter war jetzt im Sommer das Skelett der Bäume nicht zu sehen, nur einige abgestorbene Äste ragten wie Peitschen aus dem Grün. Als besonders schön empfand ich es, wenn Efeu, zumeist auf der Schattenseite, sich den alten Bäumen emporgerankt oder Moos sich in den Ritzen der Stämme eingenistet hatte. Solche moosbewachsenen Baumstämme schimmerten in der Dämmerung hellgrün, ähnlich dem Grün der ersten Blätter im Frühjahr von Trauerweiden oder Buchen. Wenn ich mir genügend Zeit gönnte und außerdem die Sonne hell schien, dann sah ich, wie sich die Schatten dieser Riesenbäume langsam über das Wasser ausbreiteten und im Abendlicht den Teich verdunkelten, während die Baumspitzen noch im Sonnenlicht golden glänzten. Wenn auch noch der Wind genau in der richtigen Stärke wehte, dann zitterte das gesamte Wasser des Schilfweihers.
Etwas vom Schloss entfernt, gedieh also ein Stück dichter Urwald, war er auch räumlich sehr begrenzt. Sobald ich mich nach den Vorträgen am Weiher wieder etwas entspannt hatte, begannen die Stimmen der Vögel rasch lauter zu werden. Sobald sie abends, scheinbar ohne Zweck, also aus purer Freude am Singen einfach so drauflos trällerten, klang dies viel gelöster als dann, wenn sie im Frühjahr einen Partner anlocken oder ihr Revier verteidigen wollten. Damals, an den lauen Sommerabenden im Park von Castle Howard, an einem der kleinen Teiche am Rand des Besitzes, sollte aber offenbar niemand angelockt und niemand abgehalten, sondern nur noch Zufriedenheit signalisiert werden.
Je dämmriger es wurde, umso häufiger tauchten Schwalben oder Mauersegler auf: Vor allem abends bei tiefem Luftdruck, wenn Insekten knapp über dem Wasser dahinschwirrten, überflogen sie im Zickzack-Flug auf ihrer Jagd den Park, und ihre leuchtend weißen Bäuche waren weithin zu sehen. Waren Schwalben und Mauersegler verschwunden, so tauchten in der Dämmerung die ersten Fledermäuse auf.
An jenem Tag, als ich diesen Ort entdeckt hatte, vergaß ich vor lauter Eindrücken die Zeit. Als ich mich einmal umdrehte und sah, wie sich auf einige der riesigen Bäume bereits der Abendnebel wie gesponnener Zucker gelegt hatte, wollte ich umgehend zurück zum Schloss. Doch ich verlor die Orientierung und fand mich inmitten von Rhododendrenbüschen und übermenschenhohen Farnen wieder. Diese verstellten mir jede noch verbliebene Sicht und riefen in mir, wie gelegentlich bei Waldspaziergängen zu Hause, eine leise Beklemmung wach. Während ich in einem Park praktisch immer das Gefühl habe, ein wenig zu mir zu finden, mir also einmal mehr über einige meiner Erfahrungen, Sehnsüchte und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden, habe ich im Wald, abseits der Trampelpfade, oft das Gefühl, mich zu verlieren. Diese Angst vor Verlust löst zumeist ein Gefühl der Panik aus, zuweilen kann die Einbuße an Kontrolle aber auch genussvoll sein. Parks sind eben eingefasste Orte, während große Wälder keine deutlichen Grenzen haben und man sich dort, ohne Hilfsmittel, nur schwer orientieren kann. Schließlich fand ich im Park von Castle Howard dann doch den Weg ins Freie, verkroch mich erschöpft in mein Bett und freute mich auf den nächsten Morgen.
In den folgenden Tagen nahm auch Heather gelegentlich an den Diskussionen teil. Sie stellte aber bloß Fragen, nie bezog sie eine Gegenposition. Nur einmal, als wir alle mit großer Zustimmung über die Organisation Friends of the Earth sprachen, äußerte sie bezüglich des Namens ›Freunde der Erde‹ auch leise Bedenken.
Langsam hatte sich herauskristallisiert, mit welchen Erwartungen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dem Phänomen english garden begegneten: Für Briten waren diese Parks eine Selbstverständlichkeit, mit der sie groß geworden waren, weshalb sie ihre Kenntnisse vor allem vertiefen wollten. Für andere waren englische Gärten indes zumeist etwas durchaus Exotisches, das sie zunächst einmal näher kennenlernen wollten. Deshalb waren auch die geäußerten Fragen recht unterschiedlich: Während eine gebürtige Engländerin beispielsweise wissen wollte, warum in viktorianischer Zeit doch wieder formale, geometrische Elemente Eingang in die Konzeption der englischen Landschaftsarchitektur gefunden hatten, wollten andere wissen, worin das Charakteristische der englischen Gartenkunst überhaupt bestehe. Sehr wahrscheinlich fühlte sich die eine Gruppe entweder gelangweilt oder aber überfordert, wenn sich zu einer speziellen Frage eine lange Debatte entwickelte. Aber manche Nicht-Briten, vor allem Deutschsprachige, suchten den Kontakt mit den bereits besser Informierten, indem sie nach der Veranstaltung die Diskutierenden aufsuchten und fragten, wie sie das Gesagte genau gemeint hätten und ob sie ihnen das nochmals erklären könnten. Dabei schienen sie stets auf großes Verständnis zu stoßen.
Auch ich nahm an den Debatten eher selten teil und beschränkte meine Aufmerksamkeit aufs Zuhören und darauf, die Dynamik der Gruppe zu verstehen. Heather sprach ebenfalls wenig, wirkte allerdings hochkonzentriert und schien deshalb auch oft erschöpft zu sein. Üblicherweise zog sie sich dann rasch in ihr Zimmer zurück. Sobald sie sich verabschiedet hatte, war auch mein Interesse an der Gruppe eher gedämpft, und ich pflegte zunächst auf mein Zimmer zu gehen, um mich ein wenig zu erholen und dann nach Erfrischung im Park zu suchen.
Bei solchen, oft stundenlangen Spaziergängen hatte ich mir angewöhnt, den fokussierten Blick bisweilen durch einen unkonzentrierten, ungebündelten zu ergänzen. Dann suchte ich einen Sitzplatz auf und betrachtete die Welt gleichsam aus den Augenwinkeln. Auf diese Weise weitete sich der Blick zu einem Schauen, das das Meiste nur noch unscharf wahrnahm, aber insgesamt weit mehr zu erfassen vermochte. Dieser ›blicklose Blick‹ wurde für mich zu einer Form des Sehens, die sonderbarerweise unabhängiger von Wünschen und Interessen zu sein scheint. Weil bei einem solchen Schauen die Konzentration nicht auf etwas Besonderes gerichtet war, nahm ich aus den Augenwinkeln heraus ein weites, verschwommenes, ungegenständliches Panorama voller Farben und schemenhafter Gegenstände wahr. Auch das Bewusstsein schien sich unter diesen Umständen von Analyse und Beobachtung und Zielgerichtetheit auf einfaches Registrieren und Gewährenlassen umzustellen, vielleicht sogar auf eine Form von behutsamer Nähe.
Das klingt wahrscheinlich um einiges interessanter, als es tatsächlich ist, und sehr gut gelang mir dies alles zwar nicht, aber immerhin. Versucht man seine Aufmerksamkeit, etwa durch diese Form der ›Kurzsichtigkeit‹, auf das Hier und Jetzt zu richten, bewirkt diese Offenheit, so meine Erfahrung, fast unweigerlich eine Freisetzung positiver Empfindungen, oft sogar eine stille Zufriedenheit. Gelegentlich, wenn direkt vor mir ein Ensemble an Farben zu sehen und das Singen der Vögel oder das Quaken der Frösche zu hören war, durchströmte mich ein schwaches Glücksgefühl, als ob der gesamte Körper atmete. Da man Glück aber wohl nur dann empfinden kann, wenn man ein Ziel erreicht hat, nach dem man sich gesehnt hatte, so ist es gerade der Wunsch, den Dingen, wie sie sind, näher zu sein, den ich mir auf diese völlig harmlose Weise erfüllte.
Es scheint ein Ich zu geben, das sehr auf Distanz bedacht ist, das gerne analysiert und reflektiert und sich auch als Objekt zu sehen vermag. Aber daneben gibt es offenbar ein Ich, das sich in seinem Gefühlshaushalt zu einem großen Teil aus Beziehungen zu anderen Lebewesen bestimmt. Das Antlitz des Menschen leiht sich das Lächeln und die Tränen vom Antlitz des [anderen] Menschen, wusste schon Horaz. Dieses ›Beziehungs-Ich‹ will sich als Teil der Umgebung dieser zugehörig fühlen. Wenn ich diese emotionale Nähe über längere Zeit nicht verspüre, dann werde ich – und dies gilt wohl für die allermeisten von uns – melancholisch. Die Bereitschaft, die Welt auch aus den Augenwinkeln heraus zu sehen und damit Fremdes in eher meditativer Weise in sich aufzunehmen und zuzulassen, bewirkt eben oftmals ein kaum wahrnehmbares Gefühl des Wohlbehagens.
Natürlich hatte ich bei meinen langen Spaziergängen gehofft, irgendwann einmal Heather zu begegnen. Aber sie schien mit ihrem Auto eher die nähere Umgebung des Schlosses als den Park selbst erkunden zu wollen. Einmal jedoch, als das Seminar schon fast zu Ende war, sah ich sie im Park, allein am Boden einer Brücke sitzend. Sie hatte ihre Arme lässig auf das Geländer gelegt und schaute auf das darunter liegende Wasser. Ihre Beine baumelten von der Brückenmauer langsam hin und her.
Ich begrüßte sie und fragte, ob sie ins Wasser schaue, um Fische zu beobachten.
„Nein, nein“, entgegnete sie lachend. „Ich beobachte im Wasser die dahinziehenden Schäfchenwolken. Ich habe dann den Eindruck, als säße ich in einem Flugzeug und schaute auf eine Welt voll weißer Inseln.“
„Darf ich mich ein wenig zu dir ins Flugzeug setzen?“, fragte ich.
Heather lachte, blickte über ihre Schulter und gab mir mit einem kurzen Nicken zu verstehen, dass ich durchaus willkommen sei. Ohne es bewusst zu wollen, setzte ich mich so nahe zu ihr, dass ich ihren Atem auf meiner Wange spürte, wenn sie sprach und sich zu mir drehte, während ich auf den kleinen See schaute. Es fühlte sich an, als ob ein sanfter Strahl warmer Luft mir von der Seite ins Gesicht blies. Zum ersten Mal nahm ich wahr, was ich offensichtlich schon die ganze Zeit über gesehen hatte, dass ihr Gesicht nämlich voll kleiner Sommersprossen war und dass sich in der linken Pupille ein winziger, schwarzer Fleck befand. Aber wie von unsichtbarer Hand geleitet, rückten wir nach einigen Minuten praktisch gleichzeitig wieder auseinander und saßen schweigend da, ein wenig verlegen auf das Wasser schauend.
Zum Glück erinnerte ich mich an einen ihrer Diskussionsbeiträge, die Organisation Friends of the Earth betreffend. Damals hatte sie die Meinung vertreten, dass es ihr nicht leicht falle, sich ›Freundin der Erde‹ zu nennen; und dass sie sich zwar als Teil der Natur empfinde, gelegentlich aber auch als Fremde.
„Wann erlebst du dich eigentlich als Fremde?“, fragte ich Heather nun mit ehrlicher Neugierde und konnte so nahtlos an Gespräche während des Symposiums anknüpfen.
„Wenn ich beispielsweise in ein Krankenhaus gehe oder wenn ich die Nachrichten höre und von einem Tsunami oder Erdbeben berichtet wird. Dann fühle ich mich als Fremde.“
„Und warum?“
„Weil ich solche Tatzenhiebe der Natur nur schwer ertragen kann. Hätte ich die Macht, so ließe ich Derartiges keinesfalls zu und griffe ein. Da ich mir also eine bessere Welt als diese problemlos vorstellen kann, werde ich mich immer auch fremd auf dieser Erde fühlen. Unter der Oberfläche pulsiert das blinde Schicksal mit all seinen Ungerechtigkeiten, während wir frisch und fröhlich unsere großen Pläne schmieden. Dabei brauchen wir gar nicht weit zu schauen, um uns diese Abhängigkeit vom Zufall zu vergegenwärtigen: Ein naher Erdrutsch in der Nacht ist ein derart unheimliches Geschehen, das uns sogleich daran erinnert, dass die Natur auch immer etwas Bedrohliches an sich hat.“
„Oder die bange Ahnung alles Lebendigen vor einem heftigen Unwetter“, warf ich ein.
„Eben. Zu diesem, durch Naturkatastrophen und blindes Schicksal verursachten Leid gesellen sich noch moralische Übel: Wir leben in einer ungerechten Welt, in der es den Guten oft schlecht und den Schlechten oft gut geht; in der ganze Völker um das Allernotwendigste kämpfen müssen und täglich Zehntausende diesen Kampf verlieren. Das ist, auch wenn ich nur ein wenig durch diesen Guckkasten des Unerträglichen schaue, für mich eine ständige Quelle des Leids und der Empörung.“
„Und warum fühlst du dich als ein Teil der Erde?“
„Weil überall die gleichen natürlichen Gesetze herrschen. Menschen sind das Produkt dieser Erde, der Schöpferin der Natur, weshalb wir mit allen anderen Lebewesen verwandt und in vieler Hinsicht deren Ebenbilder sind.“
„Du fühlst Dich also“, resümierte ich etwas oberlehrerhaft, „als ein Teil der Natur und manchmal als Fremde. Dennoch hegst du für die Erde auch freundschaftliche Gefühle, nehme ich einmal an?“
„Ja, natürlich. Denn es geht mir sehr nahe, dass die Erde derart geschunden und ausgebeutet wird. Die menschliche Gier nach immer mehr ist schon schlimm genug. Aber unser Verhalten ist obendrein grenzenlos dumm, da die Erde, und nur sie, uns zu leben ermöglicht. Sie gibt den Menschen, wenn sie nicht von uns verwundet wurde, grundsätzlich alles, was wir zum Leben benötigen: Wasser, Böden, Luft, Nahrung, Energie. Und was tun wir? Mittels Technik machen wir uns die Erde untertan, zerstören oftmals ganze Regionen für Tausende von Jahren, machen diese also zu waste land. Nun aber erreichen wir Grenzen und müssen zudem schmerzlich erfahren, dass wir in manchen Extremsituationen unsere Technik gar nicht beherrschen.“
Dem fügte ich noch hinzu, dass unsere Gier wohl nicht selbstverständlich sei, sondern letztlich einem bestimmten religiös-kulturellen Erbe geschuldet sein dürfte. Denn bei den alten Griechen, beispielsweise, ging es offenbar nicht darum, sich die Natur in systematischer Weise untertan zu machen, sondern sich ihr anzupassen.
„Genau“, meinte Heather zustimmend, „Ähnliches dachte ich mir auch schon. Aber was heißt das konkret? Konkret bedeutet dies, dass Menschen die Ziele ihres Tuns so wählen sollten, dass diese ohne große negative Auswirkungen auf die Natur erreichbar, also natürlich sind. Aber was machen wir stattdessen? Durch Werbung propagieren wir immer neue Ziele! Das ist ein absurdes Verhalten und kann nur ins Unglück führen. Als Alternative zu diesem Wahnsinn müssen wir wieder lernen, zufriedener zu sein mit dem, was wir schon erreicht haben, und stärker jene Dinge zu genießen, die es ohnedies umsonst gibt. Leider wird das, was wirklichen Wert hat, viel zu wenig geachtet, die Schönheit der Natur beispielsweise; und das, was wirklich geachtet wird und worum die meisten kämpfen, hat keinen echten Wert: ungenießbares Geld.“
Heather machte eine kurze Pause, dann meinte sie noch, dass
„einige kleine Änderungen dazu führen könnten, die Erde – wie unsere Nachbarplaneten – zu einem lebensfeindlichen Ort zu machen. Auch dieser Zerbrechlichkeit wegen ist mir die Erde so nah und wertvoll. Stets ein Vorbild ist die Natur für mich aber nicht, weil sie eben, etwa bei Hochwasser, keinen Unterschied macht zwischen Tätern und Opfern, zwischen Schuldigen und Unschuldigen, die Natur also blind ist – etwas, das sich mit meinem Gerechtigkeitsempfinden keinesfalls verträgt.“
Mir fiel dazu noch das viel diskutierte Argument ein, dass wir auch künftigen Generationen, unseren Enkeln, einen Planeten überlassen sollten, auf dem sie selbst noch Entscheidungen treffen könnten – gerade demokratisch Gesinnte müssten so denken. Also sollten wir uns schleunigst der Frage stellen, welche Ziele und Mittel überhaupt wünschenswert und mit der Natur verträglich seien. In einem tibetanischen Sprichwort heißt es, dass wir an die siebente Generation nach uns denken sollten, ehe wir handeln. Heather schwieg dazu, zog ihre Augenbrauen hoch, seufzte leise und nickte langsam.
Während des Seminars waren ähnliche Themen schon mehrmals am Rande zur Sprache gekommen. Aber Heather hatte offenbar schon ihre Position zu diesen Themen gefunden. Beinahe alles, was sie auf der Brücke mit Blick auf den See sagte, wirkte auf mich sonderbar endgültig. Aber ungeachtet aller Sympathien überzeugten mich ihre Ausführungen doch nicht so ganz. Wo jedoch die Schwachstelle in ihrer Gedankenführung lag, wollte mir nicht einfallen, also gönnte ich mir erst einmal eine Phase der Reflexion.
Nach einer längeren Pause, in der wir schweigend auf die sich im Wasser spiegelnden Wolken und auf die Lichtreflexe unter der sich im Wind hin und her wogenden Trauerweide geschaut hatten, gingen wir gemeinsam zurück zum Schloss, zunächst durch den Englischen Garten, dann durch den Französischen. Dieser letzte Teil der Anlage missfiel mir. Denn im Grunde verkörpert ein französischer Barockgarten doch nur die Arroganz des Menschen, die Natur dominieren, ihr ein unnatürliches Design aufzwingen zu können. Ein Miteinander, eine Kommunikation des Gartens mit der ihn umgebenden Landschaft fehlt im Park von Versailles völlig, dem Urbild aller französischen Barockgärten. Dort ist die Künstlichkeit dieses riesigen, inszenierten Festsaals unter freiem Himmel für mich derart überwältigend, dass ich seekrank werde, wenn ich mich zu lange dort aufhalte. Bei einem Besuch in einem englischen Park tauchen hingegen in meinem Kopf zumeist grundlegende Fragen nach dem Woher? Wohin? Wozu? auf. Die abwechslungsreiche, unregelmäßige Anordnung von Bäumen oder Hügeln oder Weihern schafft Freiräume und vermittelt so das Gefühl von Freiheit. Damals, an jenem speziellen Nachmittag im Park von Castle Howard war ich aber leider zu müde, um Heather zu fragen, ob sie auch so empfinde. Aber da sie im makellosen formalen Blumengarten – unter anderem mit einem Beet voll Tulpen mit flammenden Blüten – ihre Schritte erhöhte und nie stehen blieb, um genauer zu schauen, schloss ich, dass sie so ähnlich dachte wie ich und den faulen Zauber der Form ebenso ablehnte.