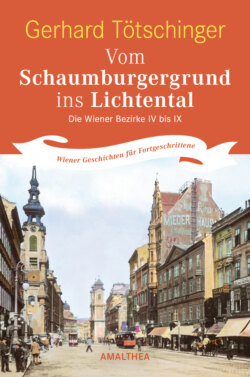Читать книгу Vom Schaumburgergrund ins Lichtental - Gerhard Tötschinger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZwischen der Stadtmauer und dem Glacis wuchsen im Laufe der Jahrhunderte viele Dörfer, ihre Namen haben sie an Straßen, Gassen, Plätze weitergegeben. Die prominentesten dieser kleinen Siedlungen bewiesen ihre besondere Bedeutung, wenn ganze neu geschaffene Bezirke die früheren Ortsbezeichnungen übernahmen.
Die Wieden ist fast so alt wie Wien, abgesehen von der Zeit der Kelten und der Römer. Ein Stiftungsbrief von Herzog Leopold VI. nennt den Dorfnamen im Jahr 1211. Er hat nichts mit einer Weide zu tun, auch wenn er im Bezirkswappen so interpretiert wird. Er kommt von Widum, gemeint – ein Pfarrgut.
Wer flanierende Touristen beobachtet, mag sich vielleicht manchmal wundern, dass der eine oder die andere einen eigenen Reiseführer für die Wieden in der Hand hält – das sind Reisende aus Polen, dort heißt Wien eben Wieden.
Die frühen Bewohner siedelten sich entlang einer Straße an, der einzigen, der Wiedner Hauptstraße. Sie verlässt das alte Wohngebiet, steigt an bis zur Höhe der Spinnerin am Kreuz, noch ein Blick zurück auf die schon ferne Stadt – und man ist auf dem Weg in den Süden. Der uralte Verkehrsweg führte und führt zuerst zu den Verwandten im Herzogtum Kärnten und weiter an die Adria, nach Venedig, nach Bologna und Rom.
Verließ man die Stadt durch das Kärntnertor, so bewegte man sich ab dem 15. Jahrhundert zuerst zwischen Zäunen, Mäuerchen, Gräben, einer zahmen Verlängerung der Stadtmauer, querte den Wienfluss über die Steinerne Brücke, fuhr oder ritt vorbei am Laszlaturm oder durch seine Tore. Der war ein eindrucksvolles Bollwerk.
Der Weg über den Wienfluss in den Süden, Albertinischer Plan
Der Albertinische Plan von 1455 nennt nur die wichtigsten Bauten Wiens mit Namen. Deutlich zu sehen sind das blaue Band der Wien, die Steinerne Brücke und gleich rechts Kirche und Spital »Zum heiligen Geist«. Die eingangs erwähnte Stiftung von 1211 betraf diese soziale Institution. Die Ordensbrüder kümmerten sich nicht nur um das Seelenheil der armen Insassen, sondern auch um ihre medizinische Versorgung, um Körperpflege. Der Orden stand in enger Verbindung zum Vatikan, das war Leopold VI. bei seiner Stiftung wohl bewusst gewesen. Almosen zu geben, Gutes zu tun war ja Christenpflicht, und man sicherte sich auf diese Weise einen günstigen Start ins Jenseits.
Bald kamen italienische Ärzte nach Wien und gaben hier Unterricht. Die 1365 gegründete Universität hielt engen Kontakt zum Orden und seinem Spital, was nicht nur der medizinischen Hilfe, sondern auch der frühen Forschung nützte. Am 12. Februar 1404 fand im Heiligengeistspital die erste anatomische Sektion von Wien statt. Das war nicht nur wissenschaftlich eine Sensation, denn die Kirche hatte gegen solche Praxis massive Vorbehalte. Allerdings begann bald nach diesem Datum der Einfluss des Klerus zu schwinden.
Die Reformation traf in Wien auf vorbereiteten Boden, auf Unzufriedenheit. Um 1520 gab es im Heiligengeistspital nicht einen einzigen Ordensbruder mehr, aus Rom reiste Dr. Jakob Nagel an, der Großmeister. Er setzte sich für Erhalt und Zukunft des Spitals und der Kirche ein, aber er konnte keine Wunder wirken. Und nur ein Wunder hätte im Herbst 1529 die Bauwerke außerhalb der Stadtmauern vor den osmanischen Horden retten können. Die Brandruinen wurden später nicht restauriert, auch die Heiligengeistmühle neben der Steinernen Brücke verfiel, obwohl sie bis zum Türkensturm die wichtigste Mühle Wiens gewesen war. Direkt an der Straße gelegen, kamen bei ihr die hoch beladenen Erntewagen von den Bauernhöfen und Gütern südlich von Wien an. Der Müllermeister hatte das Recht und die Pflicht, die Getreidelieferungen auf andere Mühlen der Stadt zu verteilen. Und weil er auch eine Bierausschankkonzession hatte, wird es dem Heiligengeistmüller nicht schlecht gegangen sein. Mit 1529 war diese goldene Zeit vorbei, die nahe Bärenmühle trat die Nachfolge an.
À propos Mühle: Das älteste Haus nicht nur der Wieden, nein, von ganz Wien wird wohl die Heumühle sein. Der Mühlbach, er verlief als Seitenarm neben dem Wienfluss, versorgte die Mühlräder der Schleifmühle, der Bärenmühle und der Heiligengeistmühle und wurde ebenso von der Heumühle in Anspruch genommen.
Diese wurde auch Steinmühle genannt, stand im Besitz des Wiener Bischofs und wurde wie der mächtige Laszlaturm und fast alle anderen Gebäude der Siedlung ein Opfer der Türken. Sie wurde wiedererbaut, wenn auch verändert, das Mühlrad klapperte weiter munter am rauschenden Bach – bis 1683, da setzten die Osmanen fort, was sie 1529 begonnen hatten.
Doch die Heumühle, die mit der Bärenmühle für Wiens Versorgung sehr wichtig war, wurde abermals neu aufgebaut. Nun war sie freilich schon ziemlich verändert. Wer dieses älteste Haus der Stadt – nur Kirchen sind älter – besuchen will, ja vielleicht gar für eine eigene Veranstaltung nutzen will, kann das tun. In der Schönbrunner Straße 2 steht das rundum erneuerte Haus, dessen historischer Kern aus dem 14. Jahrhundert erhalten ist.
Aus sanitären Gründen beschloss der Wiener Gemeinderat 1856, den Mühlbach zuschütten zu lassen. Das war eine teure Sache – man musste den Bach dem Besitzer um 30000 Gulden ablösen, der Erzdiözese Wien. Die Summe entsprach ungefähr zwölf Jahresgehältern eines einfachen Handwerkergesellen.
Sprechende Straßennamen erinnern an den nunmehr unterirdisch fließenden Mühlbach und seine Mühlen – Schleifmühlgasse, Heumühlgasse, Mühlgasse, Bärenmühldurchgang. Und wenn diese Straßen selbst sprechen könnten … Die Heumühlgasse 10 stand einst im Besitz der Soubrette Mizzi Kaspar. Musste sie eine Berufsbezeichnung angeben, so war es »Hausbesitzerin«. Die Nr. 10 ist noch dazu ein Eckhaus, dreistöckig! »Eckhausbesitzer« war für die alten Wiener ein halber Adelstitel. Und diese Nr. 10 hatte in der Tat eine enge Beziehung zum Adel, zum allerhöchsten, ebenso wie die Besitzerin. Kronprinz Rudolf hatte ihr 1887 das Haus gekauft, um 60 000 Gulden. Als er zwei Jahre später starb, bedachte er sie in seinem Testament mit 30 000 Gulden. Wieder zwei Jahre später, 1891, verkaufte Marcella »Mizzi« Kaspar das Haus. Sie blieb dem Bezirk treu und zog in die Paniglgasse 19.
Die Schleifmühlgasse – eine Fundgrube! Während wir vom 4. Bezirk in den 9. spazieren, hat der einstige Hausherr von Nr. 12 den Weg in die Gegenrichtung genommen. 1718 kam Peter Lichtmanegger aus dem Lichtental und erwarb ein Grundstück, auf dem er sein Bierhaus »Zum goldenen Fassl« errichtete. Bis 1936 haben Lichtmaneggers Nachfolger noch ausgeschenkt, danach hat das Haus die moderne Stadtplanung nicht überlebt. Unter seinen Stammgästen befanden sich viele Bewohner des benachbarten Gebäudekomplexes, des Freihauses.
Am Haus Ecke Margaretenstraße 10 und Operngasse 25 berichtet ein buntes Sgraffito vom Starhemberg’schen Freihaus. 1642 erwarb Conrad Balthasar Graf Starhemberg mehrere Grundstücke zwischen der Wien und ihren Seitenarmen, nach dem neuen Herrn Conradswörth genannt, -wörth meint wie im 2. Bezirk eine Insel. Er baute ein Haus, das brannte ab, er baute ein neues und vererbte das Anwesen seinem Sohn Ernst Rüdiger. 1647 hatte Kaiser Ferdinand III. einen Freibrief ausgestellt, der den Starhembergs die Steuerfreiheit zusicherte sowie die Gerichtsbarkeit über alle Bewohner des Komplexes. Doch auch das neue Haus durfte nicht lange stehen bleiben – angesichts der heranrückenden Osmanen wurde es auf Starhembergs Befehl geschleift, es sollte dem Feind keine Deckung geben.
Modell des Freihauses, von oben, Bezirksmuseum
Kaum waren die erfolglosen Türken wieder fort, wurde abermals gebaut, diesmal in großem Maßstab. Ab 1694 bedeckte der Neubau nach und nach eine riesige Fläche, die wir uns zwischen Wiedner Hauptstraße, Mühlgasse, Resselgasse und Schleifmühlgasse vorstellen können.
In sechs Höfen mit 31 Stiegen lebten rund 1000 Bewohner im Freihaus, dem größten Mietshaus von Wien. Zu ihnen gehörte ab 1789 Emanuel Schikaneder, ein Regensburger Theaterunternehmer. Er war mit seiner ambulanten Künstlertruppe 1780 in Salzburg zu Gast gewesen, dort hatte er Leopold Mozarts Bekanntschaft gemacht und sich mit dessen Sohn Wolfgang, er war fünf Jahre jünger, auch gleich gut vertragen. Im Starhemberg’schen Freihaus hatte man 1787 ein einfaches Theater errichtet, der erste Direktor war der Wanderbühnenimpresario Christian Roßbach, er kam aus Fulda. Zwei Jahre später folgte ihm Emanuel Schikaneder, der sich schon einen guten Namen gemacht hatte. Sein Repertoire ist das typische dieser Jahre: derbe Volksstücke, Kasperlszenen, Zauberpossen, Singspiele, alles jedoch mit einem gewissen Anspruch auf Höheres.
Das hatte zur Folge, dass sogar der Kaiser selbst das Freihaustheater besuchte. Im September 1791 erschien Leopold II. in Begleitung des Kronprinzen Franz zu einer Vorstellung von Ludwig Herzog von Steiermark aus der Feder von Schikaneder, der am Zenit seiner Berufslaufbahn stand und sich einem weiteren Höhepunkt näherte.
1791 gab Emanuel Schikaneder seinem Freimaurerbruder Mozart den Auftrag zur Komposition einer »Zauberoper«. Dies kam dem Komponisten sehr gelegen, er steckte in schweren wirtschaftlichen Problemen.
Die Arbeit an der neuen Oper ging aber durch Reisen und andere Kompositionspläne sehr zögerlich voran. So holte der Direktor, der das Libretto selbst verfasst hatte, seinen Kompositeur aus der häuslichen Ablenkung und setzte ihn in eine Holzhütte, ein Salettl, in einem Hof des Freihauses. Dort sollte Mozart in Ruhe arbeiten können.
Das Zauberflötenhäuschen, heute im Mozarteum Salzburg
Konnte er aber nicht! Im nur wenige Schritte entfernten Theater gab es viele Vorstellungen, Sängerinnen und Schauspieler wollten zusehen, wie ihre künftigen Rollen und Gesangspartien entstanden; in dem Salettl soll es sehr lustig zugegangen sein. Mozart hatte den fröhlichen Betrieb lieber als die konzentrierte Ruhe, und wirklich war die neue Oper innerhalb weniger Wochen bereit.
Am 30. September 1791 erlebte das Publikum auf den harten Bänken des Theaters auf der Wieden Weltgeschichte – die Uraufführung der Zauberflöte. Sie hatte von Anfang an Erfolg, es gab aber auch Kritik: Das Libretto sei frauenfeindlich, es stecke voller Widersprüchlichkeiten. Das Wort und die Musik trafen auf ein kundiges Publikum, das für Geheimnisse und Bühnenmystik ebenso zu haben war wie für Koloraturarien und Couplets. Der Direktor selbst gab eine der Hauptrollen, den Papageno, und muss sich als Bühnenkünstler wie auch als Unternehmer über den Publikumszuspruch gefreut haben. Die Kasse war voll.
Mozart jedenfalls hat sich gefreut, davon kann man sich in seinen Briefen überzeugen. Seine Frau Constanze war in Baden zur Kur, er schrieb ihr oft, so am 7. Oktober 1791, die Oper sei voll gewesen wie »allzeit«: »Um halb 6 uhr gieng ich beim Stubentor hinaus – und machte meinen favorit Spaziergang über die Glacis ins Theater …« Mozart kam immer wieder in die Vorstellung, übernahm manchmal die Leitung und lebte seinen Übermut aus, indem er seinen Direktor auf den Arm nahm: »Nun gieng ich auf das Theater bey der Arie des Papageno mit dem Glocken-Spiel, weil ich heute so einen Trieb fühlte es selbst zu spielen – da machte ich nun den Spaß, wie Schikaneder eine Haltung (= Pause) hat, so machte ich ein Arpeggio, der erschrak, schaute in die Szene und sah mich. Als es das 2te Mal kam, machte ich es nicht – nun hielt er und wollte gar nicht mehr weiter – ich erriet seinen Gedanken und machte wieder einen Accord, dann schlug er auf das Glockenspiel und sagte Halts Maul. Alles lachte dann.« Und Mozart freute sich schon darauf, mit Constanze in einer Loge zu sitzen, »so bald du zurück kömmst«.
Doch als sie zurückkam, blieben dem Ehepaar nur noch wenige Tage. Das Publikum war nicht einhellig überzeugt. Am 9. Oktober 1791 hat der Korrespondent im Berliner Musikalischen Wochenblatt berichtet, die Zauberflöte finde den »gehofften Beifall nicht, weil der Inhalt und die Sprache des Stücks gar zu schlecht sind«.
Das Werk hat seinem Direktor dennoch viele frohe Tage bereitet. Bis zur Schließung des Theaters wurde es 223 Mal gegeben. Schikaneder war von seinem Libretto allerdings mehr als überzeugt. Von ihm ist die Äußerung überliefert: »Welchen Erfolg hätte ich mit meiner Zauberflöte haben können, hätte ich nur einen besseren Komponisten gehabt.«
Das Freihausmodell, Außenansicht
Schikaneder war eine Zeit lang erfolgreich, dann jedoch ereilte ihn das Schicksal vieler seiner Kollegen, das Geld wurde knapp. Da kam ihm ein theaterbegeisterter Amateur gerade recht: der Kaufmann Balthasar Zitterbarth. Er kaufte ihm das Freihaustheater ab, und Schikaneder konnte mit dem Geld ein neues Theater bauen, größer und schöner – das Theater an der Wien.
So wurde am 11. Juni 1801 zum letzten Mal im Freihaus gespielt, dann übersiedelte die Schikanederische Truppe ins neue Haus. Das Freihaustheater verkam langsam und wurde 1809 abgerissen; brauchbare Teile hat man zu Wohnräumen umgebaut.
Zurück blieb als leere Erinnerung an lustige Tage das Salettl. Da stand der kleine Holzbau ohne Verwendung, die Freihausmieter werden vielleicht einmal gehört haben, dass er etwas mit Mozart zu tun hatte, aber was, das geriet in Vergessenheit. Hingegen war das Mozarteum in Salzburg weniger vergesslich. 1863 wurde das Häuschen abgebaut, verpackt, nach Salzburg transportiert, und dort steht es nun im Hof des Mozarteums, ein Glanzstück der ohnehin reichen Devotionaliensammlung der Geburtsstadt des Genies.
Wien könnte das Zauberflötensalettl gut brauchen, aber die Stadt hat ihre Chance gehabt und nicht genutzt. Wolfgang Amadé hat in Wien an vielen Adressen gewohnt, nichts davon ist geblieben außer dem Figarohaus in der Innenstadt; das freilich ist eine Reise wert.
An die Zauberflöte muss man nicht erinnern, sie ist weltweit lebendig, die Wieden ist natürlich besonders stolz. Tamino und Pamina schreiten, beschützt von der wundersamen Flöte, durch die Wasserprobe im 2. Akt, dargestellt am Mozartbrunnen, einem Werk von Carl Wollek, auf dem Mozartplatz. 1905 wurde diese bedeutende Plastik der Secessionskunst enthüllt. In der Lehárgasse, an Schikaneders prächtigem Theaterbau, sieht man Papageno mit seinen jüngeren Geschwistern, aber da sind wir ja schon im nächsten Bezirk. Ganz nahe, in der Operngasse 26, Ecke Faulmanngasse, gibt es noch einen Papageno, eine bunte Keramik des Jahres 1937. Das war eine Zeit, als Wien Abschied nahm vom dreihundert Jahre alten Kuriosum Freihaus.
Dieses größte Zinshaus des damaligen Wien hatte drei große Brände überstanden, 1657, 1683 und 1759. Dann ist es noch einmal gewachsen, 1786 wurde ein zweites Stockwerk aufgesetzt, der Hausherr erhöhte seine steuerfreie Einnahme. Man hat errechnet, dass die fürstliche Familie Starhemberg um 1800 pro Stunde einen Dukaten eingenommen hat. In 340 Wohnungen lebte man einen ruhigen Alltag, den großen Markt vor der Haustüre, in den Höfen eine Kirche, eine Apotheke, Werkstätten und eben einige Jahre auch ein eigenes Theater! Man muss sich diese ungewöhnliche Anlage als der Augsburger Fuggerei ähnlich vorstellen, mag dabei auch an die großen Prälatenhöfe der Innenstadt denken, den Melker Hof, den Heiligenkreuzerhof.
Alle diese Anlagen und eben auch das Freihaus hatten Atmosphäre und Charakter einer Kleinstadt. Aber ringsum wuchs die Großstadt und bedrohte mehr und mehr die Idylle. Zu Bürgermeister Luegers Zeit fasste man zum ersten Mal den Plan zum Abbruch. In Wien kann so etwas dauern, zudem gab es eine Fülle aktueller Projekte: die moderne Energieversorgung, die zweite Hochquellenwasserleitung, das Lainzer Krankenhaus, die Elektrifizierung der Pferdetramway und der Stadtbahn – der Abbruch begann erst 1913. Im großen Krieg hatte man erst recht andere Probleme, so dauerte es bis 1937, dann war das Freihaus großteils geschleift. Die Bomben des Zweiten Weltkrieges führten zu weiteren schweren Schäden, nur einige Reste des Monsterbaus standen noch bis in die 70er-Jahre.
Freihaus mit dem alten Naschmarkt, Bild von Carl Pippich, 1916
Das Haus Operngasse 36 vermag den Flaneur in seinem Freihausverständnis zu unterstützen. Ein Sgraffito zeigt laut Inschrift Das alte Freihaus und die neuen Straßenzüge. Mag es auch nicht ganz genau sein, so kann man sich doch ein Bild machen; es zeigt auch die Rosalienkapelle und das Theater.
An Gebäuden mit großer Vergangenheit herrscht im 4. Bezirk kein Mangel. Freilich sind ebenso viele auf die eine oder andere Weise verschwunden. Wenn sie wie das Freihaus Platz gemacht haben für größeren, gesünderen Wohnraum, so begreift man die Schleifung. Aber in vielen Fällen steckten fehlende Weitsicht oder Spekulation hinter den Abbruchprojekten.
Ein Paradebeispiel auf der Wieden ist die Geschichte des Palais Erzherzog Rainer. Die Nr. 63 der Wiedner Hauptstraße war das Palais Engelskirchner, erbaut von einem reichen, aus den Niederlanden stammenden Textilgroßhändler. 1724 wurde es verkauft, wechselte oft den Besitzer. Im Biedermeier erwarb Heinrich von Geymüller das Palais und die barocke Gartenanlage. Der Bankier war ein Mann des Fortschritts, sein neuer Besitz bekam als erstes Privatgebäude der Stadt eine Gasbeleuchtung.
Auch der nächste Hausherr dachte modern. Erzherzog Rainer war ein ungewöhnliches Mitglied des Herrscherhauses. Er kam 1827 in Modena zur Welt, ein Enkel von Kaiser Leopold II. Mit 17 Jahren verließ er Italien und wurde ein Wiener. Er war liberal gesinnt, setzte sich für eine ehrliche Verfassung ein, hatte umfangreiche wissenschaftliche Kenntnisse und Interessen. Zwar trug er bei allen offiziellen Anlässen und sogar privat seine Generalsuniform, doch er besuchte auch gerne in Zivil ein Gasthaus und ging auf ein Krügel Bier.
Der Haupttrakt seines Palais stand am oberen Ende des steil zur Wiedner Haupstraße absinkenden Grundstücks, Rainergasse 18. Solch ein Standort wurde anderen Möglichkeiten vorgezogen. Diese Landschlösser, in der Sprache ihrer Zeit Villeggiaturen, ahmten einander beziehungsweise den französischen Stil nach. Auf zahlreichen Stichen informierten sich Bauherren und Baukünstler über den Dernier Cri. Und das war vor allem Versailles. Ludwig XIV. war auf seine Schöpfung nicht wenig stolz und förderte die Verbreitung ihrer Abbildungen, um mit der Pracht seiner Schlösser und Gärten seinen persönlichen Glanz zu erhöhen.
Die Baumeister wussten diese Darstellungen zu deuten und umzusetzen. Das Barock schätzte hügeliges Gelände. Eine gewisse Anhöhe, am besten in den Vorstädten der heutigen Bezirke Landstraße und Wieden, bot einen Blick über die Stadt hinweg zum Kahlenberg, zum Leopoldsberg. Und dieser Blick wurde durch die Gartenkunst gelenkt – das Blumenparterre wird von dunklen Hecken begrenzt, Statuen und Brunnen bieten dem Auge Überraschungen. Wir müssen uns diese noch ländlichen Vorstädte nach der Türkennot vorstellen – Bauer und Stadtbürger mussten nicht unentwegt um Besitz, Leben, Familie zittern. So entstand rund um Wien eine weitläufige Gartenlandschaft voller Landschlösser, deren Erbauer zumeist geschichtsträchtige Namen trugen: Das Kaiserhaus selbst zählte dazu und Liechtenstein, Savoyen, Schwarzenberg, Arenberg, Starhemberg, Schönborn. Als der Residenzstadt durch die Kuruzzen neue Gefahr drohte, wurde 1704 auf Wunsch des Prinzen Eugen ein neues Befestigungssystem angelegt: der Linienwall.
Erzherzog Rainer zu Pferd in Baden vor dem Kaiser-Franz-Josef-Museum, 1909
Erzherzog Rainer geht über den Naschmarkt. Aquarell von Alfred Gerstenbrand
Von dieser Anhöhe in der Rainergasse muss der Blick über die Stadt viel Freude bereitet haben, der Erzherzog wusste das zu schätzen. In Baden bei Wien erwarb er 1873 seine Sommerresidenz, den ersten Villenbau des jungen Otto Wagner. Seinem Wiener Stadtschloss ließ er eine Bibliothek anbauen, er umgab sich mit 40 000 teuer gebundenen Büchern. Die Sammlung von rund 100 000 Papyri, die er in Ägypten erworben hatte, schenkte er der Hofbibliothek (heute Nationalbibliothek), die damit die weltweit größte Sammlung dieser Art besitzt.
Von alldem wussten die Menschen, mit denen Erzherzog Rainer leutselig und freundlich Tag für Tag umging, nichts oder nur wenig. Der Erzherzog spazierte gerne zu Fuß durch die Stadt, beliebt und unentwegt gegrüßt. »Herr von Rainer« nannten ihn die Marktfrauen. Der Wiener Zeichner und Karikaturist Alfred Gerstenbrand erlebte eine solche Szene als Einjährig-Freiwilliger, als Artillerieoffizierslehrling, und rühmt die chevalereske Höflichkeit dieses Habsburgers: »Also, ich hab auf dem Weg in die Kasern immer über den Naschmarkt gehen müssen. Da hab ich einmal den Erzherzog Rainer getroffen, der ja sein Palais in der Näh’ gehabt hat. Natürlich hab ich mich zusammen gerissen und so stramm wie möglich Front gemacht und salutiert. Er hat sofort die Hand gehoben und mir danken wollen, da sind im nämlichen Augenblick zwei Standlerinnen zu einer Art Hofknicks niedergerauscht und haben geplärrt: ›Küß die Hand, Herr von Rainer!‹ No, und da hat er sich zu ihnen gekehrt und ihnen zuerst gedankt und dann erst mir. Er war halt ein Kavalier.«
1913 ist er gestorben. Bei seinem Tod sagte Kaiser Franz Joseph I. zu seinem Generaladjutanten Paar: »Er war ja schon ein sehr alter Mann!« Erzherzog Rainer war drei Jahre älter als sein Vetter, der Kaiser, der ihm 1916 gefolgt ist.
Da stand das Palais schon lange leer. Im Zweiten Weltkrieg kam es zu einigen Schäden, die aber die sowjetische Besatzungsmacht nicht daran hinderten, ihr Offizierscasino dort einzurichten. Nach 1955 hätte sich zwar aus dem ramponierten Prachtbau wieder etwas machen lassen, angesichts der vielen baulichen Verluste auf der Wieden. Doch die Zeit war nicht dafür. 1961 wurde das Palais geschleift. Bis 1965 baute die Reifenfirma Semperit ein Verwaltungsgebäude. Lange gebrauchte die AG dieses Riesenhaus freilich nicht, 1973 konnte sie nur mithilfe des Staates gerettet werden. Dann gab Semperit den Geist auf. Immerhin erhielt dadurch die Bundeswirtschaftskammer einen neuen, geräumigen Sitz.
Ein gewisser Trost – Semperit sorgte 1961–1965 für Kunst »am Bau« und auch »im Bau«. Erste österreichische Künstler kamen zum Einsatz – Fritz Wotruba, Max Weiler, Paul Flora und Joannis Avramidis.
Carl Moll: der alte Naschmarkt
Der Naschmarkt, den Erzherzog Rainer auf dem Bild von Gerstenbrand durchschreitet, hatte seinen Standort bis 1900 auf der Wieden, zwischen Freihaus, evangelischer Schule und Polytechnicum. 1793 wurde verfügt, alles Obst und Gemüse, das auf Wagen nach Wien geliefert wurde, sei hier zu verkaufen. Hingegen wurde, was über die Donau in die Stadt kam, am Schanzelmarkt angeboten, nahe dem Roten Turm, bei der Schwedenbrücke, ab dem späten 19. Jahrhundert ungefähr beim heutigen Ringturm.
Als man an die Regulierung des Wienflusses schritt, wurde der Naschmarkt provisorisch verlegt. Das Flussbett verschwand, wurde bis zur Schleifmühlgasse überwölbt. 1902 ließ die Stadt drei Zeilen mit pavillonähnlichen Marktständen errichten, und wie so oft wurde aus dem Provisorium ein Dauerzustand.
Wäre es nach der Planung der Gemeinde Wien gegangen, so gäbe es den Naschmarkt schon lange nicht mehr. Eine Stadtautobahn sollte vom Zentrum an den Stadtrand führen, und auch der Markt sollte am Stadtrand modern wiedererrichtet werden. Doch die 1970er-Jahre waren nicht nur von erschreckenden Fehlplanungen geprägt, sondern auch von Bürgerinitiativen, die deren Folge waren. Architekten, Architekturstudenten, Journalisten setzten sich zur Wehr, wie eine Schülerin von Gustav Peichl, die spätere Kulturstadträtin Ursula Pasterk.
Am 27. Juni 1976 wurde in der Arena, dem früheren St. Marxer Schlachthof, das Musical Schabernack uraufgeführt, das den Plan »Autobahn statt Naschmarkt« als Handlungsbasis hatte. Am selben Abend riefen die Schmetterlinge, eine politisch engagierte Folkband um den Autor Heinz Rudolf Unger und den Sänger Willi Resetarits, zu einem »Fest gegen die Schleifung des Naschmarkts«. Die Wucht der monatelang anhaltenden Protestaktionen führte zu kommunalpolitischem Umdenken. So konnte sich das Provisorium von 1902 erhalten, die bewährte Tradition überlebte.
Längst legendär war die »Frau Sopherl«. Die »Standlerinnen« wirkten in der Stadt, in den Vorstädten wurden sie »Höckerinnen« genannt. Der Wiener Journalist und Dichter Vinzenz Chiavacci (1847–1916) setzte den urbanen Marktfrauen ein literarisches Denkmal. Seine »Frau Sopherl« war deren Ideal – eine starke Frau, selbstsicher, selbstbewusst. Ihr Minnesänger Chiavacci beschreibt sie so: »Eine robuste, wohl gerundete Gestalt mit einem gutmütigen, von derber Gesundheit strotzendem Gesicht, aus dem zwei kluge, muntere Augen blitzen, ein Mund, dessen energischen Linien man ansieht, daß er in ewiger Bewegung ist … Den reichen Wortschatz des Wiener Dialekts und die traditionelle Volksweisheit … beherrscht sie mit souveräner Gewalt, nicht angekränkelt von des Gedankens Blässe.«
Frau Sopherl
Die Standlerinnen waren bekannt für ihre Schlagfertigkeit – und beliebt. Sie umwarben die Kundschaft – »Bitte, schöner Herr, sehr gerne, Frau Baronin!« –, solange man mit ihren Preisen einverstanden war. Begann man zu handeln oder gar zu kritisieren, ging ein Donnerwetter los. Wen es nicht getroffen hatte, der konnte gut lachen über den Wortschwall.
Meine Urgroßmutter, von Krakau nach Wien umgezogen, kannte die Bräuche noch nicht so genau, ging mit ihrer Köchin einkaufen und lehnte den genannten Preis ab. Einige Schritte – dann kam der Schlag ins Kreuz. Frau Sopherl hatte ihr die beanstandete Melone nachgeworfen, treffsicher. Die Köchin hätte es wohl besser gewusst, blieb aber wohlweislich still. Die Sopherl war solidarisch mit der dienenden Klasse und zielte erfolgreich auf die Herrschaft. Die hatte noch Glück, und es wurde eine durch Jahrzehnte weitergereichte Familienanekdote daraus.
Im Wienerlied heißt es:
Drüben am Naschmarkt, auf der Wieden, geht ein Stutzer promenieren.
Sagt am Standl zur Frau Sophie – sag, was kosten deine Birn?
Na vier Kreuzer, sagt Frau Sophie zu dem Kerl net verleg’n, doch der will ihr für die Birnen nur zwa Kreuzer niederlegen.
Bumsti, hat er eine Ohrfeigen und Frau Sopherl sagt zu ihm:
Ja, auf der Lahmgruab’n und auf der Wieden sein die Birn halt sehr verschieden.
Dazu ist zu sagen, dass im Urwienerischen »Birnen« auch »Verprügeln« bedeutet. Im originalen Text ist zwar von einer »Sali« die Rede, doch wir bleiben der Sopherl treu.
Der Naschmarkt liegt am Rande des Bezirks und ist dennoch ein Zentrum der Wieden. Aber er gehört nicht zu ihr – denn der unhaltbare Zustand, dass in Wien irgendetwas nicht klar geregelt ist, wie in Berlin, führte zu einem Gemeinderatsbeschluss im Jahre 2009, der den Wiedner Anteil dem 6. Bezirk übertrug. Die Bezirksgrenze war bis dahin quer durch den Naschmarkt verlaufen, der eine Trinker saß noch auf der Wieden, die einkaufende Ehefrau …
Wenn man auf der Wieden ein wirkliches Zentrum mit historischen Wurzeln sucht, ist es der kleine Rilkeplatz. Zwischen diesem und dem Hotel Triest an der Hauptstraße stand der Laszlaturm, ein festes Bollwerk, das seinen Namen dem festlichen Einzug des jugendlichen Königs Ladislaus, Laszlo, Postumus nach Wien verdankt. Der Name des kleinen Platzes meint nicht einen direkten Bezug des Namensgebers zur Wieden, er ist Ausdruck der Verehrung. Pure Geschichte ist die Dreiecksform – sie kommt auf der Wieden mehrmals vor und war typisch für Dorfanger des frühen Mittelalters.
Rilke hat mit seinem Platz nichts zu tun, er kam in Prag zur Welt, in Montreux liegt sein Grab. Aber viele andere berühmte Menschen, Künstler vor allem, haben auf der Wieden gelebt. Aus der Oberpfalz kam der Pionier der deutschen Oper, Christoph Willibald Gluck. Er legte seiner Zeit entsprechend großen Wert auf seinen kleinen Adel, also nannte er sich Chr. W. Ritter von Gluck. Was für ein Ritter war er? Er trug den Speron d’oro, den Orden vom Goldenen Sporn. Der wurde und wird vom Papst verliehen – auch Mozart hat ihn getragen. Aber wir kennen keine Briefe, in denen sich Wolfgang Amadé als W. A. Ritter von Mozart bezeichnet hätte.
Chacun à son goût. Gluck lebte 35 Jahre lang, bis zu seinem Tod 1787, im Haus »Zum silbernen Löwen«, Wiedner Hauptstraße 32. Stolz verweist es selbst über seinem Tor auf den Namen des früheren Besitzers. Seit vielen Jahren dient der »Silberne Löwe« dem Roten Kreuz als Zentrale.
Dieses Haus steht in enger Beziehung zum Leben eines weiteren Komponisten. Spät in seinem kurzen Leben konnte Franz Schubert ein eigenes Klavier erwerben, bis dahin war er von seinem klavierbesitzenden Freundeskreis abhängig. Dazu zählte der Maler August Wilhelm Rieder. Zwar war auch er immer wieder auf die Hilfe von Freunden angewiesen, weil ihm die Lebenshaltungskosten ständiges Problem waren. Erst als Kustos der Belvedere-Galerie konnte er sich eine eigene Wohnung leisten, im Gluckhaus, mit einem Klavier. Schubert wohnte nahe, an der heutigen Adresse Technikerstraße 9. So konnte er schnell bei seinem Freund Rieder sein, und das recht oft. Wenn der Maler seine Ruhe haben wollte, wurden die Vorhänge zur Straße hin zugezogen, das Zeichen respektiert. Immer wieder hat Rieder den Freund porträtiert, das bekannteste aller Schubert-Bilder ist sein Werk. Moritz von Schwind hat es als das beste gelobt.
W. A. Rieder, Schubert-Porträt
Johann Strauß Sohn ist in der Lerchenfelder Straße geboren worden, heute Bezirk Neubau, lebte in der Leopoldstadt, dann in Hietzing, wieder in der Leopoldstadt, diesmal auf der Praterstraße.
Die Johann-Strauß-Gasse und besonders das Haus Nr. 14 künden von diesem Meister der Meister. Seine erste Ehefrau Henriette Treffz hatte den Bauplatz für ein geräumiges Gebäude in der damaligen Igelgasse ausgesucht, doch noch bevor das Palais fertig war, starb sie. Der Walzerkönig lebte in der Igelgasse bis zu seinem Tod 1899, kurz danach wurde die Gasse umbenannt. 1944 hat eine Bombe diese seine letzte Adresse zerstört.
Aus Hamburg kam Johannes Brahms. 1872 entschloss er sich, Wien als Wohnsitz zu wählen. Er mietete eine Wohnung in der Karlsgasse 4, neben der Karlskirche, und blieb bis an sein Lebensende. Er gewann mit den Jahren rundum anerkannte Autorität, auch in der polarisierenden Auseinandersetzung mit Richard Wagner und Anton Bruckner. In seinem Stammgasthaus traf er eines Tages auf Bruckner, der auf der Speisekarte die gleiche Wahl getroffen hatte. Ein Lächeln beider Herren war die Folge, ein seltener Fall von Übereinstimmung.
Zu den Verehrern von Brahms zählte der Musikkritiker Ludwig Karpath. Als es sich in Wien herumsprach, Brahms sei schwer an der Leber erkrankt, zeige deutliche Anzeichen von Gelbsucht, trafen die beiden Herren per Zufall am Karlsplatz aufeinander. In der Verlegenheit und bemüht, ein Kompliment zu machen, rief Karpath dem verehrten Komponisten zu: »Also, so gelb sind Sie eigentlich gar nicht!« Brahms starb 1897 in Wien.
Um diese Zeit lebte der Komponist Hugo Wolf in der Schwindgasse 3. Er litt an Syphilis, verlor langsam den Verstand. Freunde sorgten nach längerem Klinikaufenthalt für eine andere Wohnung, ebenfalls auf der Wieden, Mühlgasse 22. Bald aber musste er wieder in eine Klinik gebracht werden, 1903 ist er gestorben.
Ein Komponist aus Berlin, der auch ein singender Schauspieler war, lebte zwischen 1845 und 1848 in der Wiedner Hauptstraße 50. Gustav Albert Lortzing hatte sich in beiden Professionen einen Namen gemacht. Ein gemachter Mann war er dennoch nicht. Nestroys Rollen schätzte er besonders, und er war ganz in dessen Sinne ein witziger Extemporist. Das brachte ihm freilich viel Ärger.
Der Vormärz war auch in Detmold und Leipzig, seinen früheren Wirkungsstätten, nicht gemütlich. 1845 kündigte man ihm in Leipzig, Publikum und Ensemble waren empört und protestierten, es half nichts. Lortzing, der eine glückliche Ehe führte, ging mit Frau und Kindern als Kapellmeister ans Theater an der Wien.
Hier arbeitete er an seiner Oper Der Waffenschmied und an der kaum bekannten revolutionären Oper Regina, die in einer Fabrik spielt. Doch die Einnahmen waren für die Familie zu gering.
Rosina Regina Lortzing – die Arbeiteroper trägt ihren Namen – kam auf eine Idee. Im Hof des Hauses Nr. 50 wurde ein Stall für einige Milchkühe gebaut. Nun war der Sängerkomponist ein Nebenerwerbsbauer, die Steuer führte ihn als Milchmeyer. 1848 ging diese Episode zu Ende, das Theater musste schließen. Die Familie verließ Wien und zog weiter nach Gera. Aber an der Fassade von Nr. 50 hämmert ein steinerner Waffenschmied weiter, der seinem Schöpfer recht ähnlich sieht.
Musik auf der Wieden … dazu ließe sich noch viel erzählen. Der mächtige Kritiker Eduard Hanslick hat hier gewohnt, in der Wohllebengasse 1. Wagner hat ihn so sehr verachtet, dass er nur mit Mühe davon abzuhalten war, eine lächerliche Figur Hans Lick zu nennen. Er hat sich dann doch für »Beckmesser« entschieden.
Eine spezielle Art Musiker war Hugo Wiener. Er kam aus einer musikalischen Familie, war hochintelligent und gebildet und in der Lage, seine außerordentlich witzigen Couplettexte selbst zu vertonen. Seine Frau Cissy Kraner war eine kongeniale Interpretin, so sind Klassiker entstanden – Der Novak läßt mich nicht verkommen, Wie man eine Torte macht, Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Seine Operette Auf der grünen Wiese war ein jahrelanger Erfolg der Wiener Volksoper, seine TV-Shows mit Kollege Georg Markus ebenfalls. Dazu kam noch der Jahrzehnte anhaltende Erfolg seiner Bücher, der Prosa des Humoristen Hugo Wiener, in der Nachfolge von Frigyes Karinthy und Ephraim Kishon.
Das Ehepaar Wiener war an skurriler Adresse zu Hause – Kleinschmidgasse 2. Warum skurril? Weil ihr Wohnhaus das einzige der gesamten Gasse war – und ist. Interessant ist auch die Liste der Bewohner – im Laufe der Jahrzehnte lebten nicht nur Hugo Wiener und Cissy Kraner dort, sondern auch die Kammersängerinnen Hilde Zadek und Renate Holm.
Peter Wehle, Hugo Wiener, Cissy Kraner
Ein anderer Vertreter der so typisch österreichischen Doppelbegabungen war Fritz von Herzmanovsky-Orlando. Geboren 1877 im 3. Bezirk, in der Marokkanergasse 3, ist er auf der Wieden aufgewachsen, in der Schwindgasse 12. Seine Herkunft ermöglichte ihm ein Leben ohne materielle Sorgen. Er machte seine Matura standesgemäß am Theresianum, also auch auf der Wieden, und studierte an der Wiener Technischen Hochschule, ebenso im 4. Bezirk, immer nahe zum Elternhaus. Er wurde Architekt, aber nur für wenige Jahre. Eine schmerzhafte chronische Nierenkrankheit zwang ihn zuerst zur Aufgabe seines Berufs, danach, 1916, zur Übersiedlung in den für ihn angenehmeren Süden, nach Meran. So lebte er nun seinen Neigungen – Denken, Schreiben, Zeichnen. Von seinen skurrilen Werken ist zu seinen Lebzeiten nur Der Gaulschreck im Rosennetz, eine Wiener Schnurre aus dem modernden Barock erschienen. Herzmanovsky hat dieses wie alle seine Werke selbst illustriert.
Das Titelbild der Erstausgabe, Artur Wolf Verlag
Er hat eine Fülle von köstlichen Erzählungen, Dramen und Romanen hinterlassen. Er starb 1954 und hat nicht mehr erlebt, dass das Burgtheater, das Münchener Prinzregententheater, das Zürcher Schauspielhaus seine Stücke spielten. Das bekannteste von ihnen ist Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter.
Von seinen Taten als Architekt gibt es nicht viel zu sagen. Im Nachbarbezirk Margareten stehen zwei Häuser, entworfen in Gemeinschaft mit Fritz Keller, eines in der Viktor-Christ-Gasse, ein zweites in der Wehrgasse. Dieses, die Nr. 22, wird in Achleitners Architekturführer als »ungewöhnlich streng« beschrieben. Im 18. Bezirk künden die Häuser Czartoryskigasse 5 und 7 von FHO.
Mit mehreren Bauten auf der Wieden ist ein Zeit- und Berufsgenosse Herzmanovskys verbunden, der wie Letzterer unsere Aufmerksamkeit, ja Verehrung, auch nicht so sehr als Architekt gefunden hat. Oskar Laske kam 1874 in Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, zur Welt. Er lebte zwar in Penzing, hat aber mit seinen Bildern, Bühnenbildern und auch Hausbauten eine Spur durch alle Wiener Bezirke gezogen. Auf der Wieden hat er das Haus Schaumburggasse 13 geplant, ebenso das Haus Graf-Starhemberg-Gasse 29.
Vom Schloss Schönburg am Schaumburgergrund, der im Namen dieses Buches auftritt, war noch nicht die Rede – wie auch von anderen interessanten Wiedener Bauwerken. Gundacker Thomas Graf Starhemberg, Stiefbruder des Verteidigers von Wien 1683, ließ sich nach Plänen des Baumeisters der Mächtigen, Johann Lucas von Hildebrandt, ein Schloss errichten, umgeben von einem scheinbar unendlich weiten Park. Aber nur hundert Jahre später, 1811, wurden das Schloss und der Park verkauft, der Grund wurde parzelliert, und innerhalb von kaum 40 Jahren entstand eine neue Vorstadt. Man wohnte gerne hier, vom Herrn von Faninal im Rosenkavalier heißt es: »Dem Mann gehören zwölf Häuser auf der Wied’n, nebst dem Palais Am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste sein.«
1841 erwarben die Fürsten Schönburg-Hartenstein das Palais mit dem immer noch ansehnlichen Park.
Einige Parzellen hatte Josef Karl Rosenbaum ersteigert. Er war Beamter der Familie Esterházy, lebte ab 1800 in Wien und schuf rund um sein neues Haus einen bald berühmten Garten. Seine Frau Therese Rosenbaum war eine Tochter des Komponisten Florian Gaßmann, Sängerin, in der Zauberflöte die erste Königin der Nacht.
Josef Rosenbaum hatte den Ruf, ein merkwürdiger Kauz zu sein, um einen Ausdruck seiner Zeit zu verwenden. 1816 kaufte er weitere Grundstücke und schritt an die Gestaltung seines Parks, die er in seinen Tagebüchern bis ins Detail schildert, alle Gespräche mit Baumeistern, Gärtnern, Arbeitern. Er ließ künstliche Grotten errichten, einen Turm im Stil der Hochgotik, ein Landhaus. Attraktion war die Camera obscura – eine Holzhütte mit optischen Effekten, die trotz der einfachen Gestaltung zu großem Staunen führte. Ein Sprachrohr stand zur Unterhaltung über weite Distanzen zur Verfügung, eine Sonnenuhr, Schaukeln, ein Karussell, eine Kettenbrücke über einen künstlichen Teich erfreuten die Gäste. Deren Liste konnte sich sehen lassen – Grillparzer, Castelli, Carl Maria von Weber, Peter von Nobile, Joseph Kornhäusel, Diabelli, Salieri …
Palais Schönburg heute
Von alldem ist nur die Erinnerung geblieben, unterstützt durch das penibel geführte Tagebuch. Wer heute den Namen Rosenbaum nennt, wird wahrscheinlich nicht sofort an den Garten auf der Wieden denken, sondern an Joseph Haydn.
Die Herren hatten einander gekannt, schon durch den gemeinsamen Dienst bei Fürst Esterházy, und geschätzt. Drei Tage nach Haydns Begräbnis 1809 am Hundsturmer Friedhof (heute der Haydnpark, Wien 12) wurde der Schädel des Meisters aus dem Grab geraubt. Die Täter muss man näher betrachten: Rosenbaum selbst, der verhindern wollte, dass bei einer späteren Grabauflösung »Halbmenschen, Afterphilosophen oder lose Buben« mit dem Cranium Gespött trieben. Ihm zur Seite standen die Magistratsbeamten Jungmann und Ullmann und der Totengräber Jakob Demut. Hauptbeteiligter war, das wird der Berufstitel wegen jetzt lang, Johann Nepomuk Peter, Verwalter des k. k. niederösterreichischen Provinzialstrafhauses in der Leopoldstadt und Leiter der fiskalen Unschlittschmelze. Alle Herren waren Verehrer der Gall’schen Schädellehre und am Haupt eines Genies, an seiner Form, seinen Maßen sehr interessiert. 1820 wurde der Raub entdeckt, nach einigem Weigern fand die merkwürdige Beute noch immer nicht zurück ins Grab, sondern erst nach 134 Jahren auf verschlungenen Wegen in die Eisenstädter Haydn-Kirche, zum Rumpf.
Der Garten Rosenbaums wechselte nach dem Tod des Schöpfers mehrfach den Besitzer – einer von ihnen war von einer Idee besessen wie Rosenbaum. Hatte dieser die Gartenkunst und den Pavillonbau Tag und Nacht im Kopf, so war jener erfüllt von der Welt von Technik und Chemie. Der Ungar Stefan Ladislaus Rómer (1788–1842) hatte eine Apothekerlehre absolviert, als er 1808 nach Wien übersiedelte. Nun übte er den erlernten Beruf aus und studierte nebenbei Pharmazie.
Er erkannte, wie wichtig es war, Feuer zu erzeugen – nicht nur für die Köchin, auch für den Raucher oder das Wäschermädl. Rómer experimentierte, nahm Rückschläge in Kauf, ließ sich nicht entmutigen und setzte sich gegen die wachsende Konkurrenz durch. Sie alle hatten dasselbe Problem – die Zündmasse der sogenannten Tunkhölzchen war nicht perfekt. Man musste solch ein Hölzchen in Schwefelsäure tauchen, dann entzündete es sich, aber auch nicht immer.
Schließlich erreichte Rómer den gewünschten Effekt durch Reibung an einer rauen Fläche – wenn man Glück hatte. Manchmal gab es nur einen Knall, aber kein Feuer, immer gab es argen Gestank. Als Rómer aber auf den Gedanken kam, der Masse Phosphor beizumengen, hatte er es geschafft.
Stillleben – Pfeife mit alten Streichhölzern
1832 reichte Rómer um ein »Privileg zur Zündholzerzeugung« ein, dieses entsprach unserem Begriff Patent, es ließ auf sich warten. Rómers Konkurrenten, selbst frühere Mitarbeiter, plagiierten inzwischen seine Erfindung und vermarkteten sie. Nach eineinhalb Jahren erreichte Rómer endlich sein Ziel. Schon 1829 hatte er einen Teil des Rosenbaum’schen Gartens gekauft, dort etablierte er nun die erste Zündholzfabrik Österreichs.
Die allumettes viennoises änderten mit ihrem eminenten Erfolg im In- und Ausland den Lebensstil des Erfinders. Franz Grillparzer wurde ein enger Freund, ebenso Ignaz Franz Castelli. Aus dem einstigen Starhemberg’schen Belvedere beim Linienwall wurde ein Landhaus, aus dem reich gewordenen Chemiker ein Wohltäter. Auf seinem großen Grundstück erbaute er das St.-Josef-Kinderspital, das seine Patienten ohne Entgelt behandelte, 1842 eröffnet. Als Stefan Rómer am 30. Juli 1842 seine Baustellen am Schaumburgergrund besuchte, um den Fortgang der Arbeiten zu kontrollieren, stürzte er, verletzte sich und starb.
Die Wiener Zeitung würdigte in ihrem Nachruf die Lebensleistung des verstorbenen Fabrikanten – und brachte in eben diesen Tagen auch den folgenden Bericht. Am 3. August 1842 liest man in den »Vermischten Nachrichten«: »Brand durch chemische Zündhölzchen.
Schon im verflossenen Jahr ergab sich der Fall, daß durch unvorsichtiges Hinwegwerfen eines nicht völlig verlöschten Phosphor-Zündhölzchens in einer Wohnung der inneren Stadt Feuer entstand, und hiebey mehrere Zimmer mit sehr wertvoller Austattung völlig ausgebrannt wurden.«
In der Folge wird von weiteren Unglücksfällen mit derselben Ursache berichtet – dennoch ging der Siegeszug der jungen Erfindung weiter.
Einer von Rómers Konkurrenten war Aaron Pollak, Besitzer einer Siegellackfabrik. Zu ihm gesellte sich Johann Preshel, der für Rómer gearbeitet und dabei viel Know-how erworben hatte. An dieser Stelle ließe sich viel zum Thema Reibzündhölzchen oder Friktionsfeuerzeuge erzählen, aber die Wieden hat noch andere Themen zu bieten. So viel muss aber noch sein: Pollak holte den Erfolg Rómers ein, übertraf ihn, expandierte in die USA, nach Südamerika, China, mit Niederlassungen in London, New York, Sydney. Der Erfolg der Zündmittel aus Österreich war nicht mehr aufzuhalten. Daran waren auch die nunmehr rotfarbigen Köpfchen der Zünder schuld, die parfümierten »Salonhölzer« sowie die Etiketten in verschiedenen Sprachen.
Diesen immensen Erfolg spürt die Wieden noch heute: Zur Geburt des Thronfolgers Rudolf stiftete Pollak das Rudolphinum, ein Heim mit 75 Plätzen für Studenten der Chemie und Physik. Diese Stiftung besteht noch heute, in der Mayerhofgasse 3.
Genug gezündelt – wie ging es auf den alten Schaumburger Gründen weiter? Rosenbaums Park, Rómers Spital, Gotischer Turm und Camera obscura bestehen längst nicht mehr. Das restaurierte Schlösschen der Familie Schönburg-Hartenstein jedoch ist nach wie vor in Privatbesitz und kann seit 2008 für Geburtstagsfeste oder Firmenjubiläen gemietet werden.
Palais Schönburg um 1900, Postkarte
Woher kommt der Name Schaumburgergrund? Das oberösterreichische Adelshaus der Schaunberger, fälschlich Schaumburger, hatte hier im 15. Jahrhundert die Herrschaft inne.
Die kleinste Vorstadt war Hungelbrunn mit nur elf Häusern. Ihren Namen bekam sie von einem Brunnen, der ohne Unterlass Wasser gab – auch in trockenen Jahren, die zu schlechten Ernten und Hunger führen konnten. Der Hungelbrunnen ließ die elf Häuser nicht im Stich – bis 1680. Da legte die Stadt eine Wasserleitung in das Zentrum, auf den heutigen Neuen Markt, zur Versorgung der Bevölkerung. Die elf Häuser können freilich nicht sehr klein gewesen sein, hier lebten bei der Eingemeindung 1600 Menschen. Am Haus Johann-Strauß-Gasse 19 hält ein Mosaik die Geschichte des Brunnens fest.
Das Schloss Schönburg ist das einzige aus dem Barock auf der Wieden, sieht man von der Favorita ab, deren einstiger Charakter sich durch ihr wechselndes Schicksal und Umbauten verändert hat. Dieser Lieblingsaufenthalt dreier Kaiser, Leopolds I., Josephs I. und Karls VI., verlor seine Favoritenstellung schlagartig, als Maria Theresia Schönbrunn den Vorzug gab. Ihr Vater Karl VI. war 1740 nach anstrengender Jagd im Marchfeld in dem Schloss gestorben. Seit seinem Todestag mied sie die Favorita und übergab das weitläufige Gebäude 1746 dem Jesuitenorden, der daraus eine Schule für Söhne des Adels machen sollte – »die adelige Jugend soll in allen erforderlichen Wissenschaften und Exercitien unterrichtet werden.«
1773 wurde der Orden durch Papst Clemens XIV. aufgehoben, die Piaristen traten ihre Nachfolge im Theresianum an. Aber schon 1783 löste Joseph II. im Zuge seiner Schulreform das Institut auf. Sein Nachfolger Franz II. ließ 1797 die Theresianische Ritterakademie wiedererrichten. Seither ist die Geschichte dieser Eliteschule ein Spiegelbild der Geschichte Österreichs, mit Höhepunkten und Krisenzeiten.
Das Theresianum hat das Ende der Monarchie überstanden, erst die deutsche Verwaltung der Republik hat die Schule 1938 aufgelöst. Der Krieg fügte den Gebäuden schwere Schäden zu, die Schule blieb geschlossen. 1957 zogen erneut Theresianisten in die einstige Favorita, heute ein öffentliches Gymnasium, ohne Einschränkungen von Geschlecht oder Abkunft. Immerhin in einer Hinsicht ist das Gebäude noch immer etwas Besonderes – es verfügt über die zweitlängste barocke Fassade von Wien. Einzig die der früheren Hofstallungen, nunmehr Museumsquartier, ist ein wenig länger.
Karl VI. beim Jagdfrühstück. Figurinengruppe von Helmut Krauhs
Unterhalb des Theresianums, in der Favoritenstraße 7, steht das Palais von Erzherzog Carl Ludwig. Was man zuerst zu sehen bekommt, ist eine Fassade der jüngsten Zeit, die sich verkleidet hat, um nicht so schlecht auszusehen angesichts dessen, was im Hof wartet. Das Schlösschen hat eine barocke Vergangenheit, Heinrich von Ferstel hat es für den Erzherzog umgebaut. Carl Ludwig, Bruder von Kaiser Franz Joseph, ist durch seine Söhne in Österreichs Geschichte eingegangen – durch Franz Ferdinand, in Sarajevo ermordet, und dessen jüngeren Bruder Otto, den Vater des letzten Kaisers, Karls I.
In Sichtweite steht die Karlskirche, bedeutendster Sakralbau des Wiener Barock. Das Gebäude selbst und ebenso seine Kunstwerke und Künstler, die beiden Fischer von Erlach, Martino Altomonte, Daniel Gran, J. M. Rottmayr, verlangen eine ausführliche Behandlung, die hier nicht genügend Platz fände.
An das Barockwunder hat man in den 1960er-Jahren einen Neubau geklebt, dem der imposante barocke Vorgänger hatte weichen müssen.
Der Karlsplatz wird gegen den 1. Bezirk vom Wien Museum abgeschlossen. Das Haus ist nicht alt und hat dennoch eine lange Geschichte. Die erste Sammlung zum Thema Wien wurde im neu erbauten Rathaus untergebracht. Sie wuchs sehr schnell, bald war klar, dass der Raum nicht ausreichen würde. Mehrere Projekte wurden eingereicht, auch Otto Wagner machte einen Vorschlag.
Aber der Erste Weltkrieg verhinderte einen aufwendigen Neubau, ebenso der Zweite. Endlich, 1959, wurde eröffnet – Oswald Haerdtl, früherer Mitarbeiter von Josef Hoffmann, war der Architekt. So entstand ein funktioneller, moderner, qualitätvoller Bau, dessen erster Direktor der Polyhistor und berühmte Buchsammler Franz Glück war. Allerdings ist das Haus mit seinen drei Etagen inzwischen zu klein für die wachsende Sammlung und die sehr beliebten Wechselausstellungen.
Die Karlskirche mit dem abgebrochenen Nebenhaus, der ältesten Munitionsfabrik Europas
Zu der Ausführung des Wagner-Projekts ist es zwar nicht gekommen, dennoch ist der große Visionär am Karlsplatz ungemein eindrucksvoll vertreten. Otto Wagner hat Stationsgebäude entworfen, die, als hervorragende Bauwerke des Wiener Jugendstils, Teil des Gesamtkunstwerks Stadtbahn sind.
Otto Wagners Museumsprojekt. Eine Wand, aufgestellt zur Prüfung des Plans
Die Pavillons am Karlsplatz waren bereits für den Abbruch vorgesehen, konnten aber durch massiven Protest der Bevölkerung gerettet werden. Restauriert und wieder aufgebaut dient der eine heute als Außenstelle des Wien Museums, der gegenüberliegende als Kaffeehaus.
Auch wenn man es kaum glauben mag, erstreckt sich der Karlsplatz von der Madergasse hinter dem Wien Museum bis zur Operngasse. So hatte er jedenfalls einst, in seinen Kindertagen, begonnen. Seit 1716 ist allerhand passiert, vor allem der Teich. Ersonnen und geplant von dem schwedischen Gartenarchitekten Sven Ingvar Anderson, führte er zu größter Aufregung. Clemens Holzmeister, oberste Instanz der Baukunst Österreichs, war »erschüttert«, die Tageszeitung Kurier taufte den Platz um in »Chaosplatz« und meldete sein Ende im Mai 1977 unter der Schlagzeile »Verplant in alle Ewigkeit«. In der Tat kann von einem Platz längst keine Rede mehr sein. Die sechsspurige Stadtautobahn zwischen Café Museum und dem Schwarzenbergplatz hat den Südrand des einstigen Platzes verschlungen, dennoch hat der Musikverein die Adresse Karlsplatz 6.
2006 wurden die Reste neu begrünt und zum Teil auch neu benannt, so entstanden der Esperantopark, der Rosa-Mayreder-Park und der Girardipark. Den größten Teil des einstigen Karlsplatzes nimmt der Resselpark ein, rund 40 000 m². Seinen Namen hat er vom Schiffsschraubenerfinder Josef Ressel, dessen Denkmal hier steht. Unter »Resselpark« hat man einige Jahre lang eine spezielle Form von Nachkriegshandel verstanden, den Schleichhandel. Zeugnis eines Zeitgenossen: »Ich ging in unsere Trafik, die Trafikantin hatte sich dummerweise in die Partei einschreiben lassen und hatte ihr Geschäft schließen müssen. Sie besaß noch verschiedene Vorräte, aber nichts zu essen. Ich bekam von ihr ein paar Pakete Feuersteine und Zigaretten. Damit ging ich in den Resselpark und machte gute Geschäfte für sie.
Ich brachte ihr Brot, Schmalz, Mehl und andere Lebensmittel …« Der Feuilletonist Theodor Ottawa schrieb am 25. September 1945: »Man hat den Resselpark so lange bekämpft, bis er geblieben ist. Alle Leute sind über das schändliche Treiben, das sich dort abspielt, sehr empört und sie gehen hin, um sämtliche Waren aufzukaufen, damit dem Schleichhandel endlich einmal das Wasser abgegraben werde. Die Spekulanten, die sich hier bewegen, haben keine Ausdrücke der Börsenleute. Sie sagen schlicht: ›Glauben S’, i bin teppert?‹ Oder ›Hearn S’, verzupfen S’ Ihnen!‹. Wenn die Polizei eine Razzia plant, dann finden sie im Park nur ein paar dürre Blätter vor, die von alten Weiblein eingesammelt werden.«
Zeichnung »Razzia im Resselpark 1945« von Robert Lukas
Die älteren Damen wissen von nichts, werden aber dennoch perlustriert, wie das in der amtlichen Fachsprache heißt: »Man findet bei ihnen 50 Feuerzeuge und 20 Schachteln Sacharin – niemand will ihnen glauben, daß sie mit dem dürren Laub so schwer Feuer machen und darum einige Feuerzeuge brauchen. Niemand will ihnen glauben, daß sie ihren Ersatzkaffee auch ein bisserl süßen wollen. Nicht einmal den Bedarf an Seife und Seidenstrümpfen, die sie bei sich haben, gesteht man ihnen zu. So sind die Menschen …«
Die Satire mit ihrem gern boshaften Witz hat die sieben Tausendjährigen Reichsjahre ebenso überlebt wie die Bombenangriffe. Jetzt wird in den Zeitungen empfohlen, der sicher demnächst wiedereröffnete Wurstelprater möge Kasperlstücke bringen wie Hanswurst als Minister oder Der bestrafte Schleichhändler oder Wer zuletzt lacht, hat am meisten!. Den Drehorgelmännern wird der Entnazifizierungsmarsch empfohlen und ein neues Wienerlied – Mir hat heut’ tramt, es gibt kein Brot mehr …
Tempi passati, zum Glück. Mit 1948 ging der Schwarzhandel zu Ende. Die Erinnerung an den »Schleich« ist der Gegenwart von Adventmarkt und Hundeplatz gewichen.
Im Resselpark wurde einem der bedeutendsten Mitgestalter der Ringstraßenzeit 1902 ein Denkmal gewidmet – ein Brunnen würdigt den Bildhauer Viktor Tilgner (1844–1896). Er schuf Statuen in großer Zahl – die Dichter Archimedes und Homer und seinen Kollegen Phidias vor dem Parlament, Mozart im Burggarten, Schiller, Goethe, Lessing im Burgtheater und viele andere.
Das Gebäude der Botschaft Frankreichs
Der 4. Bezirk macht dem 3. starke Konkurrenz als Diplomatenviertel. Das prominenteste dieser Gebäude steht am Schwarzenbergplatz: die französische Botschaft. Das Gebäude wurde zwischen 1900 und 1909 erbaut, sein Architekt war Georges Chedanne. Sein Begriff von Jugendstil deckte sich nicht mit jenem von Wien, Art Nouveau war nicht dasselbe wie der Secessionsstil. Das neue Haus wurde heftig angefeindet, als Inbegriff schlechten Geschmacks.
Jedermann wusste etwas dazu zu sagen. Natürlich stimmte vieles nicht – wie die Erklärung der roten Kavalleriehosen, sie seien Restbestände der mexikanischen Armee des unglücklichen Kaisers Max von Mexiko, oder sein Bruder Franz Joseph I. sei 169 cm groß, und er reiche nur Familienmitgliedern die Hand.
Unter den vielen Gerüchten, die einst die Kaiserstadt durcheilten, als noch kein Google oder ein ähnliches modernes Orakel befragt werden konnte, betraf eines auch das Botschaftsgebäude. Man habe die Pläne für Konstantinopel und Wien verwechselt, daher die merkwürdige Fassade. Und in der Tat wirkt das Haus seltsam und scheint sich selbst nicht ganz wohl zu fühlen, in seiner Umgebung von Hochbarock und geballtem Historismus. Ob in Buenos Aires vergleichbare Gerüchte en vogue waren? Jedenfalls hat Chedanne ein ganz ähnliches Botschaftsgebäude in die argentinische Hauptstadt gestellt.
À propos – in der Argentinierstraße wurden im späten 19. Jahrhundert mehrere Wohnhäuser und Palais im Stil des Historismus erbaut, die zum Teil heute exterritoriales Gebiet sind.
Das ehemalige Palais Falkenstein dient als griechische Botschaft. Weiter aufwärts, an der linken Straßenseite, findet sich eine venezianische Spur – ein großes Glasmosaik der berühmten Firma Salviati aus Venedig. Fellner und Helmer entwarfen dieses Haus im Stil der italienischen Renaissance.
Das Nebengebäude ist der Sitz der Handelsvertretung Russlands. Bald danach ragt aus einem Wohnhaus die Trikolore grün-weiß-rot, Sitz des italienischen Konsulats. Knapp vor dem Ende der Straße, an der Ecke zur Theresianumgasse, hat die Botschaft des Königreichs Spanien ihren Sitz. In der nahen Prinz-Eugen-Straße sind weitere Staaten vertreten – Brasilien, Rumänien, Türkei.
Ein Gebäude in der Mitte der Argentinierstraße verdient ganz besondere Erwähnung, ein wichtiges Werk des großen Clemens Holzmeister und zweier Partner – das Funkhaus. Ab 1935 erbaut ist es ein Stück bester österreichischer Kulturgeschichte.
In der nahen Plößlgasse stehen zwei kleine Wohnpalais, die die Namen ihrer ersten Besitzer tragen – Albert Baron Rothschild auf Nr. 5–7, früher ein Teil des Palais Prinz-Eugen-Straße 26, und Nathaniel Rothschild auf Nr. 8.
Das Palais Alphonse Rothschild stand auf leichter Anhöhe, Ecke Theresianumgasse und Argentinierstraße, und bot über den weit ausgedehnten Park ein prächtiges Blickfeld von der Kuppel der Karlskirche über die Innere Stadt. Von den neuen Machthabern 1938 beschlagnahmt, wurde das Palais Sitz der SS und der Gestapo. Durch Bombentreffer wurde es so schlimm beschädigt, dass es bald nach Kriegsende abgerissen wurde. Im Nachfolgebau ist außer dem Theater Akzent auch das Bildungszentrum der Arbeiterkammer untergebracht.
Das prächtigste aller Rothschildpalais in diesem Viertel hatte sich Albert Freiherr von Rothschild zwischen 1879 und 1884 in der Heugasse, heute Prinz-Eugen-Straße 20–22, erbauen lassen. Seine Kunstsammlung war weltberühmt, er galt als reichster Mann Europas. Seinem Sohn Louis gelang 1938 die Flucht vor den Nazis nicht, er wurde verhaftet und im Hotel Metropol, dem Gestapo-Sitz, ein Jahr lang misshandelt und zum Verzicht auf den gesamten Besitz gezwungen. Dann konnte er Österreich verlassen, ein gebrochener Mann. Das Palais konfiszierte der SD, eine SS-Dienststelle. In den Rothschild’schen Räumen residierte nun der Inbegriff der hochgebrodelten Unterschicht, Adolf Eichmann mit seinem Spießgesellen Alois Brunner. Sie organisierten den Mord an mehr als 65 000 österreichischen Juden.
Prinz-Eugen-Straße 26 ist heute der Sitz der brasilianischen Botschaft, auch dieses Haus war und ist in Rothschildbesitz.
Im Palais Miller-Aichholz, Prinz-Eugen-Straße 28, hatte eine überaus schillernde Persönlichkeit die Nachfolge des Bauherrn, des berühmten Kunstsammlers Eugen von Miller zu Aichholz, angetreten. Im Sommer 1918 erwarb der Glücksritter Camillo Castiglioni den prachtvollen Besitz – mitsamt den fünf großen Tiepolo-Bildern im Stiegenhaus. Den neuen Besitzer treffen wir bald wieder, im 8. Bezirk. Das vom Krieg nur leicht beschädigte Palais wurde wie so vieles in Wien abgerissen, im Jahr 1961. Die Tiepolo-Bilder gehören längst dem Metropolitan Museum in New York.
Auf Wiedner Hauptstraße 15–17 steht der Habig-Hof. Die 1862 gegründete Hutfirma Peter Habig erzeugte weltweit geschätzte Produkte. Das elegante Verkaufslokal im Parterre und die stolze Fassade grüßen aus dieser vergangenen Zeit. Auf Nr. 29 stand die Fabrik, deren Erzeugnisse sehr populär waren, bis Hüte langsam aus der Mode kamen.
Eine Erinnerung in Venedig andie Weltfirma Habig
Diese uralte Straße in den Süden ist so voller Geschichte, wir bleiben noch. An ihrem Beginn, Haus Nr. 7, steht das alte Hotel »Goldenes Lamm«, sein berühmtester Stammgast war der Komponist Antonín Dvořák, de m eine Gedenktafel gewidmet ist.
Eine Fußnote: Im Fiakerlied heißt es »Vom Lamm zum Lusthaus fahr’ ich …« Dieses Lamm jedoch ist nicht jenes. Das Fiaker-Lamm stand in der Praterstraße 7, wurde im Krieg zerbombt und hat einem Neubau der Bundesländer-Versicherung Platz gemacht. Von da zum Lusthaus kann der Fiaker durchaus in den im Text genannten zwölf Minuten fahren – »nur allweil trab, trab, trab«. Vom »Lamm« auf der Wieden wäre das unmöglich. Und um zu verhindern, dass mein Verlag böse Briefe von Wienerliedkennern bekommt, noch eine Bemerkung: Im Urtext heißt es »vom Grab’n zum Lusthaus«, doch aus dem Grab’n ist bald das »Lamm« geworden, dessen Portier wird wohl den Liedsängern günstigere Konditionen geboten haben.
Und jetzt im Galopp zurück zum »Goldenen Lamm«: Der Fernverkehr war in grauer Vergangenheit an bestimmte Gasthöfe angebunden. Von diesem Lamm gingen Stellwagen nach Hainburg, Mödling, Pottendorf. Wer auf die Reise nach Güns oder Steinamanger gehen wollte, bestieg den Stellwagen gegenüber, beim Hotel »Zur Stadt Ödenburg«.
Auf Nr. 12 stand der »Schwarze Bär«, später Hotel »Stadt Triest«, heute »Das Triest«. So weit fuhren die Stellwagen von hier zwar nicht, man kam aber immerhin nach Laxenburg oder Traiskirchen.
Habig-Hof und Gluck-Haus haben wir schon besucht, nächste Station: Wiedner Haupstraße 44, »Zum Ritter Sankt Georg«. Hier lohnt es sich, zu verweilen – man lernt Bezirksgeschichte. Ein Sgraffito zeigt den »Klagbaum« und das Wappen von Hungelbrunn, die sagenhaft tapfere Elisabeth und das Schaumburger Wappen, den Laszlaturm und das Wiedner Wappen, den Kampf mit dem Bären, die Osmanen, die Zauberflöte.
Dieser mutigen Elisabeth begegnen wir gleich wieder, vor dem Café Wortner, auf Nr. 55. Sie war eine Müllerstochter, in diesem Mühlenbezirk sicher eine gute Partie. Die beiden Gauner, zu deren Häuptern sie sich offensichtlich gerade das Haar wäscht, hat sie unschädlich gemacht, der eine hieß Hans Aufschwing, vom zweiten kennen wir nicht den Namen, aber den Beruf, er war Wirt. Nun sitzt er da als eine Warnung für die Inhaber des gastronomischen Betriebs in seinem Rücken.
Sollten Sie sich schon oft Gedanken gemacht haben, wer denn dieser Sir Edgar Joseph Böhm sein kann, an den eine Gedenktafel am Haus Wiedner Hauptstraße 60 erinnert – Sie sind am Ziel. Vater und Sohn Böhm waren Graveure. Böhm sen., Joseph, war Direktor der Graveurakademie am Hauptmünzamt in Wien.
1834 geboren, war Böhm jun., nunmehr Boehm, schon mit 22 Jahren außerordentlich erfolgreich – in London, als Bildhauer. Er blieb, hatte weiterhin großen Erfolg mit seinen Statuen, wurde Brite, Mitglied der Royal Academy, geadelt, bekam zahlreiche hoch dotierte Aufträge, wurde Freund und Lehrer einer Tochter von Queen Victoria. Eine Statue dieser Frau, der Königin und Kaiserin, die beinahe die Schwiegermutter Sir Edgar Josephs geworden wäre, schuf er für die Stadt Bristol.
Nr. 62 ist der Sitz der Freien Bühne Wieden, gegründet von Topsy Küppers und Carlos Springer, seit Jahrzehnten eine mutige Stätte zahlreicher Uraufführungen. An der Stelle von Haus Nr. 64 stand vor langer Zeit der Klagbaum, der nicht nur blühte, sondern eben auch klagte und so vor drohenden Gefahren warnte. Wäre das tatsächlich so gewesen, er stünde als amtliche Institution heute noch hier.
Nun sind wir bei St. Thekla. St. Thekla an der Wiedner Hauptstraße 82 ist keine Pfarrkirche wie die bisher erwähnten Gotteshäuser. Sie gibt zusammen mit dem Klostergebäude einen Eindruck ihrer Bauzeit. Die Piaristen erwarben 1752 einen Grund auf der Wieden und bauten eine Kirche und ein Kloster, geweiht am 26. September 1756. Ihr Baumeister war Matthias Gerl, den Piaristen ein vertrauter Partner. Er hatte schon den Umbau der Kirche in der Josefstadt geleitet. Gerl war ein Mann der Praxis, klarer Entscheidungen, zupackend und hilfreich. 1752 überantwortete ihm Maria Theresia den Umbau der alten Burg von Wiener Neustadt in eine moderne Lehranstalt, die Alma Mater Theresiana, die Militärakademie. Gerl war aber nicht nur Praktikus, er war sehr wohl auch Künstler, das hat er mit der schönen Pfarrkirche von Traiskirchen bei Baden bewiesen.
Der Piaristenorden hat eine spanisch-italienische Gründungsgeschichte. In Nikolsburg in Mähren hatte er seine erste Niederlassung nördlich der Alpen, bald folgten weiter Klöster in Österreich. In Wien wurde eine erste Kirche erbaut, ihr Baumeister dürfte Johann Lucas von Hildebrandt gewesen sein.
Porträt Joseph Missons
Der herrliche Burgschauspieler Richard Eybner – Sie erinnern sich?! – hat mir in mehreren Vortragsabenden einen Piaristen nähergebracht, der auf der Wiedner Hauptstraße nicht zu vermuten war. Joseph Misson starb 1875 im Kollegium St. Thekla. Seine Herkunft und sein Lebenslauf waren zwar nicht von Abenteuern, aber von aufregender Buntheit geprägt.
Der Vater war Friulaner aus Udine, Giovanni Battista Misson. In diesem Familiennamen steckt das altitalienische Wort für Pflicht, aus dem später missione wurde. Lebenspflichten und eine spezielle Mission haben den Sohn des Friulaners Joseph geprägt, dessen Mutter aus Zemling am Mannhartsberg stammte. Und dort kam 1803 Misson filius zur Welt, in Mühlbach ist er als achtes Kind des lebensfrohen niederösterreichisch-italienischen Elternpaares aufgewachsen.
In Krems hat er maturiert, dann wurde er Piaristen-Novize. 1826 trat er seine erste Stelle als Lehrer an, und diese Berufung blieb ihm sein Leben lang, auf diese oder jene Weise. In Horn, Krems und Wien hat Misson unterrichtet, in Stein war er 1848/49 Kaplan der Nationalgarde. Wenige Jahre später übersiedelte er nach Wien und blieb im Kloster St. Thekla bis zu seinem Lebensende als Bibliothekar.
Und weshalb musste das alles erzählt werden? Weil Joseph Misson neben seinen Priesterfunktionen eine zweite Mission erfüllte. 1850 erschien der erste Teil seines bedeutenden Werks Da Naz. A niederösterreichischer Bauernbui geht in d’ Fremd’.
In Hexametern erzählt Misson in der Mundart seiner Heimat ein ihm vertrautes Schicksal – ein Denkmal für den niederösterreichischen Dialekt, der nicht gleich dem der Wiener ist – und stellt in immer wieder rührender Weise das einfache Leben im Dorf dar, auch die Schönheit seiner heimatlichen Landschaft.
Joseph Misson hat nicht die Anerkennung gefunden, die er verdient hätte. Sein Werk soll nicht verloren gehen, vielleicht findet sich noch ein Sprachmeister, der dem Naz zum Weiterleben verhilft. Richard Eybner jedenfalls hat dem Naz viele Vortragsabende gewidmet, das Werk auch auf Schallplatte aufgenommen. In St. Thekla ist Misson am 28. Juni 1875 gestorben.
Bei St. Thekla mündet die Phorusgasse – die nicht griechisch »Forusgasse« auszusprechen ist, sondern mit stummem H, also Porusgasse, denn … Das soll der bewährte Chronist Franz Gräffer erklären (Kleine Wiener Memoiren, Wien 1845): »Phorus ist ein Wort, welches man weder in einem griechischen, noch in einem Sprachwörterbuch findet. Auch in einem Personenlexikon wird man es nicht antreffen. Neulich aber ward behauptet, das Wort Phorus müsse durchaus hellenischen Ursprungs, wohl gar mythologisch sein. Bei dem Anblick dieser Zeilen werden viele Leser lächeln, nämlich jene, welchen die Komposition des Wortes Phorus bekannt ist; alle aber wissen sie doch nicht. Dieses Wort, welches die erste privilegierte Holzzerkleinerungsanstalt Wiens bezeichnet, ist aus den Anfangsbuchstaben der ersten Unternehmer jener Anstalt zusammengesetzt, nämlich: Palffy, Hackelberg, Offenheimer, Remscher, Unger, Schönfeld.« Diese »Anstalt« hat einfach aus Baumstämmen handliche Scheiter geschnitten und bestand bis 1856. Vom Holz zum Metall: Von der Paulanerkirche führt in Richtung Schwarzenbergplatz die Gusshausstraße, die ihre Geschichte schon im Namen trägt. Das Haus, das ihr den Namen gab, stand auf Nr. 25. Als k. k. Kanonengießerei 1750 erbaut, hat es 1850 diese Aufgabe verloren, im neuen Arsenal wurde nun gegossen. Doch ganz hat das alte Institut seine Funktion nicht aufgegeben, denn 1861 hat man hier eine Fachschule eingerichtet, das k. k. Kunsterzgießhaus zur Ausbildung von gießtechnisch begabten Jungkünstlern. Ihr Leiter war Anton Dominik Fernkorn, ein wirklicher Meister dieses Fachs. Er hatte im selben Gebäude sein Atelier, was seinen Schülern zugute kam. In diesen Räumen sind die beiden prominentesten Reiterstatuen Wiens entworfen und gegossen worden, Prinz Eugen und Erzherzog Carl vom Heldenplatz.
Aber schon hundert Jahre vor dem aus Erfurt gebürtigen Fernkorn war ein anderer Großer der Bildhauerei im Gusshaus am Werk – Franz Xaver Messerschmidt. Er kam 1736 in Wiesensteig in der Nähe von Stuttgart zur Welt, doch wie Fernkorn wurde auch ihm Wien zur Schicksalsstadt. Ab 1755 studierte er an der Akademie der bildenden Künste und fand einen Förderer im Hofmaler Martin van Meytens. Dieser verschaffte dem jungen Kollegen eine Stelle als Kanonenrohr-Ziseleur im Gusshaus.
Ein tragisches Schicksal hat beide Gusshaus-Künstler getroffen. Anton D. Fernkorn hat mit der Statue Erzherzog Carls eine bis heute viel beachtete virtuose Meisterleistung vollbracht – das Feldherrnross steht auf zwei Beinen, kein Strauch oder Baumstamm stützt den tonnenschweren Leib, die Gussmasse hatte ein Gewicht von 350 Zentnern. Zum Studium der Bewegungen ließ sich Fernkorn immer wieder Pferde aus den Hofstallungen in sein Atelier bringen. Auch Ernst Renz, der Zirkusdirektor, setzte seine edlen Hengste in der Gusshausstraße in allen Gangarten in Bewegung, um den Bildhauer zu unterstützen.
Anton Dominik Fernkorn mit dem Modell des Carl-Denkmals
Lange Zeit konnte man sich nicht erklären, wie er das Kunststück zustande gebracht hatte – die temperamentvolle Bewegung auf der Hinterhand ohne Stütze. Als das bald abgesagte Projekt einer Garage unter dem Heldenplatz zu Probearbeiten in der Erde führte – da zeigte sich, dass das Geheimnis der Statue unter dem Erdboden lag. Wie ein Segelboot durch ein Kielschwert an Stabilität gewinnt, so auch das Denkmal. Fernkorn hatte eine rund elf Meter lange Metallschiene in den Sockel und den darunterliegenden Boden versenkt.
Dieses Kunststück wollte er beim Eugen-Denkmal wiederholen, doch es gelang ihm nicht. Das Pferd des Savoyers kann die Levade nur schaffen, weil der Schweif sich auf den Sockel stützt. In diesen Monaten traf den Meister mehrmals der Schlag – er konnte sein Eugen-Projekt nicht zu Ende führen. Er soll infolge von Überanstrengung und Schwermut den Verstand verloren haben. Fernkorn kam 1868 in eine Irrenanstalt.
Franz Xaver Messerschmidt wurde neben Hofmaler van Meytens auch von Maria Theresia sehr geschätzt – 1769 bekam er eine Stelle an der Wiener Akademie. Aber 1771 zeigten sich Anzeichen schwerer seelischer Störungen, die 1774 zu seiner Pensionierung führten. Messerschmidt übersiedelte zu seinem Bruder nach Pressburg – und begann mit der Serie seiner weltberühmten Charakterköpfe. Zur selben Zeit brach seine Geisteskrankheit aus. Die Bleigüsse dieser Reihe von grotesken Fratzen sind zum Teil im Besitz des Belvedere.
Ein Erzbösewicht
Und die Gusshausstraße 25? 1900 war Schluss mit der Gießerei, im Haus wurde das Elektrotechnische Institut untergebracht.
Abschließend sei noch ein Haus mit Geschichte erwähnt: An den außerordentlich seltenen Fall eines Attentats auf einen österreichischen Monarchen mag man an der Ecke Operngasse und Schleifmühlgasse denken. Das Haus »Zum grauen Adler« war im Besitz des Fleischhauermeisters Josef Ettenreich. Er durfte sich »von Ettenreich« nennen, nachdem er einen schwarzgelben Adler gerettet hatte: Er hatte am 18. Februar 1853 mitgeholfen, das Attentat des Schneiders Johann Libenyi auf Franz Joseph I. zu verhindern. Der junge Kaiser war nur leicht verletzt, er wünschte nicht die Todesstrafe für den Attentäter – aber die Minister waren entschieden dafür. Libenyi wurde gehenkt. Franz Joseph setzte der Mutter des jungen Mannes eine lebenslange Rente aus, von ihm selbst bezahlt.