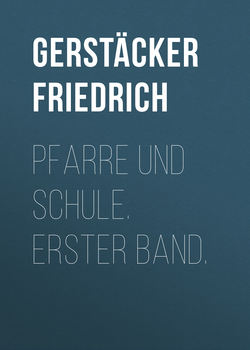Читать книгу Pfarre und Schule. Erster Band. - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 4
Drittes Kapitel.
Der Diaconus und der Hülfslehrer
ОглавлениеEs war gegen Mittag desselben Sonnabends, mit dem ich diese Erzählung begonnen, als Pastor Scheidler in seiner Studierstube saß und sich gar eifrig für die morgende Predigt vorbereitete. Um ihn her lagen eine Masse Bücher, Hefte und Zettel, und er selber stand oft auf, ging mit auf den Rücken gefalteten Händen eine Zeit lang rasch im Zimmer auf und ab und memorirte laut und heftig.
Es mußte aber heute etwas ganz Wichtiges sein, was ihm bei seinem Studium so schwere Sorge machte, denn sonst wurden ihm die Predigten gar nicht so sauer, und ein paar Candidaten hatten in der benachbarten Stadt schon ausgesprengt, er wisse genau, wo er in alten staubigen Büchern nagelneue Sermone auffinden und benutzen könne. War das wirklich einmal der Fall, so durfte es sicherlich auf diese keine Anwendung finden, denn die ganze Nacht hatte er geschrieben, wieder ausgestrichen, wieder geschrieben, und endlich schon mit Tagesdämmerung den zu Papiere gebrachten Entwurf auswendig gelernt.
In derselben Etage, aber dicht an der Treppe und nach der Kirchmauer zugewandt, die nur wenig Licht und Wärme in das kleine Gemach ließ, hatte der Diaconus Brauer sein Arbeitszimmerchen, und hier saß er heute mit dem Hülfslehrer Hennig traulich auf dem Sopha, und Beide studierten die eben durch die Botenfrau aus der Stadt gebrachte Zeitung, in der sie des Neuen wohl viel, des Erquicklichen aber gar wenig fanden.
»Ich wollte, ich wäre jetzt Soldat,« seufzte Hennig endlich, und warf das Blatt unmuthig vor sich nieder auf den Tisch, »in der Welt giebt's nichts als Krieg und Aufruhr, und wir sollen hier indessen den Jungen noch die alte Geduld und Christenliebe einbläuen, während ihre Brüder und Vettern draußen, und ohne beides, in's Feld laufen. Es giebt doch in solcher Zeit nichts Elenderes, als einen Schulmeister.«
»Einen Diaconus vielleicht ausgenommen,« sagte Brauer trocken, und blies eine dichte Wolke blauen Tabacksdampfes in Ringeln gegen den Wachsstock hin, der vor ihm auf dem Tische stand.
Hennig sah ihn verwundert an, schüttelte aber dann mit einem halb gezwungenen Lächeln den Kopf und sagte leise:
»Ihr Geistlichen solltet gerade am wenigsten klagen! Ihr spielt hier, und besonders auf dem Lande, immer die erste Rolle, habt Euer gutes Auskommen und geltet bei den Bauern als was ganz Besonderes. Dazu haltet ihr Sonntags einfach Euere Predigt und geht dann die übrige Zeit blos mit feierlichem Ernst in den Zügen im Dorfe herum – es ist 'was Erhebliches, so ein Geistlicher zu sein.«
»Und gerade bei Ihrem Scherz haben sie den wunden Fleck getroffen,« sagte der Diaconus und strich sich mit der Hand ein paar Mal über die Stirn, als ob er Bahn machen wollte den freien Gedanken, die jetzt von Unmuth und Trübsinn umnachtet und verdüstert wurden, »Ihr haltet Sonntags die Predigt und geht dann die übrige Zeit blos mit feierlichem Ernst in den Zügen im Dorfe herum. Ja, ja, in dem feierlichen Ernst liegt Alles, was ich nur gegen Ihr Lob und Preisen erwidern könnte.«
»In dem feierlichen Ernst?« sagte der Hülfslehrer erstaunt, »nun ich dächte doch, das wäre die geringste Unbequemlichkeit, die eine Stellung mit sich bringen könnte.«
»Sehen Sie, Hennig,« fuhr Brauer, ohne des Freundes Einwurf zu beachten, fort und legte ihm die linke Hand leise auf den Arm, »der ›feierliche Ernst‹, von dem Sie sprachen, und den das Landvolk auch im Allgemeinen von einem Geistlichen erwartet, ja fordert, das ist die Heuchelei des Standes, die mir in der letzten Zeit und seit ich darüber zum klaren Bewußtsein gekommen, am Leben nagt und meinen Frohsinn zerstört, die Heuchelei sich zu geben, wie man nicht ist. Und nicht blos im Dorfe und außer der Kirche, das ließe sich ertragen – wenn es mir auch früher ein bischen schwer angekommen ist, nur weil ich ein Geistlicher war, Tanz und Jugendlust entsagen zu müssen, jetzt denk' ich überdies nicht mehr daran – nein, auf der Kanzel oben, da wo ich manchmal so recht aus dem Herzen heraus den Leuten sagen möchte, wie ich mir den lieben Gott denke, wie ich das Leben und Wesen der Religion empfinde, begreife, fühle, da, da müßt' ich mit dem ›feierlichen Ernst‹ zu Dogmen schwören, die ich im Herzen für Unsinn halten muß, von ewigen Strafen sprechen, wo mir die Brust von ewiger Liebe voll ist, muß Jesus Christus zu einem Gott erniedrigen, während er als Mensch so hoch, so unerreichbar stände. Und der Firlefanz dann, der unseren Stand umgiebt, der Priesterrock, die Krause, der bunte Fastnachtstant auf dem Altar, o Hennig, ich schwör' es Ihnen zu, ich komm' mir immer, wenn ich von dem verzerrten Bild des Gekreuzigten, und von all' den Quälereien der Märtyrer und Heiligen, mit ihren Sinnbildern, den Ochsen und Eseln, umgeben stehe, wie ein Indischer Bramine, Buddhapriester, oder sonst ein fremdländisches Ungethüm vor, und muß mich manchmal ordentlich umsehen, ob es denn auch wirklich wahr ist, daß ich als Christ in der ›allein selig machenden Religion‹ einen solchen Rang bekleide, wie der Bramine und Feuerpriester, wie der Bonze und Fetischmacher, und daß nur der einzige Unterschied in dem Fleckchen Erde liegt, auf das uns das Schicksal gerade zufällig hingeschleudert hat.«
»Nun bitt' ich Sie um Gottes Willen,« rief Hennig verwundert, »was fällt Ihnen denn auf einmal ein? Sie wollen doch nicht etwa unsere christliche Religion mit dem wilden Heidenthum der Brama- und Buddha-Anbeter, oder wie die langarmigen Götzen alle heißen, vergleichen? na, wenn das der Pastor hörte, das Bischen Strafpredigt!«
»Ich weiß es« sagte der Diaconus mürrisch, »und das gerade macht mich so erbittert, daß ich hier etwas gegen meine Ueberzeugung für das vorzüglichste ausgeben soll, was, wenn wir das Nämliche nur mit anderem Namen belegen, und in ein anderes Land versetzen, von uns verlacht und verachtet wird. Unsere Religion ist schön und herrlich, Christi Lehre in ihrer Einfachheit und Größe unübertroffen in der Geschichte, aber weshalb dürfen wir sie dem Volk nun nicht so rein und herrlich geben, wie wir sie von ihm empfangen? warum muß sie erst noch, mit alle dem, was spätere Schreiber und Pfaffen dazugethan, unkenntlich und ungenießbar gemacht werden? Die Schriftgelehrten sagen: was thut das, der Kern ist die Hauptsache, der ist gut und vortrefflich, an den wollen wir uns halten, und das was Schaale ist, weiß man zu sondern; ja, aber der gemeine Mann nimmt die Schaale für den Kern; ihm ist der Firlefanz so lange vorgehalten, bis er ihn für die Hauptsache, und das Andere Alles für Nebensache hält. Ein Löffel Cichorie kann, meinem Geschmack nach, den besten Kaffee ungenießbar machen, und hat man nun gar einen ganzen Topf voll Cichorie, und nur ein paar ächte Bohnen darin, so gehört ein Kenner dazu, das herauszufinden. Der Bauer sieht auch die Kirche in der That mehr als etwas Aeußeres an, und wie sollte er anders, da er von Jugend auf darauf hingewiesen wurde. Er geht nicht hinein, weil ihn Herz und Seele hineinzieht, weil er eben nicht draußen bleiben kann, wie es mich in die Natur, unter Gottes freien, herrlichen Tempel zieht, sondern, weil er sich vor dem Pastor fürchtet, und seinen Namen nicht gern, käme er nach längerer Zeit einmal wieder, von der Kanzel herunter hören möchte. Auch die Gewohnheit trägt viel dazu bei; er sitzt gern am Sonntag Morgen, wo er zu Hause doch nichts anderes anfangen könnte, auf seinem Platz im ›Gotteshaus,‹ aber nicht aufmerksam und gespannt den Worten lauschend – dem Sinn der Predigt folgend, sondern mehr in einer Art Halbschlaf, mit nur theilweis hinlänglich wachem Bewußtsein, um einzelne Worte und Sätze zu verstehen. Nur dann, wenn der Pastor von der Kanzel herab über irgend einen Mißbrauch, oder noch lieber über eine bestimmte, ja am liebsten namhaft gemachte Person, die er nur nicht selbst sein darf, loszieht, nimmt er die schlaffen Sinne zusammen, und schon der Beifall, den er solcher Predigt spendet, wenn er zu Hause kommt, beweist, in welchem Geist er das Ganze aufgefaßt. ›Der hat's en aber heute mal gesagt‹ spricht er, und freut sich dabei über seinen Pastor, wie er so tüchtige ›Haare auf den Zähnen‹ hätte.«
»Aber weshalb sind Sie dann, und wenn Sie so denken, überhaupt Geistlicher geworden?« frug ihn Hennig erstaunt.
»Weshalb?« sagte Brauer, »dieselbe Frage könnte ich Ihnen zurückgeben, denn glauben Sie das Alles selber, was Sie Ihrem Amtseid nach gezwungen sind, den Kindern im Religionsunterricht zu lehren? – nein, aber Sie wissen auch, wie wir im Anfang und von Jugend auf erzogen werden, und wie sich unser Leben fast stets so, daß unser freier Wille nur dem Namen nach dabei in's Spiel kommt, gestaltet und heranbildet. Schon mit der Taufe, unserer ersten Aufnahme in den Bund der Christen, fangen wir an; das schreiende Kind wird mit lauwarmem Wasser begossen, und seine Pathen bestätigen in seinem Namen, wohl häufig selbst ungläubig, den ›festen Glauben‹ des neuen Erdenbürgers. Das aber geht noch an; es ist eine symbolische Handlung, und manche Leute hängen am Formellen; aber nun ist der Junge vierzehn Jahr alt, also in den besten Flegeljahren, hat von einem selbstständigen Gedanken noch keine Idee, plappert nach, was ihm vorgebetet wird, und legt nun auf einmal, mit dem ersten Eid, den er leistet, und wie oft ein Meineid, sein Glaubensbekenntniß ab. Welche Erinnerung bleibt ihm in späteren Jahren von dieser so feierlich gehaltenen Handlung? – daß er sich da zum ersten Mal höchst unbehaglich in einem langschössigen schwarzen Frack gefühlt, und ungeheure Angst gehabt habe, die Oblate bliebe ihm auf der Zunge sitzen – weiter Nichts. Entschließt sich nun der Knabe, nach allen diesen Vorbereitungen dazu, Theologie zu studieren, so begreift er gewöhnlich erst dann so recht aus innerster Tiefe heraus, welchen Stand er gewählt – wenn es zu spät ist. Schritt nach Schritt wird er seinem neuen Berufe näher gezogen, das zweite Examen befestigt ihn endlich unwiderruflich darin, und wenn er sich auch mit Sophismen beschwichtigen und einschläfern will, der Geist in ihm wacht doch und ist lebendig, und raunt ihm Tag und Nacht in's Ohr: einen Priester der Wahrheit willst Du Dich nennen, und zweifelst selber an den Worten, die dir die todte Schrift auf die Lippen legt. –
Aber fort mit den Gedanken, sie quälen uns umsonst, und die Sache bleibt doch wie vorher, die Ketten, die unser Leben fest und unerbittlich umschlossen halten.«
»Sie mögen bei Manchen recht haben« sagte Hennig, und schien ebenfalls plötzlich weit ernster geworden zu sein, – »das hat dann freilich Jeder mit seinem Gewissen auszumachen, was aber das äußere Leben betrifft, so sind die Geistlichen doch unbedingt vor uns Lehrern auf das ungerechteste bevorzugt. Sie bilden auf dem Lande die alleinige Aristokratie, und werden von den Bauern geachtet und geehrt; wie aber steht dies dagegen mit dem Schulmeister? – so ein armes Thier von Dorfschul–«
Ein lautes Pochen am Hausthor unterbrach ihn hier, und der Diaconus, der eben aufgestanden, und ein paar Mal im Zimmer auf und abgegangen war, öffnete seine Thür, ging die Treppe hinab, und schob den Riegel zurück, der den Eingang verschlossen hielt.
»Is der Herr Paster uaben?« frug ihn hier eine vierschrötige Bauerngestalt, die einen derben, etwa elfjährigen Jungen an der Hand, gerade vor dem Eingange stand. Der Mann sah böse und gereizt aus, die Pelzmütze stak ihm seitwärts auf dem struppigen blonden Haar, und mit der linken, breiten, sehnigen Faust hielt er fest des Jungen rechten Arm gepackt, der seinerseits ebenfalls dickverweinten Angesichts und Trotz und Angst in den schmutzig geschwollenen Zügen, mit dem anderen freien Ellbogen die Spuren der letzten Thränen zu verwischen suchte.
»Der Herr Pastor studiert« sagte der Diaconus ruhig, »Ihr wißt wohl, es ist heute Sonnabend, und da läßt er sich nicht gern stören.«
»Ich muß ihn aber emol sprächen« beharrte der Unabweisbare – »'sis von wägen mein Jungen do, den hat mir der Schulmaistr verschlahn.«
»Der Schulmeister?«
»Jo, der Ole – blitzeblau is der Junge auf'm ›Setz Dich druff,‹ un der Rücken hat Striemen, wie meine Finger dick; soll mich der Böse bei Nacht besuche, wenn ich mer mein Jungen verschlahn lasse, wenn er keene Schuld nich hat.«
»Keine Schuld? aber woher wißt Ihr das schon? wird der Schulmeister ein Kind unverdient strafen? Vater Kleinholz ist doch sonst nicht so hart und grausam.«
»Ah was, grausam hin un her!« knurrte der gekränkte Vater, »mein Junge hot mer de ganze Geschichte verzählt, und gor nix hot er gethan, sein Hingermann is es gewäsen, der hot die ganze Suppe verdient, denn des is dem Klausmichel sein Crischan, das Raupenluder, un den hab' ich schon lange uff'm Striche.«
»Aber lieber Freund –«
»Ah, papperlapapp, mit dem Pastor will ich räden, wu is er, der hot noch Zeit gening zum Studieren!« und ohne eine weitere Antwort oder Erlaubniß abzuwarten, schleppte er seinen Jungen, der sich übrigens bei der ganzen Sache nicht wohl zu befinden schien, die Treppe hinauf, bis vor des Pastors Zimmer, klopfte hier rasch an, und trat, ohne selbst das gewöhnliche »Herein« abzuwarten, zu ihm ein.
Der Diaconus ging in seine eigene kleine Stube zurück, wo der Hülfslehrer noch sinnend auf dem Sopha saß, und die beiden hörten jetzt, wie der Bauer mit lauter ärgerlicher Stimme wahrscheinlich das ihm, in seinem Sohne widerfahrene Unrecht dem Pastor klagte.
»Hat denn Kleinholz Meinhardts Gottlieb so geschlagen?« frug der Diaconus den Hülfslehrer endlich, als auch jetzt des Jungen winselnde Stimme, sicherlich erst auf gestrenge Aufforderung, laut wurde, »er soll dicke Striemen haben.«
»Der Meinhardt ist ein böser, durchtriebener Bube« sagte mürrisch der Hülfslehrer, »hätte ich hier zu befehlen, die Range bekäme täglich dreimal Schläge, und das derbe, sonst wird aus dem nichts. Der alte Kleinholz hat aber die Kräfte kaum mehr, Striemen zu schlagen. Wenn er den Bengel übrigens doch gezüchtigt, so muß das schon gestern Nachmittag geschehen sein, denn heute Morgen ist er auf sein Feld hinaus, und ich begreife dann nicht, weshalb der Mann nicht gleich auf frischer That herüber kam.«
Des Pastors Thür ging drüben auf, und Sr. Ehrwürden rief heraus:
»Herr Diaconus – Herr Diaconus!«
»Herr Pastor?« sagte der Gerufene, und trat in die Thür.
»Bitte, bestellen Sie doch einmal, daß der Schulmeister herübergerufen werde – er soll aber den Augenblick kommen! Hören Sie?«
Der Diaconus, gerade nicht in der Laune sehr bereitwillig zu sein, brummte eine Art Antwort, schickte unten aus dem Haus das Mädchen nach der Schule hinüber, und kehrte in sein Zimmer zurück, der Hülfslehrer hatte dieses aber indessen verlassen, und war in das Dorf hinunter gegangen.
Etwa zehn Minuten mochten so verflossen sein, als der langsame Schritt des alten Keilholz auf der Treppe gehört wurde, und dieser gleich darauf leise und ehrfurchtsvoll an die Thüre des Herrn Pastors anklopfte. Drinnen die Leute waren aber im eifrigen Gespräch, und hörten nicht, wie der ängstliche Finger des Greises die Thüre berührte, dem geistlichen Herrn mochte aber indessen die Zeit zu lange dauern, der Bauer mit seinem Salbader hatte ihn so zu höchst unwillkommener Stunde in seinem Studium gestört, und rasch und ungeduldig, riß er die Thüre plötzlich auf, so daß er im nächsten Augenblick vor der eben zum Klopfen wieder niedergebeugten und jetzt ängstlich zurückfahrenden Gestalt des greisen Schullehrers stand.
»Halloh Herr, horchen Sie?« frug er scharf und überrascht.
»Bitte – bitte tau – tausendmal um Verzeihung,« stotterte, blutroth vor Schaam über die ungerechte Beschuldigung, der also Angeredete – »ich hatte schon zweimal angeklopft, aber der Herr Pastor –«
»Schon gut, Schulmeister,« fiel ihm der Seelsorger mit Autorität in's Wort, »kommt einmal auf ein paar Minuten herein – bringt nur Euren Hut mit – Schulmeister –« und er zog dabei die Thür hinter dem, durch die ernste Anrede etwas erschreckten kleinen Mann zu. – »Schulmeister, Meinhardt hier beklagt sich, daß Ihr seinen Jungen so unbarmherzig geschlagen haben sollt.«
»Die Striamen werd mer der Junge vier Wochen mit 'rim tragen,« fiel ihm der Bauer heftig in die Rede –
»Herr Pastor« sagte aber Kleinholz, der jetzt wohl merkte, um was es sich handele, »der Gottlieb hat eine kleine Strafe verdient gehabt, und meine Hand ist nicht mehr so schwer, daß sie einem Kinde Schaden zufügen könnte; von Striemen kann da wohl keine Rede sein.«
»Keine Rede sein?« rief der Bauer, »Gottlieb, gleich noch emol mit der Jacke ringer – keene Striemen nich – so? – ei da –«
Der erzürnte Vater legte schon selbst mit Hand an, die geläugnete Thatsache durch das corpus delicti, den geprügelten Körpertheil, zu Tage zu fördern, der Pastor unterbrach ihn aber darin, faßte ihn am Arme, und bat ihn, die Sache ruhen zu lassen, und jetzt still nach Hause zu gehen, er wolle schon mit dem Schulmeister sprechen, »es solle nicht wieder geschehen!«
Der Bauer wollte noch Einiges bemerken, kam aber nicht mehr zu Wort, und verließ bald darauf, den verdrossenen Jungen, wie bei der Ankunft, hinter sich herschleppend, das Zimmer. Draußen aber blieb er stehen, und die Unterredung im Innern wurde, wenigstens von der einen Seite, so laut geführt, daß er deutlich jedes Wort verstehen konnte.
»Schulmeister, Ihr dürft mir die Kinder nicht so mishandeln!« sagte die gereizte Stimme des geistlichen Herrn, »es sind schon mehrfach Klagen eingelaufen, und ich habe denn doch wahrhaftig keine Zeit, mich mit solchen Sachen fortwährend aufzuhalten; die halbe Nacht sitz' ich und arbeite, und muß mich jetzt wegen Euch und Eures unverzeihlichen Betragens wegen, mitten aus meinen Studien herausreißen.«
Es entstand hier eine kleine Pause, und wahrscheinlich erwiederte der Schulmeister etwas, denn der Pastor fiel gleich darauf, und mit fast noch größerer Hitze wieder ein:
»Schulmeister, macht mit Leugnen Euer Vergehen nicht noch schlimmer; ich habe den Rücken des Jungen selbst gesehen, und von drei leichten Streichen kriegt so ein derber Bengel nicht fünf oder sechs Schwielen über die Schultern – schon gut, schon gut, ich habe mehr zu thun, als mich mit Euch hier herum zu streiten – ich bin fest überzeugt, es geschieht mir nicht wieder, oder – ich müßte mich genöthigt sehen, ernstere Maaßregeln zu ergreifen – guten Morgen, Schulmeister, guten Morgen, die Sache ist für heute abgemacht.«
Das Geräusch drinn in der Stube ließ darauf schließen, daß die Unterredung beendet sei, und der Bauer, der doch nicht gern beim Horchen ertappt werden wollte, zog sich rasch nach der Treppe zurück, war aber nicht im Stande sie zu erreichen, ehe Kleinholz heraustrat. Dieser begriff leicht, daß der Mann alles in des Pastors Zimmer Verhandelte, gehört haben mußte, und ein tiefes Roth färbte für einen Augenblick seine Wangen, aber er sagte Nichts, und wollte grüßend an dem Bauer vorüber gehen, Meinhardt gab ihm fast unwillkührlich Raum, als er aber dicht bei ihm war, und er das bleiche abgemagerte Gesicht, und die Schaamröthe auf den fahlen Zügen sah, da fing er selbst an, sich bis in die Seele hinein zu schämen.
Er nahm den Schulmeister, trotz dem daß sich dieser leise dem Griffe zu entziehen suchte, fest bei der Hand, führte ihn die Treppe hinunter, und blieb dort einen Augenblick, wie um einen Anfang verlegen stehen. Endlich, da er das, was ihm eigentlich auf dem Herzen lag, gar nicht recht ausdrücken und zu Tage bringen konnte, ja vielleicht auch fühlte, daß mit Worten, die ihm selten zu Gebote standen, unverhältnißmäßig schwieriger sein würde, als durch die That selber, drehte er sich urplötzlich, und um diesem, ihm fatal werdenden Zustand ein Ende zu machen, nach seinem Jungen um, gab dem auf's Aeußerste Erstaunten links und rechts ein paar tüchtige Ohrfeigen, daß der sich schreiend und zurückprallend mit beiden Händen den mißhandelten Schädel hielt, und rief, indem er noch zum dritten Mal ausholte, was Gottlieb aber gar nicht abzuwarten gedachte, hinter dem jetzt sporenstreichs dem Thor zuspringenden Jungen her:
»Da, Du Kriate Du, Du bist auch su en nixnutziger Bengel, där seinen Lehrer de Galle in eine furt im Ufruhr hält – kumm mer wieder mit Striamen uf'm Hintern haim, un ich mach' der de Quärstriche driber, daß der der ›Setz Dich druff‹ wie'n Damenbrät aussähn sull.«
Jetzt, wo seiner Ansicht nach der Schulmeister eine glänzende Genugthuung erhalten hatte, wandte er sich noch einmal zu diesem, drückte ihm die Hand und sagte lächelnd:
»Där märkt sich's, Schulmeister – Dunnerwätter! was mer seine Noth mit den Kingern hat.«
Und damit schlug er sich den Hut fest in die Stirn, und verließ mit vieler Selbstzufriedenheit rasch, – wenn auch nicht so rasch wie sein ihm vorangegangener Sohn – die Pfarre.