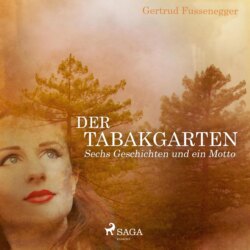Читать книгу Der Tabakgarten - Sechs Geschichten und ein Motto - Gertrud Fussenegger - Страница 5
Der General oder Weisse fahnen
ОглавлениеWir kannten ihn längst schon vom Sehen, denn wir begegneten ihm oft, wenn wir abends nach Hause gingen: da kam der kleine, schlanke silberhaarige Herr die Allee unseres Vorstadtviertels herabgeschritten, und seinem knappen, festen und dabei fast zierlichen Gang schien es nur noch am Geläut der Sporen zu fehlen, so leicht war der Mann als ehemaliger Offizier zu erkennen. Mit ihm lief ein weißer Spitz, ein Ausbund an Übermut, danach zu schließen, wie er den Weg hinauf- und hinabschoß, unter Büschen stöberte und in Gärten hineinbellte. Sein Herr ließ ihn geduldig gewähren. Nur manchmal blieb er stehen und pfiff, und dann bemerkten wir nicht ohne eine gewisse Belustigung, daß sich das fröhliche Tier keineswegs gleich stören ließ und sich erst auf den zweiten oder dritten Pfiff – immer noch zögernd – entschloß, endlich zu gehorchen.
Später erfuhren wir, daß der Herr unser Nachbar geworden war. Unserem Grundstück gegenüber, aber höher gelegen, stand das Ungetüm einer älteren Villa von wahrhaft raubritterburgmäßigem Aussehen. In diese war der Herr mit seinem Spitzchen eingezogen. Er war im ersten Weltkrieg Oberst geworden, wir aber nannten ihn unter uns den „General“. Dabei blieb es, auch als wir seine wirkliche Charge kannten und selbst, nachdem wir in ein freundnachbarliches Verhältnis zu ihm und den Seinen getreten waren.
Die Villa, in der er wohnte, fiel in unserem Stadtviertel weithin auf. Während sich unser Haus – neben vielen anderen ähnlichen – bescheiden in das Gelände duckte, ragte jenes, mit Zinnen und Erkern bestückt, zu einem luftigen Türmchen auf, dessen grünspanige Kupfermütze über das ganze Tal leuchtete. Unter dieser Kupfermütze, so erzählte man uns, habe sich der alte Herr eine Art Hauptquartier eingerichtet. Da sei ein sechseckiges Stübchen, von sechs hohen, schmalen zugigen Fenstern durchlüftet, mit militärischen Erinnerungsstücken angefüllt und mit einer Sammlung alter und neuer Generalstabskarten gleichsam austapeziert. In den Karten, hieß es, steckten Fähnchen aus verschiedenfarbigem Papier, die Fähnchen stellten Armeen und Divisionen dar. Der alte Herr liebe es, mittels dieser Wimpelchen Schlachten und Feldzüge nachzuziehen. So spiele er, unausrottbaren Gewohnheiten aus seiner Dienstzeit treu geblieben, wohl täglich stundenlang – wie ein Knabe mit seinen Zinnsoldaten oder wie ein Schachspieler, der sich, allein über sein Brett gebeugt, um das Geheimnis der Meisterpartien bemüht –, spiele Züge und Gegenzüge längst vollzogener Schicksalsentscheidungen auf seinen papierenen Schlachtfeldern nach. Das kam uns rührend und damals, in freundlicher Friedenszeit, auch ein wenig lächerlich vor. Jedesmal, wenn wir spätnachts die schartenartig schmalen Fenster des Türmchens erleuchtet sahen, nickten wir einander zu und sagten, als wüßten wir wirklich Bescheid: „Aha, der General steckt heute wieder seine Fähnchen.“
Doch es kam eine Zeit – wir alle wissen, wie sie kam –, da schien es uns nicht mehr lächerlich, über Landkarten zu grübeln und kriegerische Wechselfälle zu verfolgen. Wenn wir vielleicht auch keine Fähnchen steckten, so waren uns doch ferne Städte und Ströme, Landschaften, deren Namen uns vorher kaum jemals zu Ohren gekommen, zu Punkten eigener unausweichlicher Lebensentscheidungen geworden. Überall, in allen Richtungen der Windrose, war der Krieg im Gange. Über Länder und Meere zog er sich, überallhin waren Gatten, Brüder, Söhne und Freunde eingerückt, überall war geliebtes Leben in Siege oder Niederlagen verstrickt. So begann jeder von uns in bangem Herzensdrange eine Art allerdings meist höchst dilettantischer Strategie zu treiben. Da waren die seltsamsten Theorien, die waghalsigsten Spekulationen im Schwange; an einem Tag schien alles möglich und leicht zu bewältigen; am anderen erschrak man vor der Ungeheuerlichkeit der Anforderungen und empfand, in dunklen Gefühlen erschauernd, den von Stunde zu Stunde sich türmenden Wahnwitz unserer Lage.
Jetzt lächelten wir nicht mehr, wenn wir das nächtliche Licht im Turm des Generals durch die Verdunkelung hervorschummern sahen. Wir wären vielmehr begierig gewesen, mit dem fremden Herrn in ein Gespräch zu kommen und seine, wie wir annahmen, fachmännische Meinung über unsere Aussichten zu erforschen. Doch waren wir schon in das zweite oder dritte Kriegsjahr gelangt, ehe sich die Gelegenheit ergab und wir mit ihm bekannt wurden. Es war damals, als wir zu gemeinsamen Luftschutzübungen einberufen wurden.
Wie zu anderen Zeiten lerneifrigen Leuten Literatur oder Kurzschrift in abendlichen Lektionen beigebracht werden, so sollte uns damals gelehrt werden, uns gegen die drohende Gefahr aus der Luft zu wappnen. Wir lernten – eine traurige Wissenschaft – Bomben und Minen unterscheiden, lernten aus dem Heulen der Geschosse darauf schließen, ob sie über unseren Köpfen oder über denen unserer Nachbarn niedergehen würden. Wir lernten die Gefährlichkeit der Phosphorgüsse einschätzen, lernten Brände bekämpfen, nasse Besen schwingen gegen Funkenflug und auf allen vieren durch raucherfüllte Räume kriechen. Freilich waren, man muß wohl sagen zum Glück, weder Rauch noch Feuer bei der Hand, und der Unterricht blieb in dieser Hinsicht rein theoretisch. Trotzdem wurden uns die Übungen unnachsichtlich abverlangt. Auch der General hielt dabei nicht zurück. Ich bewunderte ihn oft, mit welcher gelassenen Heiterkeit er es sich auferlegte, die Befehle des Lehrers auszuführen, Sandsäcke über imaginäre Flammen zu schütten und mit der Feuerpatsche draufloszuschlagen.
Ich lernte ihn als einen seelenguten Menschen kennen. Er legte mit Hand an, wo er konnte, er schonte sich nie und war immer bereit, von zweien die schwerere Last zu tragen. Doch nie gelang es uns, ihn zu einem Gespräch über den Krieg zu bewegen. Viel später erst ging mir auf, was den alten Mann davon abgehalten haben mochte: es war nämlich nach einem rasch aufflammenden und dann verschwelenden Siegestaumel nachgerade zur Mode geworden, den Krieg gesprächsweise unter Freunden und besonders, wenn der Wein die Zungen gelöst hatte, ohnehin verloren zu geben. Zur gleichen Zeit standen Millionen an den Fronten, opferten Hunderttausende ihr Leben. Dieser zerstörerische Widerspruch mochte dem General den Mund verschlossen haben. Nur einmal offenbarte er sich mir, das erstemal, daß ich ihn in seinem Turmzimmer oder, wie er es nannte, in der Hohen Stube besuchte.
Es war im Herbst des Jahres 1942. Ich hatte einen Brief aus dem Ausland erhalten, einen Brief, der, Gott weiß wie, durch die Zensur geschlüpft war und etliche, wie mir damals vorkam, alarmierende Bemerkungen über die allgemeine Lage enthielt. Ich konnte mich nicht enthalten, mit diesem Brief zu unserem Nachbarn zu laufen. In der Wohnung traf ich den General nicht an, so erklomm ich die Wendeltreppe und klopfte droben.
Der General öffnete: er war in Hut und Winterrock. So saß er hier in dem ungeheizten Raum und studierte seine Karten. Richtig, da hing, wie man uns gesagt hatte, Karte neben Karte an Wänden und Türen, in manchen steckten bunte Fähnchen. Ich blieb vor dem Blatt Rußlands stehen; diese Karte war es, die unseren Blick in jenen Jahren wie ein Menetekel anzog.
Der General hatte den Brief genommen und gelesen. Langsam faltete er ihn zusammen und schob ihn in den Umschlag zurück. Ich sah ihn fragend an: der alte Mann sah elend aus, seine Wangen waren eingefallen, seine Augen rotgerändert. Es war die Zeit, in der unsere vorgeschobenen Armeen Stalingrad berannten, da in der obersten Führung Unsicherheit und Verwirrung um sich griff und, schlimmer noch, auch erste Nachrichten sinnloser Greuel durchsickerten, die die Unseren unter den unterworfenen Völkern verübt haben sollten. Was würde der alte Soldat zu alledem zu sagen haben? Ein schwerer Atemzug hob seine Brust. Jetzt, dachte ich, wird er reden.
Aber er schwieg. Dann, nachdem er mir mit gramvollem Nicken den Brief zurückgegeben, fragte er mich nur, ob ich auf den Balkon seiner Turmstube treten wollte, man habe hier eine weite Rundsicht.
Der Balkon lief auf einem schmalen Mauervorsprung rund um den Hals des Turmes. Wir traten hinaus: In der Tat, weit reichte der Blick von hier über Gärten und Dächer, über das rötlichbraune Mauergeschiebe der Altstadt, über die jenseits des Flusses ansteigenden Hügel bis zum fernen, von Wolken umgürteten Gebirge. Da reihten sich Gipfel den ganzen südlichen Horizont entlang, schiefe, mit Schnee bedeckte Flächen über rauchende Abgründe, und wo der grauwolkige Himmel auseinanderklaffte, war die wildgezackte Linienschrift der fernsten Grate in ein Stück eisigklares Blau groß und überdeutlich eingerissen.
Da standen wir nun, es war kalt, der Wind zerrte an unseren Kleidern, tief unter uns trieb in dunklen Schwärmen das verrottende Herbstlaub.
Endlich sagte der General: „Spüren Sie, wie der Winter kommt? Ein früher Winter, ein harter Winter.“
Dann schwieg er wieder. Ich hatte ihn begriffen.
Ein Jahr darauf.
Es war wieder Herbst, aber ein Herbst ganz anderer Art als der vergangene; dieser hatte uns gleichsam die Zähne gezeigt mit dem Einbruch früher Fröste und vorzeitigen Schneefalls. Jener war nach einem wasserlosen, dörrenden Sommer schwül und still. Nacht für Nacht fielen des Gegners Schläge auf uns nieder. So war es wieder einmal, als gegen Mitternacht jemand an unsere Tür pochte und rief: Der Rundfunk melde einen starken Verband im Anflug. Gleich darauf heulten die Sirenen. Es waren indessen noch nicht einmal fünf Minuten vergangen, als der Luftraum, der undurchdringlich schwarz und sternenlos über uns hing, vom Surren der Motoren zu erzittern begann.
Wir jungen Leute blieben nicht in den Kellern. Wir hatten zwar Kinder und Greise und auch ein wenig Gepäck hinuntergeschafft, doch litt es uns nicht, drunten zu sitzen. Wir stahlen uns hinaus in die grollende Nacht.
Es mußte ein großer Verband sein, es mußten Ketten von Verbänden sein, die da geschart und gesammelt über uns hinweg ihrem Ziel entgegenflogen. Das Ziel konnte nicht zweifelhaft sein.
Dort, im Nordosten, lag die große, von uns allen geliebte Stadt; dort wohnten unzählige uns teure Menschen, dort ragten Kirchen und ehrwürdige Baudenkmäler, schlummerten Stätten innigen Erinnerns und heiliger Herzenserhebung. Es klirrte in uns vor Grauen: das alles sollte heute vernichtet werden.
Ich war aus dem Garten auf die Straße gelaufen. Da hörte ich Stimmen aus der Höhe, von des Generals Aussichtsturm. Ich rief hinauf, ob ich kommen dürfe. Sie riefen herunter: „Kommen Sie!“ In dem Augenblick, als ich droben die Stube betrat, begann drüben der Angriff.
Es blitzte. Man vernahm etwas wie einen Donnerschlag, dann folgte Blitz auf Blitz, unaufhörlich, als flammten enggereihte Böller nacheinander auf. Die einzelnen Detonationen gingen in ein allgemeines Rollen über. Man spürte die Erschütterungen der Schichten aus den Fundamenten heraufzittern.
„Es ist ein großer Angriff“, hörte ich den General sagen. „Neue Verbände sind im Anflug.“ Und nach einer Weile mit dem Ausdruck knirschender Erbitterung: „Immer noch, immer noch –.“
Wirklich erdröhnte die Luft nach wie vor von dem Geräusch der anfliegenden Maschinen. Sie kamen aus dem Südwesten herauf, überflogen uns, zogen gegen Nordosten hinüber. Länder und Erdteile, ja Räume des Kosmos schienen ihre Vernichtungsgeister gegen uns losgelassen zu haben.
Die Nacht war diesig, das Flammen der Explosionen von mäßiger Helle. Da aber trat eine neue Erscheinung in das grausige Schauspiel: um ihre Ziele zu erleuchten, setzten die feindlichen Flugzeuge Lichter ab, da eine Kette von Kugeln, dort einen tropfenden Schirm aus violettem Glanz, dann wieder einen aus unsichtbaren Düsen sprühenden Leuchtstrahl von bleichem Grün. Taghelle ging von ihnen aus, die da im Luftraum hingen, teuflische Lichtgespenster, die die Ziele des Schreckens visierten. Und schon barst es drüben von neuen und heftigeren Explosionen, als sollte die ganze Stadt zunichte gemacht, um und um gepflügt und weggefegt werden.
Eine Weile war nichts als dieses schauerliche Stampfen und Malmen. Die beiden Alten, der General und seine Frau, schienen mich längst vergessen zu haben. Sie standen auf dem gebrechlichen Altan, einander eng umschlingend, an das Geländer gepreßt. Zuerst hatten sie abwechselnd durch ein Fernglas geblickt, jetzt hoben sie es nicht mehr vor die Augen. Die Frau verhüllte ihr Gesicht, an die Brust des Mannes verkrochen, weinte sie leise: „Mach ein Ende, o Gott, ein Ende!“ – Der Mann aber stand stumm, mit zur Faust geballter Rechten. Ingrimm, Grauen, Verzweiflung mochten sein Herz durchtoben, unhörbare Schreie der Rache, Flüche und Vermaledeiungen. So stand er, wie ein Kapitän auf der Kommandobrücke seines sinkenden Schiffes steht, stumm, weil ohnmächtig gegen das Wüten der Elemente; das sinkende Schiff, das war seine Welt, und der Ozean – die Zeit der totalen Vernichtung.
Einmal ging etwas Überschweres in unserer Nähe nieder. Der Luftdruck brandete gegen die Mauern, der Turm wankte unter einem gewaltigen Stoß. Die Generalin schrie laut. Drunten in der Dunkelheit des Gartens sah man den weißen Schatten des Spitzes einen Satz über die Flanke tun und in ein Loch verschwinden.
Endlich wurde es drüben gelinder. Einzeln nur noch, nicht mehr in Ketten und Teppichen flammten die Bomben, schollen die Donnerschläge. Mit triumphierendem Brausen lenkten die fliegenden Festungen über unsere Landschaft westwärts davon.
Dort, wo es geschehen war, wurde es still. Das feurige Licht der einzelnen Brandherde verschmolz mit dem aufziehenden Nebel zu einer einzigen Lache fahlroter Dämmerung. Es wurde Entwarnung gegeben. Die beiden alten Leute wankten, wie von einer Todeskrankheit entstellt, an mir vorbei die Treppe hinab.
Wenige Tage danach erhielten sie die Nachricht, daß ihr Sohn, der einzige, den sie besessen, an der süditalienischen Küste von einer Granate zerrissen worden sei.
Man erfuhr nicht, wie die beiden alten Leute den Schlag hinnahmen. Aber es fiel auf, daß sie fast sogleich danach ihre geräumige Wohnung im ersten Stock der Villa verließen und sich, wie geblendete Vögel in ein äußerstes Versteck, in das sechseckige Turmgemach zurückzogen. Fremde Flüchtlinge zogen in die unteren Räume ein. Vergeblich versuchten wir, dem Paar einen Beileidsbesuch abzustatten. Wir fanden die Tür verschlossen.
Fast zwei Jahre noch währte der Krieg. Er bestand, wie wir wissen, für die deutschen Armeen nur mehr aus Rückzügen und in jenen noch fürchterlicheren, weil dem Wesen nach sinnlosen Versuchen, irgendwelche abgeschnittene, von feindlichen Übermächten umzingelte Stellungen zu halten. Wo unseren Truppen Bundesgenossen zur Seite gestanden, fanden sie sich über Nacht verlassen und neuen Feinden ausgesetzt. Manchmal wunderten wir uns, daß eine verbündete Welt dieses Kartenhaus wankender und stürzender Fronten nicht schneller zu durchbrechen, nicht rascher zusammenzuschlagen vermochte. Längst waren der General und seine Frau nicht mehr das einzige Ehepaar in unserer Straße, dem der einzige Sohn vor dem Feind geblieben. Ganze Familien, die einst reich geblüht hatten in vielen Gliedern, wurden ausgerottet, und die letzten Überlebenden, Frauen und Kinder, in Ausweichlagern und zweifelhaften Refugien zerstreut. Ganz Deutschland war allmählich in ein Schlachthaus verwandelt worden, in dem wir wie Tiere darauf warteten, durch Bomben oder durch einbrechende Gegner im Nacken getroffen und hingemetzelt zu werden. Wir alle waren in die Lage von Selbstmördern gebracht. Friede war ein Begriff, der über unsere Begriffe ging, und so sehr waren wir an Vorstellungen des Untergangs gewöhnt, so sehr waren wir dazu erzogen worden, das Dasein unter Aspekten der Vernichtung zu sehen, daß es uns dann und wann ganz sonderbar anmutete, wenn wir uns sagten: Aber die Berge werden stehen bleiben, Frühlinge werden auch später noch blühen und Sommer ihre Ernten zur Reife bringen. – An unsere und unserer Kinder Zukunft zu denken wagten wir nicht. Eine Phiole Gift, eine scharfe Klinge hielten viele von uns als Pfänder letzter Freiheit nun für kostbarer als Gold und Edelsteine. Wie töricht wir waren! Nicht nur die Berge überstanden, nicht nur der Kreislauf der Natur, Blüte, Gedeih und Reife, wir alle, die noch leben, das Leben selbst überstand, der heimliche Herzschlag des Daseins, das Zarte und Süße sogar, und, wer weiß, vielleicht hatte ein verborgener weiser Sinn längst schon, während noch die Parolen der Vernichtung galten, mit vorsichtig tastenden Kräften die ersten Versuche zur Wiederherstellung des Lebens begonnen.
Eines Tages erfuhren wir, daß dem General und seiner Frau eines jener armen Kinder ins Haus gebracht worden war, die auf der Flucht ihre Eltern verloren hatten und irgendwo auf der Straße, auf Bahnhöfen oder freiem Feld aufgegriffen und der Barmherzigkeit des Nächstbesten empfohlen wurden. Kurz vor dem Einmarsch der fremden Truppen in unsere Stadt schickte die Generalin nach mir, ich möchte zu ihr kommen.
Eilig ging ich hinüber. Wie verändert fand ich den Raum, den wir einstmals nicht ohne spöttischen Beiklang des Generals Hauptquartier genannt hatten. Zwar hingen noch Karten und Pläne an den Wänden, aber dazwischen hatte das Leben ein fliegendes Quartier aufgeschlagen: ein kleiner Herd war gesetzt, Küchengeschirr stand auf Bücherschränken gestapelt, und in einem Bett lag, sorglich in Decken gerollt, das fremde Findelkind.
Die Generalin eilte mir entgegen: „Gottlob, daß Sie da sind. Stehen Sie mir bei! Man erzählt, daß alle Häuser geplündert werden, in denen militärische Dinge gefunden werden, und Sie sehen: Hier ist alles voll davon! Ich habe es meinem Mann schon gesagt, daß wir die Karten abnehmen und die Bücher verbrennen müssen, er aber tut, als höre er nicht. Er spricht kein Wort seit Tagen schon, und ich – ich fürchte mich allein zu handeln. Wenn ich aber sage, daß Sie hier gewesen sind – –.“
„Ja“, antwortete ich, „machen wir rasch. Wir werden gleich abgeräumt haben.“
Ich rückte einen Stuhl an die Wand und begann die erstbeste Karte abzuhängen. In Nu war es ringsum kahl. Auch die Bilder mußten weichen, Ehrendegen, Orden, Bücher und Karten – alles sollte in einem finsteren Winkel des Dachgeschosses verborgen werden.
Da klappte unten die Haustür, die Generalin erblaßte: „Da ist er schon.“ Aber es war der General noch nicht. Es war eine Frau aus der Nachbarschaft, eine heftige, immer aufgeregte fahrige Person, von der wir wenig Gutes erfahren hatten die ganze Zeit. – „Was ist?“ schrie sie uns an. „Wird hier endlich die weiße Fahne gehißt?“ –
„Die weiße Fahne?“ fragte die Generalin zurück. –
„Ja freilich, was denn sonst? Die Amerikaner schießen immer noch. Glauben Sie, wir wollen uns die Bude zusammendreschen lassen im letzten Augenblick?“
„Es steht Ihnen frei, das ganze Haus zu beflaggen“, sagte ich. „Doch warum soll denn gerade hier –?“
Die Frau funkelte mich zornig an. „Weil hier der höchste Punkt ist weit und breit.“ –
„Da haben Sie recht“, sagte ich, „in mehr als einer Hinsicht recht. Dennoch werden wir nicht tun, was Sie verlangen. Aus allen Fenstern können weiße Fahnen wehen, aus diesen nicht.“ –
Damit schlug ich der Verdutzten die Tür vor der Nase zu. Jetzt war ich mit der Generalin wieder allein. Ich sah die alte Frau erzittern. Ein Schluchzen würgte uns, das Elend unserer Lage, die Ohnmacht und Entwürdigung unseres Volkes kamen uns mit einem Schlag ganz zu Bewußtsein. Unwillkürlich schlossen wir einander in die Arme und verharrten, das Weinen niederkämpfend, eine Weile stumm aneinandergedrängt. Dann aber riß ich mich los, es mußte sein –.
In einem finsteren Winkel, zwischen Gerümpel und zerschlagenen Ziegeln begruben wir Orden und Bilder unter Sand, wir breiteten Lumpen über Bücher und Karten. Das alles mußte nun in Nacht versinken, mußte verborgen sein wie gemeines Diebesgut, wie Dinge der Schande und Schmählichkeit. Staub und Spinnweben sollten darüber fallen, Vergessenheit es verschütten. Wie aber, das fragten wir uns in unseren Herzen, sollten jene weiterleben, denen das alles Ehre und Pflicht, Form und Richtung gewesen war?
Wir kehrten in das zerstörte Zimmer zurück. Kahl starrten uns die Wände an, öde klafften die Regale, leer lag der Raum, in dem eben erst die Zeichenbilder ungeheurer Taten und Entscheidungen – wie Konstellationen in einem Planetarium – versammelt gewesen waren. Welch eine Welt! Und was war von ihr übrig? Die Wundmale der Nägel, die Risse im weißen Bewurf, staubige Konturen, Schimmel, Befleckung.
Allmählich senkte sich der Tag. In der Ferne grollten die Geschütze. Sorge und Furcht wollten uns Frauen überwältigen. Hatten die Nachbarn an ihren Häusern schon die weißen Fahnen gehißt? Hatten wir uns von ihnen unserer Säumigkeit willen eines Angriffes zu versehen? Und wo blieb er, der General? Nun reute es uns, daß wir die Besucherin so starrsinnig abgewiesen. Sollten wir nicht doch etwa einen weißen Wimpel aus dem Turm stecken? „Ich wage es nicht“, sagte die Generalin. „Wenn mein Mann nach Hause kommt und es sieht – nein, ich wage es nicht.“
Aber da, während wir noch sprachen und uns berieten, war über uns auf dem Boden ein Geräusch zu vernehmen. In der Turmstube tappte ein Schritt, eine Angel kreischte, als würde dort oben eine Luke mühselig aufgezwängt. Und dann sahen wir, daß ein Schatten an einem der Fenster abwärts wehte, etwas geisterhaft Bleiches wie ein plötzlicher Hagelschauer, ein weißes, sich auseinanderrollendes Tuch. Der Wind ergriff es, warf es klatschend gegen Altan und Scheiben –: es war die weiße Fahne, die Fahne der neuen Zeit, die Frieden bot und Schonung anrief für dieses Haus, für die Häuser ringsum, für dieses ganz arme, abgeschlachtete und ausgeblutete Land.
Der General selbst hatte die Fahne gehißt. In diesem Augenblick war das Kind erwacht. Es saß aufrecht im Bett, seine Augen glänzten.
Was mir noch zu erzählen bleibt, reicht bis in das späte Jahr siebenundvierzig, denn kurz vor der neuen Jahreswende starb der alte Mann, und seine Frau blieb danach nicht mehr lange in unserer Stadt, sondern zog mit dem fremden, für eigen angenommenen Kinde in ihre Heimat im Norden, ich hörte nichts mehr von ihnen.
Aber in den beiden Jahren nach Kriegsende sollte mir, was den General betraf, noch manche Belehrung zuteil werden in der Richtung der Dinge, von denen ich eben sprach: daß sich das Leben wiederherstellte, daß nach der Zeit des umfassenden Vernichtungswillens die Zeit der umfassenden Lebensrettung anbrach, des bedingungslosen, ja, verzweifelt zu nennenden Versuchs, zu erhalten, was überstanden hatte, zu schützen, was übriggeblieben, aufzurichten, was dem Beinahe-Nichts abzuringen war.
Es begann nun, wie wir alle wissen, die eigentliche Hungerzeit für das städtische Volk. Von Tag zu Tag machte sich der Mangel an Nahrung schrecklicher fühlbar, und was vorher kaum oder doch nur vereinzelt geschehen war, das geschah nun massenweise: die Hungernden zogen aus, um auf dem Lande Eßbares aufzutreiben. Als habe in dem städtischen Volk ein Nomadentum geschlummert und rühre sich nun mit unwiderstehlicher Kraft, so trieb es nun alles, was sonst zähe im städtischen Bereich geklebt, auf kleinen Fahrzeugen oder zu Fuß oder in berstend überfüllten Zügen hinaus aufs Land. Kein Weg schien zu weit, kein Fehlschlag zu entmutigend, keine Demütigung zu ätzend: mit dem ersten Morgenlicht fielen die frühesten auf dem flachen Lande ein, in der hereinbrechenden Nacht waren die letzten noch unterwegs. In den seltsamsten scheuchenhaften Aufzügen sah man die Leute wandern, ausgemergelte Frauen in umgeschneiderten Militärmänteln, Männer in uralten Windblusen, so zogen sie einher, alle bepackt mit Zöggern, Kannen und Rucksäcken, ja, der Rucksack war so recht zum Wahrzeichen ihrer Gilde, ihres Standes geworden.
Auch den General sah ich eines Tages mit dem Rucksack wandern. Der Anblick kam mir so unerwartet, daß ich meinen Augen zuerst nicht trauen wollte. Aber das Spitzchen, das ihn immer noch begleitete, wies ihn aus: es konnte kein Zweifel sein, die kleine hagere Gestalt, die unter dem Gewicht des Rucksackes dahinstapfte, war der General. Noch manches Mal begegnete ich ihm so: wenn er frühmorgens auszog, wenn er abends heimkehrte, auch, wenn ich selbst auf Hamsterfahrt war. Einmal traf ich ihn mitten im Wald, wo er unvermutet aus einer Schneise trat und mich zu einem von ihm entdeckten Erdbeerplatz heraufwinkte; ein anderes Mal in grauer peitschender Winternacht auf einem zugigen Bahnhof, wo er mit vielen anderen den verspäteten Zug erwartete, ein drittes und letztes Mal hoch über mir auf einem schmalen Pfad an einer steilen Berglehne, eine unscheinbare, kleine graue, sich unermüdlich mühende Figur.
Die Gemeinschaft, für die er zu sorgen hatte, war indessen auch zu einem unerwartet ansehnlichen Häuflein angewachsen. Zu dem ersten Findelkind hatte sich ein zweites gesellt, ein kleines Mädchen, dessen Mutter krank im Osten lag; eine greise Base, Flüchtling aus Schlesien, hatte um Obdach angesprochen; ein kriegsversehrter Neffe war aufgetaucht. So hatte der Alte gar viele Mäuler zu stopfen, und es war zu sehen, daß er sich dabei übernahm. Immer, wenn ich ihn traf, erschrak ich von neuem über sein Aussehen. Sein Gesich ward hohl, seine Gestalt krümmte sich, seine Natur und seine Kraft unterlagen.
Im dritten Winter verfiel er in eine schwere Krankheit. Die Generalin schickte zu uns um Hilfe. Meine Schwester, die Pflegerin, erbot sich, eine Nacht bei dem Kranken zu wachen.
Gegen Mitternacht machte ich mich leise auf, um nachzusehen, wie es dem Kranken und wie es meiner Schwester bei der Pflege erging. Auf Zehenspitzen betrat ich das Turmgemach. Da war es noch einmal verwandelt – zu einem Krankenzimmer, zu einem Sterbezimmer, mußte ich denken, als ich einen Blick in des alten Mannes Gesicht getan. Er lag nicht zu Bett, das ertrug er nicht; er saß in einem Lehnstuhl, von Kissen umhäuft; eine Entzündung schnürte ihm den Atem in der keuchenden Brust.
Auf dem Tisch zu seiner Rechten lag groß ausgebreitet ein Stück Papier. Es war mit Reißzwecken festgemacht und mit Fähnchen besteckt. Mit Fähnchen! Mir stockte das Herz. Woran dachte er denn, der sterbende Mann? An Schlachten noch immer? An Aufmärsche und vergebliches Blutvergießen? An Triumphe, die verwelkt, an Hoffnungen, die verwest, an Verheißungen, die zu Staub zerfallen waren? Aber da erkannte ich, wie ich mich darüberneigte, die Karte unserer engeren Heimat, der ländlichen Umgebung unserer kleinen Stadt. Ich las die mir wohlbekannten Namen, erkannte die Linien der Wege, das zerstreute Gepünktel der Siedlungen und einzelnen Anwesen. Der Kranke wies darauf hin. Ich fragte: „Das haben Sie gemacht?“ Er nickte eifrig. Ich beugte mich tiefer, ein stolzes Lächeln erschien auf seinem Gesicht.
Für die Farben der Fähnchen war in einer Ecke der Karte ein Schlüssel angebracht, er lautete: Blaue Fähnchen für Milch, grüne für Kartoffeln, gelbe für Eier. – Mit zitternder Hand schob mir der Kranke eine Lupe zu. Mir wurde der Blick trüb hinter dem Schleier der Tränen. Da sprach er: „Wo die weißen Fähnchen stecken, dort wohnen gute Menschen.“
Ich legte die Lupe nieder und ergriff seine Hand. Am liebsten hätte ich sie geküßt. Er nickte stolz, mit dem bartstoppeligen Kinn niederweisend auf den Plan, auf das letzte Werk seines Lebens. Und siehe, es wimmelte von weißen Fähnchen das ganze Revier.
Am Tage danach verschied der alte Stratege. Seine Frau brachte mir die Nachricht, er habe mir, wie er zuletzt noch zu erkennen gegeben, die Karte seiner Hamsterfahrten und alle in ihr verbuchten Erfahrungen hinterlassen. Sie ziehe fort mit den Ihren, ihr könne der Plan nicht mehr von Nutzen sein. Aber ich hätte Kinder, Schwestern, Brüder, das ganze Haus voll Menschen, ich könne daraus Nutzen ziehen.
Ich dankte der Generalin und holte die Karte. Ich studierte sie wohl auch einen Abend lang. Aber ich verstand wohl wenig gut umzugehen mit dem mühsam erstellten Dokument. Das Gestech der Fähnchen kam durcheinander, die Wimpelchen fielen aus ihren Positionen, mit Schrecken sah ich, daß sich mir der säuberliche Aufmarschplan zur Schlacht um das tägliche Brot alsbald verwirrt haben würde.
Zum Glück bedurfte ich seiner nicht mehr lange. Kurze Zeit nach dem Tode des Generals wurde es besser mit allem, was die äußeren Lebensumstände betraf. Die Läden füllten sich mit Waren, das Hamsterwesen erlosch, die Gilde der wandernden Rucksackleute verschwand aus der Landschaft.
Das Leben erhob wieder sein Haupt, und gar nicht lange darauf ging das andere wieder an, wovon wir gedacht hatten, wir würden nie mehr dazu versucht werden können, das herzbeklemmende Spiel in den Landschaften der Pläne und Konstellationen, dieses Spiel mit Fähnchen und Fahnen, Ideen und Feldzeichen, um Entscheidungen, die so unabsehbar als gefährlich sind. Die Zeit der Not und der Demütigung hatten es nicht zu verhindern vermocht, daß andere Maßstäbe wieder auftauchten, daß wir aus Überstehenden wieder zu Handelnden wurden, zu Spielern mit hohem Einsatz. Wer nimmt noch Maß an den einfachsten Dingen des Lebens und daran, ob sich an ihnen erfülle, was doch das Erste und Größte und Wichtigste wäre, nämlich daß Friede sei auf Erden für alle, die guten Willens sind.