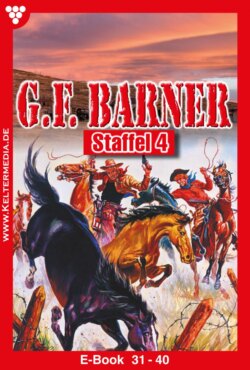Читать книгу G.F. Barner Staffel 4 – Western - G.F. Barner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIrgendwo über dem Unterholz neben dem Weg nach Camp McAllen, begann ein Flußhüpfer zu keckern. Der Vogel meldete sich dreimal in kurzen Abständen, und Lucky Louis Charlton hob den Kopf. Er sah nach Norden, den Buschstreifen entlang am Hang vorbei, und entdeckte die schwache Staubwolke.
Der Flußhüpfer schwieg jetzt. Rechts am Hang bewegten sich die Zweige eines Busches. Lucky Louis Charlton sah einen Moment Felice Garcias dunkles Kreolengesicht unter dem breitrandigen Sombrero. Dann verschwand der Sombrero. Felice war fort. Er hatte die Staubwolke wie Charlton gesehen und wußte, daß sie jetzt kamen.
»Kommen sie?« Die Stimme war neben Charlton – eine weiche, katzenhaft schnurrende Stimme.
»Si«, sagte Charlton. »Yes, sie kommen, Maddalena!«
Eigentlich hieß sie Magdalena, aber sie sprachen den Namen so aus, nur Charlton nannte sie manchmal einfach Madge, wenn er ihren Namen amerikanisierte.
»Sind sie schon zu erkennen?«
»Na«, antwortete Charlton kurz. Die Sonne schien heiß – der Himmel war wolkenlos blau. »Es ist noch zu weit!«
»Wie weit?«
»Eine Viertelstunde, Maddalena.«
Er kroch ein Stück zurück und blieb im warmen Sand liegen. Charlton war müde. Sie waren die ganze Nacht geritten und drei Stunden vor dem Morgengrauen über den Fluß gesetzt. Jetzt warteten sie auf höchstens zehn Mann und einen oder auch zwei Wagen. Jener Flußhüpfer, dessen Keckern die Vormittagsstille durchbrochen hatte, hieß eigentlich Felipe. Der Mann konnte das Fauchen des Jaguars wie das Keckern eines Flußhüpfers oder das aufgeregte Gackern eines Taubenhuhnes nachahmen. Zudem besaß er die besten Augen der ganzen Horde, die Garcia führte.
»Woran denkst du?« Die Katzenstimme schnurrte, eine Hand kroch an Charltons Arm. Maddalena hatte schlanke Finger – ungewöhnlich lang und sogar fast immer sauber wie ihr ganzer braunhäutiger Körper. Charlton hatte nie zuvor einen so schönen und ebenmäßig gewachsenen Körper gesehen.
»Ich weiß nicht«, sagte Charlton müde. »Woran sollte ich jetzt denken?«
»An mich«, flüsterte sie. »Hörst du, du mußt an mich denken – jetzt… immer!«
»Katze«, sagte Charlton und hob den Kopf matt an. »Laß das jetzt!«
»Warum?« schnurrte sie. Ihre Hand kroch über seinen Nacken, erfaßte seine blonden langen Haare und kraulte sie. Charlton schloß die Augen, lag still und ließ es sich gefallen. »Warum nicht jetzt, eh? Denkst du, daß wir sie alle umbringen werden? Ah – das wird ein Spaß, sie sehen nichts von uns! Wenn wir wollen, sterben sie so schnell, daß sie nicht einmal mehr beten können. Würdest du sie beten lassen?«
»Vielleicht…«
Charlton sprach noch lahmer. Ihr Gekraule machte ihn müder und müder, beinahe schläfrig. Er öffnete die Lider erst spaltbreit, als ihre Hand jetzt sein Hemd bedächtig und doch zielsicher aufknöpfte und ihre Finger über seine Brusthaare tiefer und tiefer glitten.
»Was ist?« fragte sie, als er sich auf die Seite drehte und einmal unwirsch knurrte: »Wer Zeit hat zu beten, der hat auch noch Zeit zu schießen. Sie werden keine Zeit haben – zu nichts, verstehst du? Gefällt es dir nicht, eh?«
Ihre Finger umspielten sein Gürtelschloß, eine Silberschnalle mit einem Löwenkopf. Der Gurt hatte einmal den Bauch eines reichen Hazienderos umspannt, bis Felipe dem Mann eine Kugel genau eine Handbreit über der Gurtschnalle in die Haut gepflanzt hatte.
»Nicht jetzt«, sagte Charlton, seine Stimme klang belegt. »Herrgott, sie sind in dreizehn Minuten oder so hier. Maddalena, du bist verrückt…«
Sie kicherte, ihr Körper rutschte über den Sand näher, und ihre Finger ließen das Gurtschloß aufschnappen.
»Uns sieht doch keiner, Amigo – oder?«
»Du bist wirklich verrückt«, keuchte Charlton und wollte sich wegrollen, aber sie hielt ihn fest. »Die anderen könnten kommen und…«
»Na und? Ich liebe dich, du blonder Teufel!«
Sie trug eine Leinenjacke – ein ziemlich weites und angeschmutztes Ding, das sie wie ein Sack umhüllte und die Formen ihrer Figur verbarg. Jetzt hatte sie die Jacke offen, unter der sie eine Bluse aus dünnem Seidenstoff über den nackten braunen Oberkörper gestreift hatte. Wie die anderen hatte sie Leinenhosen an – weite, schlotternde Hosen, die nichts von ihren strammen, federnden Beinen zeigten.
»Du bist ja wahnsinnig«, ächzte Charlton, als sie die Jacke fortwarf und ihre Bluse. »Wenn dein Bruder kommt…«
»Pah«, machte sie nur. Ihre nackte Haut preßte sich an den Ausschnitt seines Hemdes auf seine Brust. »Komm… komm, rubioso…«
Charltons Müdigkeit war fort, die Sonne brannte auf seiner Haut, und er sah neben sich die sanfte, glänzende Rundung ihrer bloßen Schulter mit ein paar Sandkörnern wie glitzernde Perlsplitter darauf. Sein Blick glitt abwärts – und die Begierde siegte über seinen Verstand wie immer, wenn sie sich wie eine Katze an ihn schmiegte.
*
Es gab einen dumpfen Aufschlag, als der Mann von oben in die Mulde sprang und neben ihnen landete. Dann lag der Mann still, die Augen weit offen, den Mund auch.
»Damnato – verflucht noch mal!« zischte Garcia dann verstört. »Maddalena… seid ihr verrückt geworden? Dort kommen sie und ihr…, ah, was seid ihr für Menschen? Ihr könnt hier…«
»Por dios, was störst du uns?« fauchte Maddalena. Sie holte ihre Bluse und knöpfte sie zu, sah ihren Bruder scharf an und stieß ihm dann den Fuß in die Seite. »Zum Teufel, was geht dich das an, eh? Ich war es – ich! Hörst du? Schimpf nicht mit ihm – ich wollte es!«
»Du verdammte Katze!« knurrte Garcia finster. Er warf Charlton, der feuerrot geworden war, einen wütenden Blick zu. »Mußt du immer tun, was diese Teufelin will?«
»Ich – ich…«
»Schon gut«, schnitt ihm Garcia das Wort ab. »Es sind drei Wagen und zwölf Mann!«
»Drei?« staunte Charlton. »Aber er hat mir gesagt, es kämen höchstens zwei.«
»Statt hier herumzu…« Garcias Bart zuckte. Er zerbiß einen Fluch zwischen den Zähnen und deutete auf die Kante der Mulde, die nach Norden höher war als nach Süden. »Ich dachte, du hättest das gesehen. Ich wollte dich fragen, was der dritte Wagen zu bedeuten haben kann. Es ist ein Wagen mit einer Plane – und sie ist zugezogen, verstehst du? Was ist, wenn ihr die Planen zuzieht, eh? Los – antworte schon, wir haben keine fünf Minuten mehr! Du kennst alles, was mit der amerikanischen Armee zu tun hat. Was ist? Warum ist die Plane zugezogen?«
»Das muß ich erst sehen«, brummte Charlton. Er schloß sein Hemd, schob sich an die Kante und blickte unter den Buschzweigen durch nach Norden.
Der erste Wagen hatte einen Holzaufbau mit einem runden Dach – Charlton kannte diesen Wagentyp, weil er ihn selber gefahren hatte. Man transportierte bei der Armee entweder wichtige Schriftstücke oder eine Soldkasse in diesen Wagen. Auf dem zweiten Wagen, einem Flachkasten, waren zwei Sitzbänke auf jeder Seite, die insgesamt sechs Mann Platz boten. Die Männer saßen dort mit den Gewehren zwischen den Knien. Das war üblich bei einer Transportbegleitung. Der dritte Wagen erschien – seine Plane war geschlossen, und Charlton konnte die schwarzen Blockbuchstaben selbst auf diese Entfernung lesen – US Army!
»Siehst du ihn?«
»Ja«, sagte Charlton kurz. Er kniff die Lider zusammen und betrachtete die beiden Männer auf dem Bock. »Das ist weiter nichts!«
»Sagst du!« entfuhr es Garcia. Der schwere, breitschultrige Anführer der Bravados schlug in den Sand. »Und wenn es nun eine Falle ist? Was machen wir, wenn auf dem Wagen unter der verdammten Plane vielleicht noch zehn Mann sitzen und nur auf uns warten, he? Was ist, wenn dein Freund dich verraten hat?«
Einen Augenblick hatte Charlton ein komisches Gefühl, dann aber schüttelte er den Kopf.
»No«, erwiderte er bissig. »Das würde er nie wagen. Er weiß zu genau, daß er dann mit mir aufgehängt würde. Ich weiß zuviel von ihm.«
»Sie haben zweitausend Dollar auf deinen Kopf ausgeschrieben«, warnte Garcia finster. »Das ist viel Geld für einen Corporal. Und sein Freund ist Sergeant – der kann mit dem Geld aus der Armee ausscheiden und etwas anfangen.«
»Er kann mich nicht verraten. Außerdem weiß er nichts von euch, also – woher sollten es die da unten erfahren haben, Felice?«
Felice Garcia brummte etwas. »Und was kann im Wagen sein?«
»Weiß der Teufel! Vielleicht – Gewehre?«
»Gewehre?« schnaufte Garcia. »Diablo – wenn dort Gewehre wären, ah, das wäre gut! Und wenn doch Männer unter der Plane stecken?«
»Die wären längst erstickt bei der geschlossenen Plane, Felice.«
»Na gut«, brummte Garcia. »Also keine Männer, aber… der Teufel soll dich holen, wenn doch welche dort sitzen. Wir schießen sie alle tot, verstehst du?«
Charlton rutschte zurück und sah an Garcia vorbei.
»Ein Schuß fällt nicht weiter auf«, sagte er mürrisch. »Wenn du hier einen Krieg veranstaltest, Felice, wenn es ganze Salven gibt, deren Echo überall gehört wird, hast du bald Verfolger auf dem Hals. Außerdem… ich kenne ein paar der Burschen da unten!«
Garcia starrte ihn an. Er schüttelte verständnislos den Kopf.
»Ihr seid seltsame Menschen, ihr Gringos«, sagte er dann achselzuckend. »Ihr macht euch zuviel Gedanken. Wer tot ist, der ist tot, so ist das Leben, Amigo! Na gut, ich werde tun, was du vorgeschlagen hast – du kennst die Gringo-Armee besser als jeder von uns. Daß du dich nicht zeigst! Und du hältst deine neugierige Nase nicht über die Kante – verstanden, Maddalena?«
»Ich tue, was ich will, eh!«
»Katze!« zischte Garcia wütend. »Wenn du nicht meine Schwester wärst… Paß auf sie auf, Louis!«
Er kroch Über die Kante und war verschwunden. Charlton zog sich noch einmal empor und äugte nachdem Wagen. Er sah Lieutenant Ribben vor dem Wagen reiten. Der Abstand zwischen dem Lieutenant und den nächstfolgenden zwei Mann, einem Sergeant und einem Corporal, betrug etwa zwölf Schritt. Danach waren es noch einmal etwa zehn Schritt bis zum ersten Wagen.
»Louis, komm zurück, sie dürfen dich nicht sehen!« zischelte das Mädchen hinter ihm und zupfte an seinem Hosenbein. »Du bist stark, Louis – so stark!«
Er kroch zurück, sah mitten in ihre dunkelbraunen, fast schwarzen Augen und auf ihren lockenden, halbgeöffneten Mund. Sie schob sich wieder an ihn und legte den Kopf auf seinen Leib.
»Ich habe dir doch gesagt, daß dein Bruder kommen könnte«, brummelte Charlton. »So ein Wahnsinn, da unten werden sie vielleicht gleich alle sterben – und wir…«
»Und was ist, wenn wir sterben?« fragte sie leise und dunkel. Es war nichts Katzenhaftes mehr in ihrer Stimme, eher Schwermut und dunkle Vorahnung. »Dann werden wir wissen, daß wir noch einmal geliebt haben, ehe der Tod gekommen ist. Eines Tages werden wir sterben… beide… oder beide leben und reich sein. Eines Tages ist mein Bruder Gouverneur von Nuevo Leon. Er wird den Palast in Monterrey bewohnen, und ich werde seine Schwester sein – angesehen, reich… mit dir, mit meinem Mann… in Monterrey… Nuevo Leon!«
»Eines Tages«, sagte Charlton zögernd. »Ja… eines Tages… vielleicht…«
Dann schwieg er. Das Räderrollen näherte sich schnell. Die Wagen waren am letzten Hügel vorbei und fuhren nun auf die Senke zwischen den buschbestandenen Hügeln zu.
*
Felice Garcia hob das Gewehr sacht an. Seine Hand strich über den Kolben der Waffe, ehe er ihn an die Schulter setzte. Es war ein Dreyse-Gewehr – eine stark ziselierte und an den Holzteilen beschnitzte Waffe. Das Gewehr hatte jahrelang im Gewehrschrank von Garcias Vater gestanden – und es war neben dem Revolver die einzige Waffe, die Felice Garcia gerettet hatte. In Garcias Augen tauchte eine sengende Flamme auf wie jedesmal, wenn er das Gewehr in die Hand nahm. Das Gewehr seines Vaters, seine Lieblingswaffe…
Tot, dachte Garcia, alle tot. Ich werde sie umbringen… alle!
Die Erinnerung überflutete ihn wie ein Fieberanfall. Er schloß einen Moment die Augen und sah die brennende Hazienda vor sich, die stillen Gestalten in ihren Blutlachen auf dem Hof – Tote mit abgeschlagenen Köpfen, die Machetenhiebe abgetrennt hatten.
Sie müssen dafür büßen, dachte Garcia voller Haß und Rachsucht. Eines Tages wird wieder ein Garcia Gouverneur von Nuevo Leon sein wie früher!
Sein Vater war es gewesen – jahrelang, bis Mexiko einen Kaiser bekam und man dem alten Garcia nicht traute, weil er nie offen Partei ergriffen hatte. Man hatte ihn zuerst abgesetzt, einen Teil seiner Güter eingezogen, danach das Geld beschlagnahmt, damit er nicht etwa die Rebellen unter Benito Juarez unterstützen konnte.
»Abwarten!« hatte der Alte gesagt. »Nur nicht Partei nehmen, mein Sohn! Fahr nach San Luis Potosi, rede mit dem kaiserlichen General, versichere ihm, daß wir seine treuen Diener sind, aber sprich für dich mehr als für mich! Wir brauchen unser Geld, unseren Besitz. Warten wir ab, wer den Kampf gewinnt! Vielleicht halten sich die kaiserlichen Truppen, vielleicht siegt Juarez. Man muß auf beiden Schultern tragen in dieser Zeit…«
Beide Schultern, dachte Garcia. Sein Mund verzog sich zu einem schmalen, bitteren Strich – das hat er davon gehabt! Den Kopf haben sie ihm abgeschlagen!
Er spürte den Druck des Gewehrkolbens an der Schulter und öffnete wieder die Augen. Die Wagen kamen näher, es wurde Zeit. Und doch blieb ihm noch Raum für seine letzten Gedanken an jenen Tag in San Luis Potosi, als der kaiserliche General ihn angegrinst hatte, Spott in den Schlitzaugen.
»Was wollen Sie denn, Don Garcia. Wenn ihr Garcias wirklich für uns seid, dann habt ihr uns mit eurem Geld unterstützt, richtig? Das wäre doch eure Pflicht gewesen. Also, was soll es, Don Garcia? So oder so – das Geld wäre in unsere Kriegskasse gewandert. Ihr seid immer noch reich genug, habt beinahe hundert Peones – hundert Knechte, Don Garcia! Sagen Sie Ihrem Vater, er möchte selber kommen – so krank wird er schon nicht sein. Ein Garcia auf unserer Seite kann viel nützen – sagen Sie ihm das! Aber das Geld? Tut mir leid, Don Garcia, das Geld ist längst verbraucht. Eine Armee kostet viel…«
»Der Hund!« sagte Garcia zwischen den Zähnen und blickte auf die dichten Buschzweige. »Dieser gerissene Hund!«
Nach Hause gefahren, Grimm in der Brust, dachte Garcia, erfolglose Mission in San Luis Potosi, keine gute Nachricht für meinen Vater. Er hat die schlechte Nachricht nie mehr erfahren, wie? Als ich nach Hause kam mit meinen zehn Begleitern, da brannte alles. Die Juaristas hatten erfahren, daß ich nach San Luis gefahren war und sich ausgerechnet, was ich dort für uns erreichen wollte. Sie kamen auf die Hazienda, steckten sie an, holten meinen Vater und die Mutter heraus, die Hausdiener… und brachten sie alle bestialisch um. Sie nahmen Maddalena mit, dieser Kerl, dieser Teufel Gomez, ihr Anführer, dieser dreckige Indianer: Er nahm sie mit; er zwang sie, mit ihm zu schlafen. Das Schwein…
Garcia zitterte plötzlich heftig. Die Ehre einer Garcia besudelt, den Namen befleckt – diese Schande! In Mexiko brauchte man ein Mädchen nur zu belästigen, um dem Bruder oder Vater einen Grund zu geben, zum Revolver zu greifen. Garcia hatte nicht zum Revolver gegriffen – Garcia hatte sich Männer beschafft mit jenem Geld, das die Garcias aus Vorsicht und aus bösen Vorahnungen versteckt hatten. Männer – Waffen! Und danach hatte er Gomez bis in die Sierra della Iguana verfolgt, hatte ihn gesucht, gefunden, als Gomez in der Nähe von Lampazos nur mit einer Handvoll Männer und Maddalena einige Tage Ruhe einlegte.
Die Ameisen, dachte Garcia – sein Mund zuckte in der Erinnerung, die Lippen bebten – ich habe ihn den roten Ameisen gegeben. Wie er schrie, der Hund!
Die roten Ameisen hatten Gomez gefressen, bis nur noch sein Knochengerüst übrig war. Maddalena hatte er mitgenommen – eine andere Maddalena, eine völlig veränderte Schwester, nicht mehr die Unschuld von früher, eher eine Wildkatze, kaltblütig, scharfzüngig… eine Tigerin, die Männer verachtete, bis dieser Gringo gekommen war: dieser blonde, große Amerikaner. Sie fragte ihren Bruder nicht mal mehr, ob sie den blonden Amerikaner lieben durfte, sie nahm ihn sich, fertig!
Garcia richtete sich langsam auf. Die dichten, belaubten Buschzweige waren vor ihm – eine staubgraue, dichte Mauer. Der Hufschlag tackte heran und kam regelmäßig näher.
Felice Garcias Mund preßte sich zusammen, er dachte nicht mehr an seine Vergangenheit, nur noch an die Zukunft. Links von Garcia raschelte es einmal, als krieche eine Schlange durch das verfilzte Unterholz. Danach war alles still, aber Garcia wußte, daß sie alle bereit waren – sechsundzwanzig verwegene, wilde Bravados, die nur auf seine Befehle hörten.
Der Gewehrlauf schob sich langsam in die Zweige.
Dreißig Schritte, dachte Garcia, fünfundzwanzig… zwanzig… Und dann schnellte er jäh in die Höhe.
Garcia sah den Mann vor sich, das dunkelbraune Armeepferd mit der weißen Blesse. Garcia blickte über den Lauf des Dreyse, sah die Knöpfe der Uniformjacke blinken, das blaue Tuch…
*
Der Mann auf dem Pferd nahm den Kopf herum, als die Bewegung links vor ihm den Busch jäh zu spalten schien.
Aus der Mündung des Dreyse fauchte eine Feuerlanze. Die Kugel kam mit trockenem, wildem Hieb und traf den Mann mitten in der Brust.
Der Fahrer des ersten Wagens sah, wie der Busch unmittelbar neben seinem Bock sich jäh teilte und eine Gestalt heraussprang.
Greaser, dachte Falcon, der Fahrer, entsetzt – Mexikaner! Wo, zum Teufel, kommen diese Halunken her?
Danach hörte er den Schrei hinten – das knallende Wummern des nächsten Schusses, dem ein erstickter, gurgelnder Laut folgte. Falcon sah sie jetzt wie eine Menge Erdhörnchen, die plötzlich aus ihren Erdhöhlen auftauchten.
»Hände hoch!«
Neben ihm tat der Greaser einen Sprung und stieß ihm das Gewehr zwischen die Rippen.
»Du… schnell!« schrie der Greaser, dessen Gesicht mit den hervortretenden Wangenknochen und den Schlitzaugen Falcon an die Fratze eines wilden Mongolen erinnerte.
Unwillkürlich zuckte Falcons Blick zu der anderen Seite hinüber, traf den Posten, der neben ihm saß, fuhr an diesem vorbei…
Falcon sah sie drüben stehen, sechs – sieben der sogar zehn Greaser, die Gewehre im Anschlag. Während Falcon die Arme hob, traf sein Blick den Sergeanten. Er sah Bloomes Gesicht nicht, aber Bloomes Nacken. Und der war weiß wie Schlämmkreide.
Sie standen geduckt wie Wölfe rechts und links neben Bloome und dem First Corporal Higgins. Ihre Patronengurte liefen kreuzweise über ihre schmutzigen, verdreckten Leinenjacken. Sonne ließ die Bodenstücke ihrer Patronen blinken.
»Sargente! Befehl… Arme in die Luft, schnell!«
Der Kerl schrie es, ein großer, breitschultriger Greaser, der eine Uniform trug, eine grüne Jacke, wie sie die Chasseurs der kaiserlichmexikanischen Armee benutzten. Er hatte breite Epauletten auf den Schultern, deren Goldfäden glänzten.
»Verfluchte Pest!« hörte Falcon seinen Sergeant keuchen.
Dann nahm Bloome die Arme in die Höhe. Falcon sah, wie die Gewehrmündungen mit dem Heben der Arme mitschwangen und wußte, daß der Sergeant Bloome und der First Corporal neben ihm tot gewesen wären, wenn sie jetzt nicht die Arme hochgestreckt, sondern zu den Waffen gegriffen hätten.
Hinten auf dem zweiten Wagen saßen die sechs Mann wie gebannte Figuren.
Der Third Corporal, der ihnen hätte Befehle geben können, war nach hinten gekippt, wie ihn die Kugel umgeworfen hatte. Er lag mit offenem Mund, aus dem ein heiseres, stoßartiges Gurgeln drang, genau zwischen den in zwei Reihen stehenden Männern. Blut lief ihm über den Hals, tropfte einem der Männer an die Hosen.
»Du… absteigen, Gewehr auf Wagen lassen… Du… kommen, schnell!«
Der erste Mann erhob sich mit hochgestreckten Armen. Er dachte an seinen Revolver, aber auch nur drei Sekunden lang. Dann steckte ihm eine Gewehrmündung zwischen den Rippen, und der Stoß schleuderte ihn gegen das Endbrett des Wagens zurück. Der Mann schickte einen Blick der Hilflosigkeit zum Bock des letzten Wagens, aber es gab keine Hilfe. Er war allein mit dem Gewehr zwischen den Rippen.
»Nicht schießen«, sagte er schwer atmend. »Ich tue ja nichts!«
Vorn hörte der Sergeant ihn sprechen und biß die Zähne zusammen. Angst, dachte Bloone, er hat Angst. Ich habe auch Angst, verflucht. Die bringen, sagt man, alle um, die kennen keine Gnade. Mein Gott, hier in Texas, sie haben sich frech und offen am hellichten Tag nach Texas gewagt, diese Halunken. Am hellichten Tag… nicht zu fassen!
Dann dachte er an Camp Nicholls und daran, was man mit ihm machen würde, wenn er jemals nach Camp Nicholls, Camp McAllen oder Fort Mclntosh kommen würde. Feigheit vor dem Feind! Keinen Versuch unternommen, die Wagen zu schützen und zu retten, was zu retten war!
Verflucht, dachte Bloome – sie degradieren mich, da kennen sie gar nichts. Aber – was zum Henker, soll ich denn tun, he? Ich schnippe bloß mit dem kleinen Finger, dann kippe ich vom Gaul und bin tot!
Sie würden jeden Mann verhören, jeden, der die Sache hier überlebte – wenn es überhaupt Überlebende geben sollte…
»Du… absteigen! Komm herunter, Sargente!«
Der Sergeant sah sich um, blickte nach Norden und sah nichts. Es kam keine Staubwolke, es gab keine Patrouille, die am Fluß entlangritt, die Schüsse gehört hatte und nun nachsehen kam.
Als er abstieg, mußte er die eine Hand herunternehmen. Er brachte sie an das Sattelhorn und schwang das rechte Bein hoch.
In diesem Augenblick sah er, daß der eine Greaser zurücktrat.
Der Sergeant sah eine Chance, eine winzige nur. Er stieß sich jäh ab und rammte das Bein heraus. Sein Stiefel trat das Gewehr zur Seite. Danach fuhr der Stiefel dem Greaser an den Kopf. Noch im Fallen riß der Sergeant die Hand herunter und zum Revolver.
Niemand sollte sagen, daß er es nicht wenigstens versucht hätte.
Es gelang ihm lediglich, die Verschlußlasche der schweren Armeerevolverhalfter zu öffnen. Dann war der andere Greaser schon neben ihm und holte aus.
Neun Mann des Begleitkommandos sahen, wie der Mexikaner einen wuchtigen Hieb mit dem Gewehrkolben führte und der Sergeant hintenüber flog. Er knallte in den Staub, blieb liegen. Sein Hut war davongeflogen, seine kurzgeschnittenen Haare klafften auseinander.
»Estupido!« knirschte der Greaser wütend.
Aus den Haaren des Sergeanten lief Blut auf den Weg.
Jetzt konnte ihm kein Mensch einen Vorwurf machen. Er hatte es wenigstens versucht, wenn er auch gescheitert war.
Die anderen blickten erstarrt zu ihrem Sergeanten hin.
»Absteigen… schnell!«
Jetzt war niemand mehr da, der ein Kommando gegeben hätte. Es war auch aussichtslos, sie hatten keine Chance. Einer nach dem anderen stieg von Pferd und Wagen. Man trieb sie auf die Seite, man jagte sie auf die Büsche zu und nahm ihnen alles ab, was sie besaßen – Geld, Uhren, Ringe – alles. Selbst Federmesser wechselten den Besitzer. Dabei ging alles schnell – so schnell, daß die Männer kaum zur Besinnung kamen und sich plötzlich auf dem Weg in die Büsche wiederfanden. Man jagte sie unter Bewachung immer weiter.
Die Greaser hockten auf den Armeepferden, fuchtelten mit Gewehren und Machetas über ihren Köpfen und schrie immer wieder: »Adelante – vorwärts, schnell, lauft!«
Sie liefen, Angst im Nacken, daß die Greaser sie doch noch töten würden, immer weiter, bis zwischen die verstreut stehenden Büsche in irgendeiner Senke. Irgendwann glaubten sie das Knarren von Rädern, das Knallen von Peitschen zu hören.
»Eh – ihr hierbleiben!« schrie einer der Greaser und schlug dem First Corporal die flachgehaltene Machetaklinge über den Kopf. Der First Corporal brach in die Knie, die Greaser lachten schallend und höhnisch. »Ihr euch nicht rühren, sonst alle tot, wenn kommen!«
Mit der Drohung rissen sie die Pferde herum und jagten davon, zurück an den Weg, an dem es nichts mehr zu sehen gab – keinen Lieutenant, keinen Sergeanten, keinen Wagen. Nur ein paar Blutflecken waren noch da und schillerten wie dunkles Öl in der Sonne.
Über diesem schmalen Weg zwischen den Hügeln lag Charlton, das Mädchen neben sich, dessen Bluse drei Knöpfe weit offen war, so daß Charlton den Ansatz ihrer strammen braunen Brüste sehen konnte.
»Soldados americanos«, sagte Maddalena verächtlich und spuckte einfach aus. »Was sind das für Soldaten, eh? Und sie haben unsere Truppen einmal besiegt – diese Männer? Sie können nicht kämpfen, sie sind feige!«
Charlton stand auf und schüttelte den Kopf.
»No«, sagte er halblaut. »Das verstehst du nicht, Maddalena. Sie sind nicht feige, sie sind nur nicht verrückt genug, umsonst zu sterben!«
»Pah – Feiglinge!« erwiderte sie verächtlich. »Kämpfen nicht. Wir hätten gekämpft!«
»Sicher«, murmelte Charlton. »Das hättet ihr. Und dafür wäret ihr nun alle tot. Das ist der Unterschied zwischen euch und uns – wir kämpfen immer nur dann, wenn wir eine Chance sehen, wenn es sich lohnt. Das verstehst du nicht, wie?«
»No«, sagte sie herb und enttäuscht. »Warum kämpfen sie nicht? Man kann nur einmal sterben, Amigo!«
»Es ist nicht gleich, wann man stirbt und wie.«
Sie sah ihn kopfschüttelnd an, nichts als Verständnislosigkeit in den dunklen Augen.
»Ich begreife euch nicht – ihr seid so anders. Warum seid ihr so? Ihr gebt kampflos drei Wagen auf… warum?«
»Weil sich Wagen ersetzen lassen – Menschen nicht.«
»Es gibt so viele Menschen!«
»Ja«, sagte Charlton. Er wußte nicht, wie er es ihr beibringen sollte. Sie dachte anders. »So sind wir nun mal – ich auch.«
»Du nicht, du bist stark, Louis.«
»Stark?«
Er zuckte die Achseln. Sie griff nach seiner Hand und lief mit ihm los wie eine Gazelle über Stock und Stein hinunter zu den Pferden. Bei den Sprüngen preßte sich der flatternde Leinenstoff gegen ihre schlanken, langen Schenkel. Ihre Brüste hüpften unter der dünnen Bluse wie zwei junge Rehzwillinge.
Wildkatze, dachte er. Unvorstellbar, daß du einmal in einem Haus mit Dienern gelebt haben sollst.
*
Sie sah ihn mit blitzenden Augen an und riß ihn mit sich fort.
»Komm, Louis!«
Ihre langen schwarzen Haare flatterten wie eine Fahne, ihre Muskeln federten durch und trugen sie leichtfüßig zu den Wagen hinab.
»Patronen!« knurrte Felice Garcia ihnen entgegen. »Im Wagen mit der Plane…, nur Patronen und Pulver. Da ist die Kiste, Louis!«
Sie hatten den Lieutenant, den Third Corporal und den Sergeanten bei der Fahrt einfach zwischen die Büsche geworfen. Jetzt schleppten sie die Kiste aus dem Transportwagen und stellten sie vor Garcia hin. Der ließ sich ein Beil geben und schlug auf die beiden Schlösser ein. Danach starrten sie alle auf das Geld.
»Louis, wieviel?«
»Hmm«, machte Charlton. »Fünftausend Dollar – vielleicht etwas mehr. Felice, mach schnell, ihr müßt verschwinden. Eine Armeesoldkasse stehlen, das vergessen sie euch niemals!«
»Pah, sie kommen nicht so schnell«, lachte Garcia. »Was sagst du, kostet ein gebrauchtes Gewehr? Fünfzig Dollar? Gut, das wären hundert Gewehre, aber ich will eine Kanone haben, ich muß eine Kanone haben, verstehst du?«
Eine Kanone! dachte Charlton, der und eine Kanone! Er muß verrückt sein. Nun gut, soll er sich eine besorgen, kaufen kann er sie nicht, also muß er irgendwo einen Überfall machen.
»Du kannst sie doch bedienen, Louis?«
»Sicher«, sagte Charlton kurz. »Das ist nicht weiter schlimm. Ich bin daran ausgebildet worden, ehe ich zu der Transportkompanie versetzt wurde – ich war Kanonier.«
»Gut – wir werden uns eine Kanone besorgen, Louis. Eh, nimm Maddalena, reite voraus!
Garcia starrte ihnen nach und grinste. Eine Kanone, dachte er, damit schieße ich alle tot! Ich, General Felice Ramondo Garcia, will eine Kanone haben. Dann kann ich mit einem Schuß hundert Gegner töten. Ich kämpfe gegen alle – gegen kaiserliche Truppen und die von Benito Juarez. Ich werde eines Tages Gouverneur von Nueva Leon sein – oder noch mehr – ich, Felice Ramondo Garcia!
Charlton ritt, sah das Mädchen an, schwieg aber. Er würde niemals allein sein, das wußte er. Sie kam mit, wohin es auch immer ging.
»Du wirst ihm helfen, Louis?«
»Ja«, antwortete er dünn. »Sicher…«
Sie lachte kichernd und drängte ihr Pferd näher.
»Du wirst sie mit der Kanone alle erschießen – die Juaristas und die Maximilianos, alle, ja?«
»Nun ja, wenn ich kann?«
»Du wirst können – mit mir kannst du alles, weißt du? Wir werden leben – wir beide…, immer zusammen!«
Er sagte nichts, sah weg.
»Wenn wir nicht zusammen leben können, werden wir zusammen sterben, hörst du?«
»Ja, ich höre!«
So was! dachte Charlton. Ich werde sie nie mehr los. Sie ist verrückt nach mir. Ich dachte nie, daß ein Girl jemals so verrückt nach mir sein könnte. Dabei weiß sie doch, was ich getan habe. Ich habe zwei meiner Kameraden umgebracht. Wenn sie damals mitgemacht hätten…
»Louis!«
Charlton fuhr zusammen und schreckte hoch.
»Louis, was werden sie tun, deine Freunde von der Armee?«
»Gar nichts«, brummte er. »Sie haben Befehl, niemals über die Grenze zu gehen. Ich hab’s Felice schon erklärt. Kann höchstens sein, daß sie eine Belohnung aussetzen. Es gibt immer ein paar Verrückte, die sich eine Belohnung verdienen wollen. Sicher werden sie bald wissen, daß Felice den Transport überfallen hat.«
»Und dann?«
»Was dann?« fragte er achselzuckend. »Militär können sie ihm nicht nachschicken. Sie können nicht viel tun, Maddalena.«
»Aber – etwas werden sie doch machen müssen?«
»Vielleicht«, sagte er gleichmütig. »Vielleicht schicken sie ein paar Spitzel los. Man sagt, sie belieferten Benito Juarez heimlich mit Waffen. Man sprach schon davon, als ich noch drüben war. Die Vereinigten Staaten wollen weder Franzosen noch Österreicher in Mexiko haben. Amerika den Amerikanern – also unterstützen sie Juarez. Vielleicht werden sie ihm melden, daß er für Ruhe hier an der Grenze zu sorgen hat. Damit sie nicht wieder Geld verlieren. Yankees reagieren immer ziemlich wütend, wenn es um ihr Geld geht!«
»Ihr denkt nur an Geschäfte, eh?«
»Das ganze Leben ist ein Geschäft. Es fängt mit deiner Geburt an – jemand verdient schon an dir, wenn du auf die Welt kommst – die Hebamme, danach eine Tuchfabrik, ein Kinderwagen – oder Wiegenhersteller, ein Schuhmacher… das ganze Leben ist ein Geschäft, verstehst du?«
»Darüber habe ich noch nie nachgedacht, Louis, aber… du hast recht. Und – was werden sie Juarez schreiben?«
»Nun, daß er für Ruhe sorgen soll, wenn er weiter ihre Waffen bekommen will. Patronen, Kugeln – Kanonen!«
»Du meinst, Juarez könnte seine Truppen schicken, die dann nach uns suchen?« fragte sie bestürzt. »Aber – wir haben seine Leute doch noch nie angegriffen!«
»Er braucht seine Truppen in anderen Gegenden«, brummte Charlton. »Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen.«
Er sah sich um – sie kamen weit hinten heran und ritten in den Fluß, den Munitionswagen brachten sie mit.
Nur die Gewehre fehlten noch. Hatte Felice Garcia erst Gewehre, würde es auch nicht mehr schwer sein, genug Bravados zu finden, die die Gewehre trugen. Es gab immer Unzufriedene und Entwurzelte genug, die bereit waren, einen Krieg auf eigene Faust zu führen und dabei Beute zu machen. Ein Handgeld und ein Gewehr – und Felice Garcia konnte eine Armee zusammenbekommen. Geld hatte er jetzt – fehlten nur noch die Gewehre.
*
Concho blinzelte zu der anderen Pritsche hinüber. Der Mann, der dort lag, hatte langes blauschwarzes Haar und ein Kopfband um die Stirn geschlungen. Zwischen ihnen reckten sich genau siebenundsechzig runde, matt glänzende Eisenstäbe bis an die Decke hoch.
»Aufstehen!« schrie der Sergeant der Wache zum zweitenmal. Und dann leiser, halb zwischen den Zähnen: »Ihr verdammten Hundesöhne – aufstehen!«
Concho sah, daß sich das linke Augenlid von Mattare träge hob. Der Chiricahua-Apache in der Nachbarzelle blinzelte nun genauso wie Concho Hurst. Er wollte sehen, was Concho tat. Und da Concho Hurst liegenblieb, als hätte er vor, einen gesunden und störungsfreien Schlaf abzuhalten, tat es auch der Chiricahua ihm nach.
Concho grinste dünn, als die Posten am Eingang zum Zellenblock von Fort Duncan salutierten und stramm wie Zinnsoldaten standen. Die Schritte kamen aus dem Vorraum, hielten einen Moment an – und eine tiefe, knarrende Kommandostimme knurrte: »Rühren!«
Die beiden Zinnsoldaten blieben trotzdem wie angeleimt stehen und starrten Löcher in die Luft, als der Mann in der blauen Uniform an ihnen vorbeiging. Erst hinter ihm erschlafften sie und stellten das linke Bein vor. Die Kolben ihrer Gewehre knallten klatschend auf den harten Zellengangboden.
Hinter dem untersetzten, stämmigen Major erschien das spitze, dreieckig wirkende Gesicht von Captain Hayes. Und wenn Concho Hurst sich gewünscht hätte, jemals einem Mann die Nase zu verbiegen, dann war es Hayes mit seinem zu langen, spitznasigen Riechorgan, das ständig wie der Rüssel eines Ameisenbären nach irgend etwas zu schnüffeln schien.
Hayes schnüffelte jetzt nicht. Es sah aus, als hinge seine überlange Nasenspitze traurig und voller Melancholie ein Stück tiefer herab. Der Captain machte ein verschlossenes Gesicht und hielt die Lider fast geschlossen. Seine scharfen grauen Mausaugen schienen mit Widerwillen die beiden Zellen und die zwei Delinquenten zu betrachten.
Major Forester blieb vor dem Gitter stehen, ließ den dritten Mann, den Sergeanten, vorbei und wartete, bis er aufgeschlossen hatte.
Concho blieb liegen, die Arme unter dem Nacken, irgendwo die Finger an jener Beule, die ein Gewehrkolbenhieb vor vier Tagen hinterlassen hatte. Das Kopfbrummen aber war immerhin schon vorbei.
»Concho!«
»Hallo«, sagte Concho müde und gähnte. Er hob lässig seine langen, schlanken Beine an, setzte sich und stand auf. Er wollte die Unhöflichkeit nicht gleich auf die Spitze treiben. »Hallo, Jim?«
Major Jim Forester trug ständig eine Reitpeitsche unter dem rechten Arm. Es war ein hartes, aus Büffelleder geflochtenes Ding, das zu Forester wie eine Uniform gehörte. Forester hatte zwei Jahre in Old England verbracht – und das einzige, was er neben militärischer Taktik an Wissen mitgebracht hatte, war jene Büffellederreitpeitsche gewesen. Natürlich auch die Angewohnheit britischer Offiziere, einen Stock unter der rechten Achsel eingeklemmt zu halten. Für Forester gab es nichts außer britischer Armeedisziplin. Und da er zusätzlich ein Jahr bei den Preußen gewesen war, schwor er auf deren Disziplin noch einige Stücke mehr. Forester konnte brüllen wie ein Löwe, stand jemals ein Pferd nicht genau neben dem Kopf eines anderen. Fand er einen Stiefel, der nicht ganz blank war, konnte es zu einer Katastrophe für den Mann kommen.
Mit Concho erhob sich in der Nachbarzelle der Chiricahua, aber genauso schlaksig und langsam.
»Concho!« knurrte Forester scharf. »Kaum ist man mal eine Woche fort, stellst du die schlimmsten Sachen an. Einem Mann fehlt das halbe Ohr, zwei liegen mit gebrochenen Gliedmaßen im Revier, drei machen Innendienst, und zwei haben heute noch Kopfschmerzen, ganz zu schweigen von Sergeant Mills Daumen, den hast du ihm ausgedreht!«
Nach dieser Aufzählung aller Schandtaten holte Forester erst einmal Luft. Den Moment nutzte Concho Hurst aus und sagte gleichmütig: »Er wollte mir den Daumen in die Nase stecken. Ich wollte ihm noch sagen, daß ein Daumen für ein Nasenloch zu dick ist, aber der Kerl hörte ja nicht auf mich. Tut mir leid, Jim!«
Forester stieß ein grimmiges Lachen aus.
»Tut dir leid – sieh mal einer an! Ein ganzer Zug ist nicht einsatzfähig, nur weil ihr zwei Schurken verrückt gespielt habt. Welcher Satan hat euch geritten?«
»Ein rothaariger, betrunkener Irensergeant«, berichtete Concho achselzuckend. »Er nannte Mattare einen stinkenden, verlausten und rothäutigen Hundesohn. Und dann trat er ihm in den Hintern.«
Forester stand einen Augenblick reglos in der Zelle, dann sah er sich nach Captain Hayes um.
»Captain«, schnarrte er sanft. »Davon steht aber nichts in dem Bericht. Es ist lediglich erwähnt, daß vielleicht einige beleidigende Worte zwischen dem Sergeanten und Hurst fielen. Von einem Tritt in den… habe ich nichts gelesen. Oder sollte ich nicht mehr sehen können?«
»Sir, ich dachte, die Einzelheiten…«
»Die Einzelheiten?« brüllte Forester plötzlich los, daß die Stäbe sich beinahe verbogen. »Captain, wenn man einem Indianer in den Hintern tritt und ihn eine lausige, stinkende Rothaut schimpft, dann ist es kein Wunder, wenn… Captain, darüber reden wir nachher noch! Concho, was passierte weiter?«
»Nun«, berichtete Concho Hurst gemütlich. »Der Tritt warf Mattare gegen einen anderen Irensohn. Der hielt zufällig sein gefülltes Glas in der Hand, aus dem etwas über den Rand schwappte, woraufhin der fromme Pilger den restlichen Inhalt Mattare genau zwischen die Augen goß. Danach wollte er ihn von vorn in den Bauch treten. Als er mit seinen krummen Beinen ausholte, sah ich, daß sein Stiefel ein Loch in der Sohle hatte. Ich wollte ihm sagen, daß er sich mit dem Sohlenloch nicht von seinem Major erwischen lassen dürfte und hielt den Stiefel ein wenig fest. Der arme Kerl fiel hin. Dabei kam sein linkes Ohr dem Sporn des Sergeanten zu nahe. Darum das halbe Ohr, Sir!«
Forester lief rot an und biß die Zähne zusammen. Er war jedoch nicht mehr wütend, sondern hatte nur höllische Mühe, bei Conchos Schilderung nicht laut loszulachen.
»Gut«, schnaufte er schließlich. »Und dann?«
»Der arme Bursche schrie mordsmörderisch«, setzte Concho seinen Bericht fort. »Der Sergeant warf eine Flasche nach meinem Kopf, der ich nach Kräften auszuweichen bemüht war, Sir. Zufällig wollte sich in diesem Moment gerade einer der Freunde des Halbohres auf mich werfen – von hinten, Sir! Dieser wackere Mensch bekam die Flasche des Sergeanten an den Kopf, weshalb er auch heute noch im Revier liegt, schätze ich. Es war eine ganz und gar unglückliche Sache, Sir. Einer der anderen frommen Iren wollte mir einen Stuhl auf den Kopf legen. Ich tauchte wohl etwas zu schnell nach unten, und so traf er statt meiner einen meiner Partner. Der brach sich den Arm, Sir – tut mir mächtig leid!«
»Major«, schnaufte Hayes empört. »Mister Hurst vergißt zu erzählen, daß er den großen Spucknapf als Keule benutzte. Und dann rissen sie das alte Planwagenrad von der Decke, das im Saloon zur Verzierung angebracht war, und stülpten es vier Mann über die Köpfe. Damit nicht genug, versuchten sie den Sergeanten auf das Rad zu flechten – jedenfalls schrien sie, sie würden es tun, als die Streife vorbeikam.«
*
»Ah«, knurrte Forester. »Mister Hayes, und diese Einzelheiten kennen Sie, wie? Schon gut, Concho – komm heraus!«
»Nicht ohne den da!« sagte Concho träge. Er deutete mit dem Daumen auf Mattare, der bewegungslos drüben vor der Pritsche stand. »Der kommt mit mir, Sir.«
»Natürlich, ich brauche euch beide!« knurrte Forester bissig. »Ich komme gerade aus Fort McIntosh, Concho. Schöne Schweinerei passiert – alle Stationen alarmiert, überall Patrouillen unterwegs. Sinnlose Maßnahme, das Gesuche nach Greasern. Kennst du Garcia… Felice Ramondo Garcia? Sein Vater war Gouverneur von Nuevo Leon.«
Concho Hurst zog die Brauen hoch.
»Ich kannte ihn – vor dem Krieg«, murmelte er. »Mein Vater fuhr manchmal zu den Garcias. Sie hatten ziemlichen Einfluß auf den Handel in Nuevo Leon bis hinab zur Grenze. Er müßte jetzt – achtundzwanzig Jahre alt sein. Was ist mit ihm?«
»Er hat eine kleine Armee Mörder und Halunken gesammelt, nennt sich General und macht die Gegend unsicher. Solange er das drüben tat, ging uns das nichts an. Der Kerl ist jedoch vor drei Tagen über die Grenze gekommen! Er hat fast sechstausend Dollar Armeesold kassiert und zwanzigtausend Schuß Munition gestohlen. Dazu siebzehn Pulvertonnen – volle, versteht sich! Lieutenant Ribbon liegt in Camp McAllen. Ob er durchkommt, weiß kein Mensch zu sagen.«
Concho wechselte einen Blick mit Mattare. Der Chiricahua starrte ihn an, kniff ein Auge zu, führte die Hand zum Mund und legte sie danach an sein Ohr.
»Was sagt er?« wollte Forester wissen. Er wußte wie jeder hier, daß Mattare keine Zunge mehr besaß.
»Er fragt, ob jemand Garcia gesehen hat, oder ob ihr nur gehört habt, daß er es gewesen sein soll«, antwortete Concho Hurst knapp. »Was ist – hat ihn jemand erkannt?«
»Der Sergeant des Sicherungskommandos«, gab Forester zurück. »Wir hielten ihm ein Bild Garcias vor, das wir aus einer alten Zeitung hatten. Kein Zweifel, daß er es war. Concho, du weißt, daß wir keine Truppen nach drüben schicken können!«
»Aber Zivilisten, was?« brummte Concho trocken. »Möglichst Leute, die sich drüben auskennen, nehme ich an. Ich habe euch gegen die Mescalero-Apachen als Scout gedient, versuche aber seit einem Vierteljahr wieder, einen kleinen Handel aufzubauen. Verstehe mich richtig, Jim, ich bin Händler…«
Mattares Blicke glitten hin und her. Einmal betrachteten sie Forester, dann wieder Hurst.
»Ich weiß, daß du Händler sein willst«, knurrte Forester. »Komm schon raus da – wir reden unterwegs darüber. Ich soll dir etwas von General Howard bestellen – für den Fall, daß du dich um einige Dinge kümmern könntest.«
Hurst schwieg, winkte Mattare, und sie verließen das Jail. Draußen schickte Forester den verkniffen wirkenden Hayes voraus, hielt Concho zurück und sah sich um.
»Nun paß mal gut auf«, murmelte er leise. »Ich verdanke dir eine solche Menge, daß ich meine Schuld niemals abtragen könnte. Wenn du mich damals nicht verbunden und meinen Leuten Nachricht geschickt hättest, wo sie mich holen sollten…«
»Hör doch davon auf«, schnitt ihm Concho das Wort ab. »Was willst du?«
Forester seufzte, sah weg und brummte: »Ich will gar nichts, hol’s der Teufel. Der General will was. Hör dir aber erst an, was er tun würde, wenn du auf seinen Vorschlag eingehen solltest. Du hast mir erzählt, du würdest liebend gern wieder Handel mit Mexiko treiben wie dein Vater. Du hast aber auch gesagt, daß das im Grund nicht möglich wäre, solange der Bürgerkrieg drüben tobt. Nun – es gäbe eine Möglichkeit für dich, doch Handel zu treiben. Wir könnten dich unterstützen – wir, verstehst du?«
»Die Armee?« fragte Concho Hurst verstört. »Wie das, Jim? Seit wann treibt die Armee Handel?«
Forester lächelte dünn.
»Nicht direkten Handel, verstehst du? Offiziell tun wir gar nichts, wir halten uns aus dem Krieg drüben raus. Was so an Gerüchten umläuft, kennst du ja, wie? Vielleicht sind diese Gerüchte wahr – verstehst du? Wir könnten, wenn diese Nachrichten stimmen, alles nach drüben liefern. Waffen, Verpflegung, Zelte… alles, was ein Land braucht. Dazu hätten wir einen Mann nötig, der sich drüben auskennt und dem wir vertrauen können. Wir würden dafür sorgen, daß dieser Mann seinen Handel fast ungestört führen kann.«
»Mit Juarez und dessen Leuten?« fragte Hurst erstaunt. »Und wenn nun euer Juarez verliert? Gegen seine Horden aus Yaqui-Indianern, Peones und landlosen Leuten kämpfen gutausgebildete europäische Truppen. Wenn Frankreich noch mehr Soldaten schickt, wenn die Österreicher dasselbe tun, dann…«
»Sie werden nichts tun«, murmelte Forester gedämpft. »Im Gegenteil, wir haben sichere Nachrichten, daß sie im Verlauf eines Jahres alle Truppen abziehen wollen. Juarez wird gewinnen, und der Mann, der ihm jetzt hilft, wird eines Tages eine Menge Freunde in Mexiko haben. Nehmen wir an, wir machten dich zu diesem Mann?«
»Und wenn eure schöne Rechnung nicht aufgeht?« zischte Hurst. »Dann wäre ich der bestgehaßte Mann in Mexiko!«
»Sie geht auf – und wenn wir Truppen landen müßten, wie wir es schon einmal getan haben!« erwiderte Forester hart. »Was, zum Henker, haben Europäer in Amerika verloren, frage ich dich. Wozu haben wir die Briten aus unserem Land gejagt? Um jetzt als Nachbarn Franzosen und Österreicher zu bekommen? Juarez wird siegen – und du könntest der Mann sein, der ihm dabei hilft. Um freie Nachschubwege zu haben, müßte jedoch Gesindel wie Garcia verschwinden. Wir leben in ständiger Angst, daß einer unserer Transporte von einer dieser Banden überfallen werden könnte. Juarez kann uns keine Truppen zur Begleitung der Transporte stellen, er braucht die in Coahuila und in Mittelmexiko. Seine Truppen hier sind schwach, schlecht bewaffnet, kaum fähig, mit Banden fertigzuwerden, die überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Jemand muß Garcia aufstöbern, ehe der Kerl sich mit dem gestohlenen Geld einen Haufen Banditen zusammensucht, sich Waffen verschafft und zur tödlichen Gefahr für unsere Transporte wird. Natürlich suchen auch die Leute von Juarez nach ihm, aber Garcia kennt die Berge wie kaum jemand. Wir haben zweitausend Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt. Na?«
Concho Hurst sah fort. Handel, dachte Concho grübelnd. Handel wie früher, gesicherte Wege… alte Freunde sehen, wenn sie noch leben.
Mattare stieß einen Kehllaut aus, tief, gurgelnd – die einzigen Laute, die er von sich geben konnte. Concho sah ihn an.
»Was meinst du, Mattare?«
Der Chiricahua legte je zwei Finger schlitzförmig geöffnet vor die Augen. Dann deutete er nach Westen und beschrieb einen Halbkreis, ehe seine Hand zu Boden wies und seine Finger sich so bewegten, als ginge jemand in eine bestimmte Richtung.
»Was sagt er, Concho?«
»Er meint, wir sollten es riskieren«, brummte Concho mürrisch. »Ich sollte an später denken, sagt er. Mein Vater hätte sein gutes Auskommen gehabt und wäre heute bestimmt ein wohlhabender Mann, wenn er den Handel nur Schritt für Schritt hätte ausbauen können.«
»Dann ist Mattare klüger als du«, lächelte Forester dünn. »Concho, wir haben zehn gute Scouts, die jemand in Laredo helfen, Waren aller Art nach drüben zu schaffen. Keiner aber hat freiwillig nach Garcia suchen wollen. Schließlich haben sich doch zwei Männer gefunden. Sie sind weg – aber ich fürchte, sie werden keine große Chance haben, den Kerl zu finden. Die anderen acht begleiten einen Transport nach Monterrey, werden also dort dringend gebraucht. Ich dachte sofort an dich – und der General natürlich auch. Concho, niemand wird dich zwingen…«
»Diese Zusage«, murmelte Concho Hurst, »kann ich die schriftlich haben?«
»Bist du wahnsinnig, Concho? Schriftlich? Genügt das Wort eines Generals nicht?«
»Schon, aber ich habe immer lieber alles schriftlich«, nörgelte Concho. »Was geht denn für ein Transport nach Monterrey – weißt du etwas über ihn?«
Forester blickte nach den Wolken, er grinste schwach und schien mit sich selbst zu reden.
»Zweihundert Gewehre, vier auseinandergenommene Feldkanonen der Mountain Brigade… und Zelte, Patronen, Konserven.«
»Wann?«
»In vier Tagen, Concho, schätze ich.«
»Und wer führt ihn?«
»Du fragst etwas viel«, murrte Forester beleidigt. »Benson und Hedge – sie hatten früher…«
»Ich weiß!« unterbrach ihn Concho Hurst kopfschüttelnd. »Ehrliche Leute, sicher, aber beide alt. Sie wickeln also euren Handel ab?«
»Ich weiß nicht, was du da von unserem Handel redest«, schnappte Forester zornig. »Benson und Hedge haben ein Privatgeschäft. Mehr weiß ich nicht! Und du tätest verdammt gut daran, noch weniger zu wissen als ich alter Narr. Ich habe gehört, daß die beiden heilfroh wären, wenn sie diese Art von Handel nicht mehr zu tun brauchten. Einen Nachfolger für sie hätten wir schnell, wenn dieser Bursche uns Garcia liefert und bei einigen Leuten, die mit Juarez’ Truppen ständig Verbindung halten, zusammenarbeiten könnte.«
Concho Hurst wechselte einen Blick mit Mattare, und der Indianer schien zu lächeln, während seine Hände ein Tier formten – so schnell, daß Forester nicht erraten konnte, um welches Tier es sich handelte, wenn er überhaupt begriff, was die Handbewegungen zu bedeuten hatten.
»Was will er?«
»Nichts – er meinte nur, jemand hier wäre ein schlauer Fuchs!« antwortete Concho auf Foresters hastige Frage. »Jim, wo erfahre ich den Namen der Leute, die für Juarez arbeiten und ständig Verbindung zu ihm haben?«
»Melde dich bei Colonel Rutherford in Fort McIntosh, Concho. Und dann… du wirst verteufelt auf dich achten müssen, Alter. Vielleicht ist der Preis sogar zu hoch, den du bezahlen könntest. Ich wollte, wir hätten Garcia mit zwei Schwadronen jagen können. Jetzt wird der Kerl irgendwo in den verdammten Bergen stecken. Und Spuren gibt es sicher nicht mehr. Nun, vielleicht bringen die Scouts doch etwas heraus.«
»Sind sie gut?«
»Kennst du Gonzales und Brown?«
»Nur Gonzales«, antwortete Hurst nachdenklich. »Schlau ist er schon. Vielleicht findet er Garcia, ehe ich dort unten bin. Vielleicht…«
Aber sicher war das nicht.
Ebenso konnte Garcia Gonzales finden.
*
Gonzales ging neben seinem Pferd, blieb aber jäh stehen und erstarrte.
»Was ist?« zischte Brown, der hinter ihm geblieben war. Die Hand des stämmigen Charles Brown umklammerte die Waffe, und er sah sich blitzschnell um. »Warum bleibst du stehen?«
»Sei ruhig!« flüsterte Gonzales leise. »Da war ein Licht!«
Er wendete nicht den Kopf, sondern starrte voraus auf einen Bergrücken, der sich im Mondschein dunkel vor ihnen in etwa einer halben Meile erhob.
»Ein Licht?« erwiderte Brown gepreßt. »Wo, zum Teufel?«
»Dort oben«, zischte Gonzales. »Schätze, es gibt dort nur Steine und keine Büsche mehr. Es war da…, aber ich sehe es nicht mehr.«
Charles Brown war einige Zeit während des Krieges als Scout für die Armee geritten. Er kannte Mexiko kaum, hatte aber im letzten halben Jahr genug Erfahrungen mit Gonzales gesammelt.
»Kein Irrtum?« fragte er mißtrauisch. »Was war es – Feuerschein wie von einem Campfeuer – oder?«
»Nur ein Licht… kurz und wieder weg!« murmelte Gonzales. »Sah aus wie ein Streichholz, das jemand anriß und auslöschte. Die Spur läuft auf den Bergrücken zu und mußte links durch den Einschnitt über den Kamm führen. Es war über dem Einschnitt, ich bin sicher.«
»Und was denkst du?« forschte Brown gepreßt. »Woher soll das Licht gekommen sein?«
Gonzales starrte immer noch auf die Erhebung über dem Einschnitt.
»Ein Posten«, vermutete er. »Könnte sein, daß sie dort einen Posten haben. Ich wette, daß wir richtig sind! Garcias Hazienda war keine dreißig Meilen von hier entfernt. Ich denke, hier kennt sich der Kerl besonders gut aus. An der Wasserstelle waren höchstens acht Männer – gerade genug, um einige Wasserschläuche zu füllen und drei Dutzend andere Männer und Pferde für einige Tage versorgen zu können. Wir reiten nicht weiter, Charlie!«
»Du meinst wirklich, daß da oben einer hockt?«
»Meine ich – yeah!« knurrte Gonzales. »Umgehen wir den Kerl!«
»Und warum hat er Licht gemacht?« wollte Brown wissen.
»Wird sich einen Zigarillo angesteckt haben, denke ich«, brummte Gonzales. »Immer vorsichtig – vielleicht war es ein Glück, daß wir den Kerl entdeckt haben. Wir müßten Garcia verdammt nahe auf den Pelz gerückt sein, aber ich will sicher sein, daß er es ist!«
Gonzales zog sein Pferd herum. Er kannte seinen Auftrag genau und wollte kein Risiko eingehen. Alles, was er zu tun hatte, war, daß er feststellen sollte, wo Garcia sich verkrochen hatte. Danach blieb ihm der Weg zu drei Männern übrig, von denen jeder in der Lage war, die Truppen von Juarez innerhalb von zwölf Stunden zu verständigen. Den Rest der Arbeit sollten die Leute von Juarez dann erledigen.
In weitem Bogen wich Gonzales nach Nordosten aus. Sie brauchten fast eine halbe Stunde, ehe sie über den Kamm des Bergrückens waren und unter sich eine dunkle, gähnende Tiefe ausmachten.
»Ein Tal – oder?« fragte Brown leise.
»Eine Senke«, antwortete Gonzales. Er blickte über das dunkle, kesselartige Loch hinweg. Es sah aus, als wäre das Loch, das etwa eine halbe Meile Durchmesser hatte, von hochragenden Felsen umgeben. »Wir müssen hinunter. Steig ab, Charlie!«
Brown tat es, und Gonzales führte sein Pferd nun am Zügel zwischen wenigen Büschen, aber schroffen Felsen durch. Es ging langsam bergab, die Büsche wurden zahlreicher, Kakteen reckten ihre Arme in die Höhe. Danach erreichten sie fast ebenen Boden, der sandig und nur ab und zu von Steinen bedeckt war.
»Gonzales…«
Gonzales blieb stehen und sah sich nach Brown um.
»Mann, wo wollen wir hier suchen?«
»Überall«, zischte Gonzales. »Ich wette, aus der Senke führen ein paar Täler durch die Berge. Und in einem wird der Halunke stecken. Wir müssen uns hart an den Felswänden halten, da ist das Gelände offener – wir sehen dann mehr. Ich sage dir, wir werden wieder Spuren finden – und diesmal werden es mehr sein!«
Er führte das Pferd mit der linken Hand und nahm in die rechte sein Gewehr. Brown, der bei der Armee mehr Erfahrungen für einen Kampf im Buschgelände gewonnen hatte, steckte sein Gewehr in den Scabbard. Er zog den Revolver, nahm ihn schußbereit in die Faust und starrte auf die Büsche.
Verdammt noch mal, dachte Charles Brown beklommen, zwischen den Büschen kann sich ein ganzes Regiment verstecken. Und liegen Garcias Halunken etwa hier…
An die Folgen wagte Brown nicht zu denken. Er sah sich immer wieder um, prägte sich den Weg ein, den sie gekommen waren. Vor ihm drang Gonzales beharrlich zwischen Büschen, Kakteen und Steinen unterhalb der Felswand vorwärts. Sie stießen auf ein kleines Seitental, auf Sandboden ohne jede Spur. Gonzales schüttelte stumm den Kopf und deutete nach vorn: »Weiter!«
Das war alles, was er sagte. Hinter ihnen blieb jener schmale Schlauch zurück, der irgendwohin in die Wildnis führte. Buschwerk und Kakteen nahmen Brown jetzt die Sicht. Brown lauschte ab und zu, aber er hörte nichts außer den Huftritten der Pferde.
Gonzales verschwand vor Brown hinter einigen Büschen. Sie schlossen sich hinter ihm – und Brown, der etwa sechs Schritt hinter Gonzales ging, sah sich gerade um.
*
In derselben Sekunde schrie Gonzales schrill und gellend los. Sein heulender, fürchterlicher Schrei traf Brown mit schreckhafter Gewalt.
Gonzales, dachte Brown, Gonzales…
Der gellende, durchdringende Todesschrei war das letzte, was Brown von Gonzales hörte. Brown hatte sich unter dem Zwang irgendeiner Ahnung gedreht. Und das war sein Glück!
Zwischen den schweren Schlagschatten der Kakteen und Büsche rechter Hand schnellten jäh zwei Schatten heraus. Sie waren noch vier Schritt entfernt, als Charles Brown sie sah und die Hand hochriß. Brown schoß binnen einer Sekunde zweimal. Sein Dragonerrevolver spie Feuer und Rauch den beiden Schatten entgegen.
Die erste Kugel traf den einen Mann mitten in den Bauch, und der Mann knickte mit gräßlichem, dumpfem Gurgeln zusammen.
Dem zweiten Bravado gelang es, bis auf anderthalb Schritt an Brown heranzuspringen, ehe ihn Browns zweiter Schuß in die Brust traf. Brown duckte sich – die Macheta, aus der schlaffen Hand des Getroffenen fliegend, wirbelte knapp über Charles Brown und das Pferd hinweg.
Im nächsten Moment sprang Brown, die zusammenbrechenden Bravados nicht mehr beachtend, mit einem Riesensatz in den Sattel. Er riß das Pferd augenblicklich auf die Hacken – und so sah er, daß aus den Kakteen der dritte Schatten hechtete. Der Mexikaner sprang das Pferd an, seine Macheta schlug zu – und wenn er auch Brown nicht traf, so drang die schwere Klinge doch in den Hals des hochsteigenden Pferdes ein.
In der gleichen Sekunde gab Brown dem Pferd die Hacken. Der Gaul sprang, er warf den Greaser, obwohl das Blut in einem dicken Strahl aus seinem Hals schoß, hintenüber und haargenau gegen eine der Kakteen, in deren Stacheln der Mexikaner schreiend hängenblieb.
Brown schaffte es noch, das Pferd zu drehen und anzutreiben. Es ging fast von allein mit Brown durch, machte ein paar wilde, bockende Sätze, die Brown aus der Gefahrenzone brachten. Dann knickte es ein, und Brown stürzte sich, den Revolver umklammernd, aus dem Sattel. Er fiel dicht neben dem Pferd in einen Dornbusch, überschlug sich, kam wieder auf die Beine und sah sich entsetzt um.
Irgendwo hinter den Büschen, durch die Brown und das Pferd gejagt waren, ertönten jetzt schrille, grimmige Wutschreie. Das Trappeln vieler Füße näherte sich.
Erst in dieser Sekunde kam die Angst über Charles Brown. Er riß mit der Linken das Gewehr aus den Scabbard des am Boden liegenden und mit den Hufen schlagenden Pferdes. Dann warf sich Charles Brown herum und stürmte durch die Büsche davon.
Während er um sein Leben rannte, schuf ihm die Bewegung Erleichterung. Die Angst verlor sich bis auf einen dumpfen Rest Furcht. Sein Verstand arbeitete wieder normal, und er raste im Zickzack, die Verfolger keine zwanzig Schritt hinter sich wissend, über das steinige Gelände, bis er vor sich das Maul des Seitentalschlauches auftauchen sah. Brown flog mit Riesensätzen über den Sand hinweg. An der Gegenseite jedoch, als er wieder Büsche erreichte, machte er auf dem Fleck kehrt. Seine Rechte stieß den Revolver in das Halfter. Brown hatte einen siebenschüssigen Spencer, einen Karabiner, den er nun hochriß, während er sich auf die Knie herabließ.
Er hatte die Waffe kaum im Anschlag, als er den ersten Bravado jenseits der Sandfläche aus den Büschen brechen sah. Die Zweige wippten, der Bravado schrie irgend etwas, gellend und schrill hallte seine Stimme über die weite Senke.
Hund, dachte Brown, als er abdrückte, du schreist nicht mehr!
Die Kugel packte den Greaser, schleuderte ihn um seine Achse, und er fiel strampelnd in die Büsche zurück. Die Zweige brachen knackend, der Mann verschwand zwischen ihnen, und der nächste Schatten machte im Brüllen von Browns Karabiner einen verzweifelten Satz zur Seite. Dann schlossen sich die staubgrünen Zweige und Blätter hinter dem Bravado.
Schreie gellten durch die Nacht Zweige brachen linker Hand. Brown federte hoch, duckte sich und rannte weiter. Er war sicher, daß er die Verfolger für einige Sekunden aufgehalten hatte. Kam er aus der weiten Mulde über jenen Hang hoch und heraus, den sie vor weniger als einer Viertelstunde herabgeritten waren, konnte er sich vielleicht retten.
Als Brown dicht vor der Kante war, knallte es unter ihm. Einen Moment nur bot er ihnen, aus dem Schatten der Felsen tauchend, ein Ziel. Zwei, drei Feuerzungen bleckten durch die Nacht, aber die Kugeln trafen nicht. Sie schlugen rechts und links von Brown gegen die Wand. Mexikaner schossen nicht besonders gut, und Brown war ein zu flüchtiger Schatten für sie, dazu noch über ihnen, so daß sie ihre Kugeln im Steilfeuer etwa einen Schritt über ihn setzten.
Mit zwei, drei Sprüngen erreichte Brown die letzte Rinne, verschwand für seine Verfolger hinter einem Felsvorsprung und warf sich dann hoch. Charles Brown griff nach der Kante, schwang sich herum und…
In dieser Sekunde sah er das breite, fast viereckig wirkende Gesicht vor sich. Er blickte den Bruchteil einer Sekunde in das Gesicht des Mexikaners. Es war über ihm – und neben dem Gesicht tauchte, wie eine flache Mondsichel schimmernd, die gebogene Klinge des Haumessers auf. Unfähig an den Karabiner zu kommen, den Brown über die Kante geschoben hatte, ehe er sich emporzog, nicht in der Lage, nach seinem Colt zu greifen, ließ Brown sich vor Schreck und Furcht los. Aber auch das war zu spät. Die Macheta knallte Charles auf den Kopf. Der Mexikaner hielt sie flach – und als sein Hieb traf, fiel Charles Brown abwärts. Er kollerte haltlos durch die Rinne.
Irgendwann schrammte sein Gesicht über kleine, spitzkantige Steine. Dann kam eine flache Mulde voller Sand und Geröll mit einem Busch an ihrem Ende.
Charles Brown prallte gegen die Zweige. Sie hielten ihn fest. Er lag still ein regloser Körper im Schatten des Busches, auf den klatschende, den Sand und das Geröll mahlende Sandalen zuhetzten.
»Bueno, Alfonso«, sagte jemand voller Haß und Wut über dem besinnungslosen Charles Brown. »Bueno… wir haben ihn!«
Sie hatten ihn – lebend! Er würde reden und ihnen erzählen, was er hier gesucht hatte. Sie brachten jeden zum Sprechen…
*
Der Indianer stand wie eine Statue auf den Steinen, das Gesicht dem lauen Südwestwind zugewandt. Er sog die Luft ein wie ein Tier, das eine Witterung mit dem Wind bekam und sie in sich aufnahm, um sie zu deuten.
Concho beobachtete ihn mit der Kühle und Gelassenheit eines Mannes, der abwarten konnte, der den Indianer kannte und sich voll und ganz auf ihn verlassen konnte. Es hatte nur einige Halte gegeben, an denen Mattare Concho fragend angesehen und um eine dieser seltsamen Aussprachen über den Zustand der Fährte gebeten hatte. Manchmal erriet auch der Indianer nicht, warum die Spur abzweigte oder sich teilte. Es gab immer wieder einige Möglichkeiten der Deutung, und es war besser sich über die wahrscheinlichste der Möglichkeiten abzustimmen.
Concho wartete – er schwieg. Mattare würde sich schon verständlich machen, wenn es sein mußte…
Im nächsten Augenblick hob der Indianer die Hand, deutete nach vorn und lief einfach los. Er überließ es Concho, die Pferde nachzubringen. Der Chiricahua war zu Fuß genauso schnell wie ein Pferd, wenn es über die Distanz von zwanzig oder mehr Meilen ging. Es mochte für andere unwahrscheinlich sein, aber der Chiricahua konnte ein Pferd auslaufen, wenn es sein mußte.
Concho Hurst folgte ihm. Er dachte an die beiden Fährten, die kaum noch sichtbar gewesen waren – schwache Fährten, auf die eine dritte gestoßen war. Sie hatten sich dahin geeinigt, daß zwei Männer hier geritten, ein dritter Mann auf Felsen gelegen und sie vorbeigelassen hatte, um ihnen darin zu folgen. Dieser dritte Mann hatte in ihrem Rücken, wahrscheinlich in die Höhlung seines Hutes, ein Streichholz angerissen, dann die Hutkrone verdeckt, so daß das Licht erlosch.
Blinkzeichen, dachte Concho, Blinkzeichen in der Nacht. Diese Burschen verstehen etwas davon, sich Signale zu geben. Es ist auch verdammt einfach. Verdecken sie den Hut, ist das Licht fort. Geben sie ihn wieder frei, sieht der nächste Posten den Leuchtpunkt in der Nacht. Sie könnten eine Meile voneinander entfernt sein und sich doch auf diese Weise verständigt haben.
Der Chiricahua hielt an. Sie waren bis auf Felsen über einem Einschnitt gekommen, und der Indianer bückte sich. Als er sich aufrichtete, zerbrach er ein Streichholz zwischen den Fingern.
»Hier war die andere?« fragte Concho. »Du meinst, er hat die Signale des ersten Postens gesehen und selber welche weitergegeben? Und unsere beiden Freunde – sie ritten also im Bogen nach rechts hier vorbei, doch nicht weit genug? Der Posten sah sie und blieb hinter ihnen?«
Der Chiricahua nickte, wandte sich nach rechts und lief los. Es dauerte keine acht Minuten, dann hielt er wieder an, das Gesicht in den Wind gewendet. Auch Concho zog die Luft ein. Die Hand des Indianers machte Bewegungen, als hätte sie sich in eine Vogelschwinge verwandelt. Danach stieß sie steil hinab. »Geier, Mattare?«
Wieder nickte der Indianer, stieg über Felsen in die Tiefe. Der Geruch wurde jetzt stärker, wurde so widerlich, daß sie aus der Windrichtung hasteten und dann von der Seite her durch Büsche und Kakteen an die Felswand zurückkehrten. Sie stießen auf das Maul eines Seitentales, auf Sand. Knochen – Eingeweide… bestialischer Gestank empfing sie.
Concho Hurst starrte auf die vom Mondlicht angestrahlte Grube, die man nicht tief genug und auch nicht fest genug zugestampft hatte. Zuerst waren Kojoten gekommen, deren Heulen nun aus einiger Entfernung zu hören war. Wahrscheinlich waren die Kojoten satt. Und die Geier fraßen nachts nicht.
Schweigend warf Concho dem Indianer das Lasso zu. Der stieg in die Grube, machte eine Schlinge, zog etwas heraus – den Rest eines Mannes, dessen Kopf ein Machetenhieb zertrümmert hatte.
»Du kanntest Gonzales, Mattare?« Der Indianer nickte. Es war Gonzales, es gab keinen Zweifel.
»Brown?« fragte Concho gepreßt. »Liegt der…«
Mattare schüttelte den Kopf, deutete nach Westen, lief, nachdem er das Lasso abgestreift hatte, wieder los.
Wir werden auch Brown finden, dachte Concho bitter. Sie machten nur einen Fehler, sie ritten zu lange auf der Fährte. Sie hätten von ihr abbiegen und nur ab und zu wieder in ihrer Richtung vorstoßen sollen, um sie nicht zu verlieren. Wir werden auch Brown finden.
Sie fanden ihn. Es war eine Viertelstunde später, als der Chiricahua auf die Brandstelle eines toten Feuers stieß. Asche in kleinen, in diesem Tal von keinem Wind zerstäubten Flocken – Knochen, Reste einer Mahlzeit von vielen Männern. Der Chiricahua war wie ein Tier, ein einsamer Wolf, der etwas suchte und sich auf seinen Instinkt verließ. Er lief nicht mehr, er ging auf die Büsche zu.
Sie haben ihn liegenlassen, dachte Concho – für die Geier! Haben sie nicht daran gedacht, daß Geier jedem Scout verraten, daß etwas geschehen ist? Oder… warum sonst – warum sonst haben sie ihn nicht wie Gonzales begraben?
Er starrte einen Moment auf den Körper hinab. Da war nur der Rumpf mit ein paar Kleiderfetzen, an denen zu sehen war, daß es ein Amerikaner gewesen war, der hier gelegen hatte. Der Kopf lag etwa zehn Schritt weiter. Die Geier hatten ihn hergetragen und außer den Augen nicht viel an ihm gefunden.
Concho Hurst fror leicht.
»Mattare…«
Der Chiricahua kam lautlos über die kahle Fläche der Lichtung. Er war schon weitergegangen, hatte sich umgesehen. Seine Hand deutete auf einen Fleck an den Büschen, der aussah, als wäre die Erde frisch umgegraben und dann festgestampft worden. Er begann auf seine Art zu reden. Für einen Fremden wäre es unverständlich geblieben, auch wenn er auf seine Hände und sein Mienenspiel geachtet hätte. Der Indianer redete mit dem ganzen Körper.
Drei Tote, sagte die Zeichensprache des Chiricahua, Mexikaner – Bravados. Brown muß sie umgebracht haben. Sie haben dort drüben gelegen, ehe man sie begrub – drei Männer. Es war Brown, verstehst du, Concho? Sie haben ihn darum nicht begraben. Sie tun das nie, wenn jemand ihre Freunde, Vettern oder Brüder getötet hat. Dann lassen sie den Mörder für die Geier liegen. Sie fingen ihn und banden ihn an vier Pflöcke, dann folterten sie ihn – nicht sehr. Danach banden sie ihn los und ließen ihn laufen!
»Was? Sie ließen ihn laufen? Warum das?«
Ich weiß nicht, Concho. Es hat einen Zweikampf gegeben – dort, wo er liegt. Ein Mann ist ihm nachgerannt. Er hat ihm erst den Arm zerschlagen, danach den Hals… und dann ließ er ihn liegen für die Geier!
»Warum haben sie ihn nur wieder losgebunden – verstehst du das, Mattare?«
Nein, sagte der Chiricahua, seine Finger bewegten sich. Sie hätten ihn töten können, als er gebunden war. Komm mit, ich muß dir etwas zeigen.
Es war unheimlich – selbst für Concho, der den Chiricahua nun fast elf Jahre kannte. Der Indianer hatte die Stimme verloren, aber all seine anderen Sinne hatten sich zur Perfektion entwickelt. Manchmal überraschte er Concho damit, daß er ihn nur ansah und – seine Gedanken erriet!
Jetzt lief er vor ihm her. Er sagte mit der einen Hand, daß sie hier niemand zu fürchten hätten, die Bravados wären alle längst fort. In einer Mulde blieb er stehen. Vor ihm lag ein runder Stein am Boden – es gab ein paar Eindrücke hier. Der Chiricahua bückte sich, hob etwas auf. Es waren einige lange schwarze Haare.
»Eine Frau, Mattare?«
Ja, eine Frau, Concho. Sie war hier… mit einem Mann, ein großer Mann, größer als Mexikaner es sind, ein blonder Mann – sieh her, er trug einen Revolver wie du – an der Hüfte. Hier lag er… mit der Frau.
Concho Hurst starrte auf den Boden. Er nickte nur.
»Und – was meinst du?«
Garcia, denke nach… Garcia hat eine Schwester, Concho.
»Tatsächlich, ich erinnere mich«, sagte Concho überrascht. »Du meinst, sie war das hier? Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, daß sie Brown losbanden – oder bat der Amerikaner darum?«
Vielleicht sie – vielleicht der Amerikaner. Wir sollten sehen, wo sie geblieben sind – die Männer und die Frau, Concho!
Der Chiricahua wartete keine Antwort ab. Er stieg auf sein Pferd, das Gesicht ausdruckslos. Seine linke Hand griff, während sie davonritten, in die Satteltasche. Er bevorzugte getrocknetes Fleisch. Er zog sein Messer, nahm das Fleisch aus der Satteltasche, schnitt mit diesem kleinen, aber haarscharfen Skalpmesser, indem er zuerst in das Fleisch biß, blitzschnell vor seinen Lippen her. Die Portion, die er dann kaute, war genau mundgerecht.
Concho sah weg – er hatte das Gefühl im Magen, zuviel gegessen zu haben und gleich brechen zu müssen.
Der Chiricahua hielt plötzlich an, blickte nach dem Himmel, den Sternen…
»Mattare, sie sind nach Südosten geritten, siehst du das – immer nach Südosten! Mattare – Brown – sie haben Brown ausgefragt. Erinnere dich – Rutherford sagte etwas. Mattare, Brown hat gewußt, daß zweihundert Gewehre nach Monterrey gebracht werden sollen. Mattare, das sind sie – und sie haben eine Teufelei vor, wette ich. Eilig hatten sie es nicht besonders. Und dennoch, wenn sie diese Richtung beibehalten haben, dann sind sie etwa zwischen Paras und Cerralvo. Sie haben drei Tage Vorsprung, sie sind längst dort. Der Transport geht doch…«
Der Chiricahua stieß einen dumpfen Laut aus.
Concho nickte und ritt jäh wieder an. Jetzt ließ er das Pferd laufen und riß das Ersatzpferd heftig mit. Der Chiricahua fegte an seiner Seite vorwärts.
»Mattare – denke an Garcia und das erbeutete Geld. Er kann sich hundert Männer dafür kaufen. Für zwei Dollar bekommt er jeden herumlungernden Peon in seinen Dienst. Er hat immerhin die Waffen der Wageneskorte und die von Brown und Gonzales. Das sind mindestens fünfzehn Gewehre mehr und die gleiche Anzahl Revolver. Der Kerl kann also dreißig Mann sofort bewaffnen. Und für zweihundert bekäme er Gewehre, wenn… der Teufel, das ist es! Der Transport muß in dieser Nacht über die Grenze gehen. Morgen ist er in der Gegend von Paras. Dann müßten sie aber nördlicher geritten sein. Sollten nicht Juareztruppen den Transport von Cerralvo aus sichern? Das käme mit der Richtung hin, doch in Cerralvo liegen zuviel Juareztruppen, der Kerl Garcia wird doch nicht so wahnsinnig sein und Cerralvo angreifen? Dazu hat er nicht genug Leute – niemals!«
Der Chiricahua schüttelte den Kopf. Seine Hand deutete in die Luft. Sie beschrieb wieder die Linie der Grenze, dann einzelne Punkte – die Ansiedlungen, die Städte – Cerralvo – fuhr nach Osten.
»Loma Bonita – Don Sebastiano, Mattare? Was sagst du? Natürlich, sie fahren ja nicht über Cerralvo, sie meiden wegen der Banditen die Straßen und fahren zur Hazienda Don Sebastians – oder in ihre Nähe. Dann müßten die Truppen sie dort treffen – meinst du das?«
Der Indianer nickte heftig und deutete nach Nordosten.
»Nein – nein«, sagte Concho scharf. »Du vergißt etwas – an den Wagen sind zwanzig eisenharte Männer, alle mit Kriegserfahrung und modern bewaffnet. Denk an die drei Toten – wieviel Männer waren dort hinten in der Senke? Ich schätze, etwa fünfzehn!«
Der Chiricahua nickte, und Concho sagte: »Ja, einige sind nicht dort gewesen. Teufel, sollte Garcia vielleicht… Mattare, wenn der Kerl nicht im Camp gewesen ist? Was ist, wenn er schon unterwegs gewesen ist, um Männer anzuwerben? Das würde erklären, warum nur fünfzehn Mann im Camp waren. Mattare, er braucht mindestens fünfzig Mann, wenn er die Wagen erwischen will – und von denen wird er die Hälfte verlieren, stellt er es nicht verteufelt geschickt an. Vielleicht weiß er von Brown, wie gut die Männer an den Wagen sind. Es sind immerhin einige Männer meines Vaters dabei, die Mexiko kennen. Garcia ist schlau genug, sich auszurechnen, daß er vielleicht sogar mit dreifacher Übermacht angreifen muß, wenn er die Wagen haben will. Was braucht er also? Männer! Und Zeit, denn er kann für diese Sache keine gewöhnlichen Knechte nehmen, er braucht gute, kampferfahrene Männer. Mattare, wir könnten es niemals bis morgen schaffen, Cerralvo zu erreichen, wir brauchen den ganzen Tag und die halbe Nacht, um auf das Gebiet Loma Bonitas zu kommen. Es wäre in jedem Fall zu spät.«
Der Indianer senkte den Kopf, er dachte nach Dann sagte er zu Concho: Wir reiten so schnell wir können nach Cerralvo. Wir reiten zu den Juareztruppen und warnen sie. Sie müssen früher aufbrechen, um die Wagen zu sichern. Vielleicht – vielleicht fangen sie dann Garcia!
»Großer Gott!« keuchte Concho Hurst bedrückt. »Irre ich mich, kommen wir in jedem Fall zu spät. Denkt sich Garcia eine Teufelei für die Wagen aus, könnte er den Überfall auch mit weniger Leuten ausführen. Unsere einzige Chance ist, daß er kein Risiko eingehen will und sich erst sicher fühlen wird, wenn er in der Übermacht ist, um anzugreifen. Los, Mattare, reiten wir!«
Er jagte sein Pferd scharf an Sie kamen aus den Bergen, es ging bergab – und sie mußten jede Gefällstrecke ausnutzen, um die Pferde in den Hügeln zu schonen. Dennoch glaubte Concho nicht daran, daß sie es schaffen würden. Es war zu weit, einfach zu weit.
Zweihundert Gewehre für Monterrey. Und Kanonen.
Sie würden niemals in Monterrey ankommen!
*
Der Hügel war steil – und als Felipe ihn heraufkam, tat er es auf Händen und Füßen wie ein vierbeiniges Ungeheuer. Charlton hatte den Mexikaner bereits vor fünf Minuten unten im Tal auftauchen sehen. Dort lagerten fast sechzig Mann, die Garcia zusammengebracht hatte. Wenn Charlton an diese Männer dachte, dann auch daran, daß der größte Teil unerfahren gewesen war, und kaum schießen konnte.
Louis Charlton hatte den wilden Strolchen binnen zwei Tagen beigebracht, wie sie zielen und treffen mußten. Es war eine verdammt mühselige, nervenaufreibende Arbeit gewesen. Mexikaner schossen gern und viel, in der Hauptsache aber kam es ihnen auf den Krach an. Je lauter ein Gewehr knallen konnte, desto größeren Spaß hatten diese einfachen Burschen, aber – von zehn Schüssen trafen höchstens zwei ein Scheunentor aus fünfzig Schritt Entfernung.
Charlton warf Garcia einen Blick zu. Der General, wie er sich nannte, rutschte nun zurück. Er hatte hinter dem Hang gelegen und durch das Gras einige Knechte der Hazienda beobachtet. Es waren vier Mann, ein bewaffneter Wächter, ein Neuwagenfahrer und zwei Mann, die das Heu auf den Wagen gabelten.
Er ist verrückt, dachte Charlton, der Bursche hätte die Kolonne schon zwischen Palma und Paras angegriffen. Und das mit diesem Haufen Luftlochschießer. Wenn ich nicht Maddalenas Unterstützung gehabt hätte…
Charlton war absolut sicher, daß Garcia jetzt vielleicht längst tot irgendwo von den Geiern abgenagt worden wäre, hätte er seinen ursprünglichen Plan ausgeführt. Nach einem Blick auf die Wagenkolonne, die sie bereits gestern gesehen hatten, hatte Charlton seine schlimmsten Vermutungen bestätigt gefunden. Zwar gab es etwa sechs Männer bei dem Transport, die aus Mexiko stammten – vierzehn jedoch waren Texaner. Und alle waren bis an die Zähne bewaffnet. Jeder Mann trug zwei, mancher sogar drei Revolver und zwei Gewehre. Charlton hatte auch einige Schrotflinten auf den Wagen stehen sehen – und danach zu Garcia gesagt: »Siehst du es jetzt? Erstens sind das Texaner. Zweitens haben sie alle den Krieg mitgemacht. Drittens trifft bei denen jede Kugel. Du wärest vielleicht an die Wagen herangekommen, aber diese Burschen hätten dich zwei Drittel deiner Männer, wenn nicht alle – und dich das Leben gekostet.«
»Nun gut«, erwiderte Garcia mürrisch. »Du hast recht behalten. Es war doch gut, daß du diesen Hohlköpfen beigebracht hast, beim Schießen auch etwas zu treffen. Wenn wir wieder bei den anderen sind, nimmst du sie dir noch einmal vor. Sie müssen so gut treffen, daß sie diese Texaner zuerst von den Wagen herabschießen. Wir brauchen einen günstigen Platz für den Überfall. Und wir werden ihn finden.«
Charlton lächelte bitter. Garcias Überheblichkeit fiel ihm immer mehr auf die Nerven. Dieser Narr erging sich bereits in Plänen über die zukünftige Verwaltung der Provinz. Dabei hatte er noch nicht einmal den Transport in seiner Gewalt.
Zudem war Maddalena am Morgen mit Ramon, einem verschlagenen, listigen Burschen, nach Cerralvo geritten, um festzustellen, ob dort eine starke Einheit Juareztruppen lag. Brown hatte davon gesprochen, daß von Cerralvo aus die Eskorte der Juareztruppen zu den Wagen stoßen sollte. Und Maddalena würde schnell herausfinden, wann diese Eskorte abging, wie stark sie war und was dann noch an Truppen in Cerralvo verblieb. Das Mädchen fehlte Charlton, aber er sah es nun auftauchen, als Felipe schnaufend den Hang heraufgekommen war. Maddalena erschien allein. Sie hatte Ramon irgendwo zurückgelassen. Als sie zum Hang hochsah, hob sie die Hand und winkte. Ihr Lächeln traf Charlton, und er fühlte sich plötzlich besser.
»Don Felice!« keuchte Felipe. »Die Kolonne kommt, sie fährt hierher. Dieser Gringo Brown hat nicht gelogen. Noch immer keine Eskorte. Sie müssen sich ziemlich sicher fühlen, denn sie fahren seit dem Morgen!«
Sonst bewegte sich der Transport nur nachts. Er war aber schon zu weit im Land, um noch von mexikanischen Grenzbanditen bedroht zu werden. Garcia grinste breit. Er klopfte Felipe anerkennend auf die Schulter.
»Gut – bravo, Felipe. Wie weit sind sie entfernt?«
»Zweieinhalb Stunden, dann werden sie hier sein«, antwortete Felipe. »Sie müssen diesen Weg nehmen, es führt kein anderer zur Hazienda, Don Felice!«
»Na, Louis, was sagst du?« rief Garcia leise, aber triumphierend. »Keine Eskorte, gut, was? Wir werden sie empfangen und alle erschießen! Maddalena! Maddalena, komm schnell herauf. Gute Nachrichten!«
Maddalena kam den Hang herauf, sah aber nur Charlton an und warf sich erschöpft, verschwitzt und doch glücklich in seine Arme.
»Ich reite nie wieder ohne dich fort«, sagte sie müde. »Die ganze Zeit habe ich an dich gedacht!«
»Valgame dios!« fluchte ihr Bruder finster. »Die ganze Zeit denkst du an ihn, he? Und dein Auftrag?«
»Mein Auftrag – mein Auftrag!« fauchte sie ihn an. »Ich habe ihn schon nicht vergessen! In Cerralvo liegen nur neunzig Juaristas. Davon sollen dreißig nach der Hazienda reiten und den Transport sichern. Sie brechen so auf, daß sie unmöglich vor Einbruch der Dunkelheit hier sein können. Ich habe Ramon zurückgelassen, damit er aufpaßt, wann sie kommen und wie schnell sie reiten. Er sagt uns Bescheid. Na, bist du zufrieden?«
»Auch gut, sehr gut!« lobte Garcia. Er schlug sich vergnügt auf die Schenkel und lachte breit. »Ah, wir werden leichtes Spiel haben! Komm zu mir, Maddalena – du hast Louis noch lange genug. Sieh dir an, was ich mir ausgedacht habe.«
Sie murrte, kniff Charlton in den Nacken und ging dann zu ihrem Bruder. Er zog sie mit bis hinter die Hügelkuppe und deutete nach Westen.
»Sei vorsichtig, wenn du durch das Gras blickst«, warnte er sie. »Nicht, daß uns dieser Wächter bemerkt. Ah, du hast gute Arbeit geleistet. Eine Frau fällt nicht auf in einer Stadt, ich wußte es. Hast du jemand gesehen, den du kanntest?«
»Niemand – es sind viele Fremde in Cerralvo. Die meisten Leute, die wir kannten, sind tot«, gab sie zurück, schob das Gras behutsam zur Seite und lag dann still. »Sie machen Heu? Ah, links der Hohlweg, meinst du dort? Ein guter Platzt«
»Ja, ja!« stieß Garcia hervor. »Sieh dir an, wie sie arbeiten, diese Peones, diese Faultiere, diese stinkenden. Sie werden noch zwei Stunden zu tun haben, um den Wagen zu beladen. Ah, das sollten meine Knechte sein, ich würde sie auspeitschen. Diese stinkenden Faulpelze verderben mir noch alles. Uns bleibt nachher höchstens eine halbe Stunde, um den Hohlweg zu besetzen. Wir müssen warten, bis diese Faultiere fort sind.«
Charlton war ein Stück höher gestiegen. Er wußte, daß Garcia viel auf die Meinung seiner Schwester gab. Sie war kaltblütiger und auch klüger als er!
»Müssen wir warten?« fragte Maddalena Garcia einen Moment später. »Bruder, wenn sie ohnehin so faul sind, wird man sich auf der Hazienda kaum Gedanken machen, wenn sie später als vorgesehen kommen – oder früher, wie?«
Sie sah Charlton an und blinzelte ihm zu.
»Was soll das? Was meinst du?« fragte Garcia mürrisch zurück. »Früher oder später? Sag gefälligst, was du denkst!«
»Der Heuwagen« erwiderte Maddalena spöttisch. »Du bist ein gebildeter Mann, du solltest es sein, Bruder. Du willst den Transport in den Hohlweg kommen und die Fahrer dann erschießen lassen, richtig?«
»Natürlich«, sagte Garcia verärgert. Er vertrug es nicht, wenn sie spottete. »Das ist die einfachste Methode. Wir schießen sie alle tot!«
»Und das hört man auf der Hazienda, wie?«
»Pah, sollen sie es doch hören!« knurrte Garcia wütend. »Sie werden kommen und nachsehen, aber wir sind schneller – wir reiten ihnen entgegen und schießen auch sie noch über den Haufen. Dann stürmen wir die Hazienda, versorgen uns und…«
»Und – und – und!« höhnte sie. »Hast du Louis um seine Meinung gefragt?«
»Wozu? Ich befehle hier! Ich – General Felice…«
»Louis…«, unterbrach sie ihn und blickte den Amerikaner an.
Sie sah zu Charlton und kroch zurück. Mit angezogenen Knien blieb sie sitzen und lachte leise. Garcia fluchte zornig.
»Louis, hast du den Wagen gesehen?«
»Nein«, gab Charlton zurück. »Felice hat seinen Plan. Was soll ich mich einmischen?«
»Louis, wenn wir uns die vier Kerle dort vorn greifen und zehn Mann im Heu verstecken, einen der Kerle zwingen, uns zur Hazienda zu fahren…«
»Merkst du es?« japste Garcia. »Sie ist eine Teufelin! Ich habe es dir immer gesagt, sie ist eine Teufelin geworden! Was war sie früher für ein harmloses Kind! Und jetzt? Ah, sie hat den Teufel im Kopf! Sie ist gefährlich wie eine Purpurnatter, listig wie ein Indianer… Teufel, sie hat eine Idee!«
»Eine Idee?« spöttelte Maddalena. »Das ist keine Idee, das ist ein Plan, du Narr! Und er ist zehnmal… ach was, hundertmal besser als deiner, Bruder! Wir werden diese vier Hohlköpfe fangen. Den Fahrer des Heuwagens brauchen wir lebend, verstanden? Gleich neben dem Heufeld ist ein Maisfeld, eh? Felipe, du bekommst Arbeit!«
»Si, Patronata!« grinste Felipe. »Was soll ich tun?«
Maddalena begann zu kichern, hielt sich den Leib und sank um.
»Oh, oh«, gluckste sie danach. »Das wird ein Spaß! Louis, du kommst mit, du mußt den Spaß erleben! Ich wette, diese Hohlköpfe werden gar nicht merken, daß wir es sind, die ihnen…«
»Por dios«, stöhnte Garcia, als sie wieder kicherte und sich die Lachtränen aus den Augen wischte. »Por dios, was ist aus ihr geworden? Meine kleine, scheue Schwester – sie hat den Teufel im Gehirn!«
Ja, dachte Charlton, so ist es, aber…, ich komme nicht los von ihr. Es wird nie wieder eine Frau wie sie in meinem Leben geben!
*
Der Mann auf dem Pferd fuhr zusammen, als hätte ihm jemand mit voller Wucht in das Kreuz getreten. Der zweite Peon auf dem Heuwagen – er stand oben und packte das Heu auf – fuhr herum, verlor um ein Haar den Halt und wurde grau vor Schreck.
»Madonna!« ächzte der Wärter. Er riß sein Pferd herum und das Gewehr zur Seite, daß die Mündung auf das Maisfeld zeigte. »Ein Jaguar – ein Jaguar!«
Das Quarren kam, ein Fauchen, dann ein Geraschel und wieder ein Quarren. Sie standen nun alle vier wie gebannt und starrten auf das Maisfeld. Keine dreißig Schritt vom Rand des Feldes entfernt bewegten sich die Maisstauden leicht. Das Quarren und Fauchen blieb.
»Santa Maria!« stieß der Wächter hervor. »Paßt auf, das sind zwei. Vorsicht!«
Der eine Peon hielt die Heugabel abwehrbereit erhoben. Der Fahrer, der das Heu aufgepackt hatte, griff jetzt nach der Peitsche. Der vierte Mann machte zwei lange, vorsichtige Schritte und schnappte sich die Sense.
»Gustavo, wo ist es?«
»D-dddda!« stotterte der Fahrer. »Ich sehe, wie sich die Maisstauden bewegen!«
Ein Quarren – ein Plärren fast, dann ein Fauchen.
»Du – du, Umberto, das – das sind zwei, aber es müssen junge Jaguare sein. Hör doch, sie quarren ja noch, die können nicht mal richtig fauchen!«
»Junge Jaguare?« fragte der Wächter mißtrauisch. »Bist du sicher?«
»Si, si, Amigo. Sie quarren genauso wie die zwei, die Don Sebastiano vor ein paar Jahren mitbrachte von der Jagd. Ich weiß es genau, sie konnten auch nicht richtig fauchen. Es sind ganz kleine!«
»Bestimmt?«
Der Fahrer rutschte vom Wagen herab. Der Mann mit der Sense ging mutig zwei Schritt vorwärts. Jener mit der Heugabel wollte zeigen, daß er Mut hatte, und überholte ihn. Der Wächter ritt bis auf zehn Schritt an den Rand des Maisfeldes heran.
Sie hörten, wie es raschelte, quarrte, plärrend fauchte.
»Du, Gustavo, aber – wo sollen die hergekommen sein? Und wenn die Mutter dabei ist, was dann?«
»Dann reißt sie mit den Jungen aus, wenn wir Krach schlagen und in das Feld gehen. Sie wird fauchen, gleich, sage ich. Zwei kleine Jaguare, wenn wir die hätten, eh?«
»Und wenn uns die Alte anfällt?«
»Pah, wozu hast du dein Gewehr?«
»Aber es kann gefährlich für euch werden.«
»Du hast ja nur Angst, in das Feld zu reiten, Umberto, du hast Angst!«
»Habe ich nicht!«
»Hast du doch!«
»Damnato, habe ich nicht! Ich reite vor, ihr kommt mir nach. Mal sehen, wer zuerst wegrennt! Wetten, daß du Angst hast?«
»Ich habe keine Angst. Ich weiß genau, daß es ganz kleine Jaguare sind. Wenn die Mutter bei ihnen wäre, hätte sie sie längst weggeschleppt, weil Menschen in der Nähe sind. Das sind zwei ganz kleine Jaguare, und sie sind allein, ich wette, sie haben sich verlaufen.«
Umberto sah sich um. Er hielt den Finger am Abzug. Die anderen Männer traten hinter das Pferd. Dann ritt Umberto an. Als er die ersten Maisstauden erreichte, brach ihm der Angstschweiß aus.
Aber Umberto ritt weiter, kam Schritt für Schritt tiefer in das Feld mit den hohen grüngelben Maisstauden. Zwanzig Schritt mochte er geritten sein – er hörte das Quarren und Fauchen noch. Dann kam es mit jäher, schreckhafter Plötzlichkeit… Ein dumpfes Grollen, ein wildes Fauchen – scharfes Geraschel. Maisstauden schnellten auseinander, etwas raste scheinbar weg, stürmte tiefgeduckt durch den Mais.
Die drei Mann hinter dem Reiter warfen sich brüllend vor Angst herum. Umberto wollte schießen, aber er sah kein Ziel.
»He, ihr Feiglinge!« schrie er, als er seine Freunde in panischer Furcht umdrehen und durch den Mais auf die Heuweide zurennen sah. »He, sie ist weg! Sie ist weg! Was rennt ihr denn, ihr Feiglinge?«
Sie brachen wie ein aufgeschrecktes Rudel Wildschweine durch die Maisstauden. Zwanzig Schritt weit mußten sie laufen. Der Mais war wie eine Mauer vor ihnen.
»Ihr Feiglinge, bleibt doch stehen!« Umberto mußte lachen.
Er lachte keine zwei Sekunden.
Seitlich hinter ihm tauchte jemand über die Maiskolben und hob den Arm. Dann wirbelte das Messer etwa drei Schritt weit durch die Luft, ehe es starr in der Schwebe blieb und so auf Umbertos Rücken zuzischte.
Umberto sah die Nachmittagssonne ganz groß und golden vor sich am Himmel. Dann verdunkelte sich die Sonne, wurde so rot wie bei ihrem Untergang. Plötzlich liefen Strahlen nach allen Seiten auseinander.
Die Sonne zerfließt, dachte Umberto, die Sonne zerfließt…
Da war ein Brennen, es erfaßte den Rücken, lief hoch bis in seinen Nacken. Feuer schlug ihm jäh in den Hinterkopf. Das war das letzte, was er spürte. Danach fiel er in den Mais und begrub sein Gewehr unter sich.
Der eine Mann rannte, warf die Sense fort, um schneller zu sein.
In diesem Augenblick kreischte Gustavo mit überkippender, entsetzter Stimme: »Da – da ist…«
Gustavo sah den Schatten auf sich zufliegen. Er tauchte genau neben ihm hoch und hielt einen Stock in den Fäusten. Es war nur kein Stock, aber Gustavo sah das zu spät. Das Gewehr wirbelte herum – der Kolben traf Gustavo am Kopf. Er schrie nicht mehr, er fiel bereits.
Die anderen beiden Peones waren rechts von ihm gewesen. Sie dachten, als er schrie, daß der Jaguar es war, der ihn so losheulen ließ. Sie sahen beide nach links, auch der Mann mit der Forke. Dann schrie der Mann einmal spitz und hoch. Er schrie, weil aus dem grüngelben Maisgewirr ein Gewehrlauf stach. Am Gewehrlauf steckte jedoch das Bajonett.
Der Mann mit der Forke lief mitten in das Bajonett hinein und blieb stehen. Er stierte mit herausquellenden Augen, während der Schmerz wie eine glühende Sonde durch ihn fuhr, auf das Gewehr und den gebogenen Handsteg des Bajonetts. Dann fuhr das Gewehr zurück, und er sah noch eine Sekunde zwei Hände, ehe er nach vorn kippte. Dabei gruben sich die Zinken der Heugabel in den Boden. Er hielt sich mit beiden Händen am Stiel der Gabel fest. Seine Hände glitten tiefer, und er fiel schließlich an der Gabel vorbei in den Mais hinein.
Links neben ihm warf sich der Mann, der die Sense weggeschleudert hatte, herum. Er sah zwei Schatten aus dem Mais hechten. Der eine prallte ihm in die Seite. Hände umklammerten seine Rippen. So fiel er und schrie, bis die Macheta im Herabsausen einige Maiskolben abtrennte. Sie kollerten über seinen zuckenden Körper.
»Bueno«, sagte Felipe. Er stand auf und kicherte vor sich hin. »Zwei kleine Jaguare, eh? Ganz kleine, harmlose Jaguare, eh? Schleift den Kerl, diesen Gustavo, hinaus. Er muß uns fahren! Patronata, hörst du? Wir haben ihn!«
»Und die anderen, Felipe?«
»Dios«, lachte Felipe breit. »Warum sind sie neugierig und wollen ganz kleine Jaguare fangen, wenn sie nicht wissen, ob die Alte bei ihnen ist? Jaguar hat sie gefressen!«
»Der Jaguar hat sie gefressen!« stieß Garcia am Hohlweg aus. »Jaguar… eh? Jetzt weiß ich, wie ich mich nennen werde. El Jaguar… ja, so werde ich mich nennen… El General Jaguar!«
»Oh…, oh!« stöhnte Maddalena. »Der Jaguar… der Jaguar hat sie gefressen! Was für ein Spaß! Diese Hohlköpfe… Der Jaguar hat sie gefressen!«
Sie begann zu lachen und kauerte, blind vor Lachtränen, am Boden. Es war ihr Plan gewesen.
Ihr Plan, dachte Charlton, mein Gott – das ist für sie noch ein Spaß, sie lacht sich krank.
»El General Jaguar«, japste Maddalena, lachte noch wilder, lachte so heftig, daß sie strampelte und mit den Händen gegen den Boden schlagen mußte. »El General Jaguar… oh, oh, ich platze! El Jaguar…!«
Garcia fluchte, weil er wußte, daß sie jetzt über ihn lachte. Er würde in ihren Augen niemals so gefährlich wie ein Jaguar sein, nie so schlau.
»Diese Teufelin!« gurgelte Garcia wütend. »Sie macht mich noch verrückt – diese Teufelin!«
Drei Tote, dachte Charlton – und sie lacht.
In dieser Sekunde wußte er, daß sie auch lachen würde, wenn sie ihn umbrachte. Verließ er sie eines Tages, war er nicht schnell und weit genug fort, ehe sie die Männer loshetzen konnte – fing sie ihn ein, würde sie ihn hassen – und töten, aber dabei lachen wie jetzt!
Charlton fror in der heißen Sonne.
*
Felipe, der Mann, der hundert Stimmen nachmachen konnte, saß im Heu wie die anderen. Sie hatten die Heuladung in der Mitte des Wagens zu einer Mulde geformt und drei Männern die Hüte der toten Peones aufgesetzt. Aus hundertfünfzig Schritt Entfernung hatte Garcia mit Charlton und Maddalena die Mauer der Hazienda betrachtet.
Es gab ein halbes Dutzend kleinerer Hütten außerhalb der Mauer, in denen die Peones mit ihren Familien wohnten. Die Hazienda Loma Bonita lag inmitten von Baumwollbäumen und Zedern, ein riesenhafter Gebäudekomplex, an dem man Spuren der Zerstörung sah. Hier hatten die kaiserlichen Truppen sich mit den Rebellen von Benito Juarez geschlagen. Don Sebastiano de Fiorentes hatte vom ersten Tag an auf der Seite von Juarez gestanden und seinen Besitz einige Monate verlassen müssen.
Als er zurückgekommen war, hatte er viele der Hütten und einen Flügel des Haupthauses zerstört vorgefunden. Die Verbindungen dieses alten, aus einem kastilischen Grandengeschlecht stammenden Mannes reichten bis weit in die Vereinigten Staaten, und als der Befreiungskrieg in Mexiko ausbrach, hatte er den größten Teil seines Geldes bereits nach El Paso del Norte gebracht. So konnte er die teilweise zerstörte Hazienda binnen eines Jahres wieder aufbauen.
Felipe hatte die Aufgabe übernommen, den Wagenfahrer zu bewachen, und er tat es auf seine Art. Der Mann saß unmittelbar vor Felipe. Und Felipe redete leise auf ihn ein. Er konnte es unbesorgt tun, obgleich sie sich dem großen Tor in der Haziendamauer näherten. Neben dem Tor stand ein Wächter wie üblich. Die Hazienda wurde Tag und Nacht bewacht. Es gab zuviel streunende Banden, und auch Don Sebastiano hatte in einem Raum des Hauses eine Reihe Gewehre stehen. Seine Peones waren darauf eingestellt, binnen einer Minute zu den Waffen zu greifen.
Felipe schob das Heu mit der linken Hand zur Seite. Er sah durch die trockenen Halme den Posten und wußte, daß der Mann viel zu tief neben der hoch aufgetürmten Heuladung stand. Der Wächter sah wohl Hüte auf dem Wagen, aber… die Männer sah er nicht.
Auf dem Wagen saßen vierzehn Mann – und es waren die besten, die Felice Garcia hatte. Sie hockten dicht bei dicht, schwitzend und schweigend, die Gewehre griffbereit im Heu.
»Hermanolita… mein Brüderchen…«, zischelte Felipe katzenfreundlich, indem er dem Fahrer das Gewehr fester auf die Niere drückte. »Hermanolito… muy amigo… mein lieber Freund, mein liebes Brüderchen, wenn er dich anredet und du machst etwas falsch…, hörst du, Brüderchen, geliebtes…, dann werde ich dich nur anschießen. Nein, nein, glaube dem guten Felipe – ich werde dich doch nicht umbringen…, wo du doch mein liebes Brüderchen bist, eh? Ich schieße dir nur die Niere entzwei, nur die eine Niere, damit du auch Freude hast an den Schmerzen. Aber, das werden erst die Anfangsschmerzen sein, verstehst du? Ich werde mich doch nicht um das Vergnügen bringen, dich ganz langsam vom Leben zum Tod zu befördern. Es gibt da schöne Mittelchen, verstehst du?«
Der Mann würgte – sie hatten ihn mit drei Mann gehalten, und einer hatte ihm so lange den Fuß in den Leib getreten, bis er alles gesagt hatte, was sie wissen wollten. Sie kannten sich nun auf der Hazienda so gut aus, als hätten sie hier zehn Jahre verbracht.
»Du mußt lächeln, Brüderchen«, zischelte Felipe. »Wenn du nicht lächelst, du Ausgeburt des Teufels, dann lernst du mich kennen. Wir ziehen dich später nackend aus. Dann spitze ich Stöcke an – und weißt du, was ich mit denen dann mache? Ah, du wirst jubeln und singen… so laut, daß man es in Ciudas Mexiko hören könnte. Lächle, du Hundesohn, sonst schneide ich dir erst die Zunge heraus, ehe ich mich mit deinen Augen beschäftige!«
Der Mann vor Felipe zitterte, aber das fiel bei dem Schwanken des Wagens und dem Gerumpel, das ihn erzittern ließ, als er über die groben Steine auf das Tor zufuhr, nicht auf.
Dort setzte sich jetzt der Wächter in Bewegung. Er öffnete das schwere Bohlentor, das erst seit drei Jahren an Stelle des kunstvollen, schmiedeeisernen Tores hier in der Mauer saß und einen halben, neuen Flügel bekommen hatte. Dann trat der Wächter zur Seite.
»Eh, Gustavo, fertig? Ihr seid schnell fertig geworden, eh?«
»Si, si«, versicherte der Peon und würgte, konnte aber von dem Wächter nun nicht mehr gesehen werden. »Wir haben uns beeilt, weißt du? Ich muß noch nach den Hähnen sehen.«
»Ah, ja, das tue nur, sie müssen Calicos wilde Hähne schlagen können!«
Wie viele Mexikaner züchteten die Peones der Hazienda Kampfhähne. Dieser sonntägliche Sport lockte dann Männer, Frauen und Kinder an.
Felipes breiter, kaulquappenähnlicher Mund verzog sich zu einem Grinsen. Es würde keinen Hahnenkampf an diesem Sonntag geben, das wußte er genau.
»Gut so«, zischelte es in Gustavos Rücken. »Fahr nur weiter, Brüderchen, mach ein freundliches Gesicht. Jetzt zur Scheune… und hineinfahren, verstehst du?«
Er verstummte, als einige Kinder, die im Innenhof gespielt hatten, auf den Wagen zugerannt kamen und ihr Geschrei ihn gezwungen hätte, lauter zu reden.
Unter den Kindern war Gustavos vierjähriger Sohn. Er beklagte sich, daß die anderen seinen Stoffball entzweigemacht hätten. Felipe stieß Gustavo die Gewehrmündung heftig in den Rücken.
»Papa… Papa, es war Ignacio… Ignacio! Mein schöner Ball…!«
In der Mitte des Wagens, in der Mulde, brach Garcia der Schweiß doppelt so stark aus. Die Kinder rannten neben dem Wagen her. Kamen sie bis in die Scheune mit, konnte alles verdorben sein. Garcia wälzte sich, so gut es ging, herum. Dann kroch er zu Felipe.
»Valgame dios«, knirschte Garcia. »Der Hundesohn soll diese Brut wegjagen, Felipe!«
Der nickte nur. Er hatte längst erkannt, was ihnen drohte, und schob sich, so nahe es ging, an Gustavo heran.
»Sag ihnen, daß sie verschwinden sollen!« zischte er. »Los, schick sie weg, sonst…«
»Manuel!« schimpfte Gustavo in seiner Wut und Verzweiflung. »Manuel, ich mache dir einen neuen Ball. Verschwinde jetzt, die Pferde sind unruhig. Verschwinde, Junge, ich komme schon!«
»Papa, Papa… er hat mich gestoßen, er hat mich…«
»Diablo, du sollst verschwinden, Chiquito, sonst verprügel ich dicht!« schrie Gustavo heiser vor Furcht. »Du bekommst einen neuen Ball. Hast du nicht gehört?«
Sie waren mittlerweile kaum zwanzig Schritt von der Scheune entfernt. Das Scheunentor stand offen. Die Scheune lag rechts, etwa dreißig Schritt vom Haupthaus entfernt. Und wenn es hier auch einige Bäume gab – der Raum zwischen Scheune und Haus war frei. Es gab kaum Deckungen für vierzehn Männer, die zuerst zum Haus mußten.
Felipes Bruder Pacco saß hinten auf dem Wagen. Er konnte nicht sehen, was vorn geschah, hörte nur Gustavos Gefluche und das Geschrei seines Sohnes. Tatsächlich blieb Gustavos kleiner Sohn zurück.
Gustavo duckte sich, als er unter dem Torbalken durchfuhr.
Im nächsten Moment mußte Gustavo halten. Er brachte den Wagen zum Stehen, wendete langsam den Kopf und sah seinen Sohn etwa fünf zehn Schritt vor dem Scheunentor warten. Der Junge blickte zu seinem Vater.
»Manolito!« schrie Gustavo in seiner Furcht schrill. Er hob drohend die Peitsche und sah seinen Sohn an. »Verschwinde, du kleiner Teufel, hau ab! Lauf zu deiner Mutter! Wirst du wohl verschwinden, du nichtsnutziger kleiner Teufel? Ah, ich prügel dich windelweich! Warte, ich komme!«
Gustavo sah das sperrangelweit offene Tor. Er brauchte nur acht Schritt weit zu rennen und dann hinauszuspringen, aber er zitterte vor Angst, daß die erste Kugel dann seinen Sohn töten würde. Drohend die Peitsche schwingend, blieb er stehen. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, ehe sein Manolito kehrtmachte und davonlief.
Kaum waren die Kinder verschwunden, als Felipe blitzschnell vom Wagen sprang.
»Mach das Tor zu!« fauchte er scharf. »Los, schnell, du Schurke, schließ das Tor!«
Felipe hetzte an der Wand entlang nach vorn. Er drückte sich neben dem Tor an das Heu und hob drohend die Gewehrmündung an. Sein kalter, mitleidloser Blick traf Gustavo, dem der Schweiß in kleinen Bächen über das hagere Gesicht rieselte. Dem Peon zitterten die Knie so heftig, daß er kaum gehen konnte. Schwankend näherte er sich dem schweren Torflügel und hob den Riegel an. Mit dem Zuschwingen des Flügels kam auch Felipe herum. Er verfolgte den Peon und kam ihm immer näher. Als der Flügel zufiel, glitten und sprangen die anderen Männer vom Wagen herunter. Augenblicklich drängten sie sich an das Heu und warteten, bis der Peon auch den zweiten Torflügel zuschob.
»Bueno«, sagte Garcia. Jetzt, da er sein Ziel erreicht hatte, fiel die Anspannung von ihm ab, und der Hohn, gepaart mit seiner Wildheit und Rachsucht, brach aus seinen Augen. Er war nie ein Freund der Fiorentes gewesen, da sein Vater und Don Sebastiano politische Gegner gewesen waren. Die Entscheidung Don Sebastianos, des Republikaners, war richtig gewesen – er hatte sein Eigentum behalten, während die Garcias fast alles verloren hatten. Neid und Haß vereinigten sich in Garcia zum wilden Grimm. Er besaß fast nichts mehr, während es diesem verfluchten Don Sebastiano kaum schlechter ging als vor der Revolution.
»Gut«, knirschte er bissig. Er kam auf den zitternden, an die Wand zurückweichenden Peon zu. »Du hast getan, was ich dir befohlen hatte, du Wurm. Gehörst du auch zu denen, die von Don Sebastiano ein eigenes Stück Land erhalten haben?«
»Si«, würgte Gustavo ängstlich. »Wir haben alle…«
»Ja, ich weiß«, zischte Garcia. »Dieser schlaue Schurke – er hat nur Freunde unter den Juaristas, eh! Und sein Sohn dient diesem dreckigen Indio auch noch als Kommandant eines Bataillons, eh? Felipe…«
Felipe hielt das Gewehr schon bereit. Er holte blitzschnell aus, dann schmetterte er dem zitternden Mann den Gewehrkolben an den Kopf, und Gustavo brach blutend zusammen.
»Bindet diesen Hohlkopf und werft ihn in das Heu!« bestimmte Garcia voller grausamer Freude. »Wenn wir es später anstecken, kann er dort braten!«
Er sah sich um, trat an das kleine Seitentor der Scheune und starrte aus dem halbblinden Fenster über den Hof. Sein Blick fiel auf den von vier Säulen getragenen Baldachin über dem Eingang des Haupthauses. Rechts und links des Baldachins lief ein Balkon nach beiden Seiten fort. Die Fensterläden mit ihren schräg angebrachten Sprossen waren wegen der Sonne vorgelegt, nur eine Zimmertür zum Balkon stand offen. Auch die Haustür war geöffnet, und eine dicke, barfüßige Dienerin trug in einer Kanne Milch ins Haus.
Vor Jahren war Garcia einmal hiergewesen. Es war ein kurzer Besuch gewesen, und Garcia erinnerte sich, daß es hinter dem Haus eine große Freiterrasse mit einem glasüberdachten Teil gegeben hatte, der zum Seitenflügel hin von einer Pergola eingefaßt war. Damals hatte sich Don Sebastiano an einem Tisch unter der Pergola aufgehalten und die Goldfische in einen Wasserbecken gefüttert. Die Wirtschaftsräume der Hazienda lagen vornheraus im unteren Geschoß. Ein breiter Gang durchzog das Haus bis zum Garten.
»Felipe«, zischte Garcia. »Komm her!«
Felipe erschien wie ein Schatten. »Don Felice?«
»Nimm dir acht Mann. Du dringst von vorn in das Haus ein. Vergiß nicht das erste Zimmer links, in dem die Waffen liegen. Zwei Mann läßt du im Hauseingang zurück. Alles, was zum Haus laufen will, wird erschossen, verstanden?«
»Si, Don Felice!« erwiderte der Mischling grinsend. »Wir haben die Waffen – und sie werden alle erschossen.«
Die anderen kamen jetzt heran und fieberten der Minute entgegen, die sie in den Besitz der Hazienda bringen sollte. Don Garcia hatte ihnen versprochen, daß sie plündern konnten und die Frauen ihnen gehören sollten.
Der Teufel kam über die Hazienda Loma Bonita.
*
Garcia lief in Riesensätzen am Hausgiebel entlang. Er hatte seinen Kavalleriesäbel in der Rechten und den Revolver in der Linken.
Erst in diesem Moment hörte Garcia, daß im Hof eine Frau gellend losschrie, aber er rannte unbeirrbar vorwärts. Felipe, das wußte er, würde seine Aufgabe mit Leichtigkeit lösen. Der Mischling war sein bester Mann, wild, verwegen, und von einem unzähmbaren Haß auf all jene erfüllt, die die Macht ausübten.
Er hatte mit seinem Bruder etwas Land und eine Hütte am Rand der Sierra besessen. Während sie in der Sierra jagten, waren Truppen durch das Tal gezogen. Und als sie wiederkamen, hatten sie nichts als Trümmer, geschändete und erschlagene Frauen gefunden. Felipe und Pacco waren mehr Jäger als Bauern gewesen. Beide waren ausgezeichnete Schützen, und nach dem Verlust ihres Eigentums hatten sie sich mit anderen zusammengetan, um auf eigene Faust gegen alles und jeden zu kämpfen.
Garcia konnte sich auf die Brüder verlassen. Da sie weder lesen noch schreiben konnten, brauchten sie jemanden, der ihnen sagte, was sie zu tun hatten. Sie führten jeden Befehl aus.
Im nächsten Augenblick erreichte Garcia die Hausecke, und der von Hibiskus und Caldiabüschen verzierte Garten lag nun vor ihm. Garcia sah die von Kletterpflanzen überrankte Pergola, den Rundbogen des Zugangs zur Terrasse und stürmte weiter.
Er war noch etwa zehn Schritt vor dem Rundbogendurchlaß in der satten grünen und von Blüten übersäten Mauer der Pergola, als es im Hof zwei-, dreimal krachte. Das Echo der Schüsse rollte über die Hazienda hinweg und brach sich an den Mauern.
Unmittelbar hinter der Pergola ertönte ein leiser, erschrockener Schrei. Etwas klirrte auf den großen Steinquadern, Wasser plätscherte, und eine helle, erschrockene Stimme rief bestürzt: »Vater – Vater, was geht im Hof vor? Vater…«
Irgendwo klappte eine Tür. »Por dios«, meldete sich eine tiefe dunkle Stimme. »Wer hat geschossen – was soll das Geschrei? Komm ins Haus, Tochter, schnell, komm ins Haus, schließ die Tür und…«
In diesem Augenblick erreichte Garcia den Rundbogen und sprang mit einem wilden Satz auf die Steinfliesen.
Der Blick des Bravados flog sofort nach links, und er sah nun das schlanke, zierliche Mädchen zwischen zwei der Tragsäulen des Balustradendaches neben einigen Blumenschalen stehen. Das Mädchen hatte seine Schritte gehört und schrie gellend auf. Dann machte es einen verzweifelten Versuch, an den Blumenschalen vorbei durch die breite Glastür des Hintereingangs in das Innere des Hauses zu fliehen.
Garcia sprang wie ein Tiger über die Blumenschalen hinweg. Er sah den verzweifelten, entsetzten Gesichtsausdruck des Mädchens, ihre großen, verstörten, furchtsamen Augen – und dann war er schon neben ihr. Seine Rechte mit dem Säbel fuhr an ihrer Schulter vorbei. Garcia winkelte den Arm mit einem jähen Ruck an, so daß sie mit dem Rücken an seine Brust flog.
Durch die weit geöffnete Tür hatte Garcia den Blick in die große Halle des Hauses frei, auf deren halber Höhe eine Galerie umlief. Von ihr führte eine breite, geschwungene Treppe hinunter zum Marmorfußboden der weiten Halle.
In der Mitte der Halle stand eine Art runder Brunnen, in dessen Mitte eine Fächerpalme in einem behauenen, riesigen Topf ihre Fächer herabsenkte. Rechts neben jener breiten Treppe vom Obergeschoß sah Garcia Don Sebastiano de Fiorentes an seinem gewaltigen Schreibtisch stehen.
Don Sebastiano wandte Garcia halb den Rücken zu. Er hatte eine Schublade aufgerissen, und seine Hand kam in dieser Sekunde mit einem schweren, vernickelten Revolver zum Vorschein. Das dunkle Gesicht des Hazienderos, umrahmt von einem weißgrauen Bart, verzerrte sich vor Zorn, als er den Bravado seine Tochter an sich reißen sah. Der Haziendero flog herum, und sein Wutschrei dröhnte durch die Halle: »Hund, laß sie los! Dir werde ich…!«
Garcia war um den Bruchteil einer Sekunde schneller. Er hob blitzschnell die Linke und schoß. Das wilde Brüllen des Schusses dröhnte durch die Halle. Die Kugel traf Don Sebastiano in die Schulter. Der Haziendero flog gegen den Schreibtisch zurück. Einen Moment lang konnte er sich aufstemmen, seine Hand umklammerte krampfhaft die Waffe. Dann knickte er ein, seine Hände rutschten über die Schreibtischplatte, während sich sein Körper zur Seite wegdrehte. Dann kippte er nach vorn und stürzte mit einem dumpfen Aufschlag auf den Marmorboden.
Das Mädchen stieß einen furchtbaren, gellenden Schrei aus, ehe es in Garcias Armen zusammensank und schlaff an ihm herabfiel. Drei, vier von Garcias Bravados sprangen nun an Garcia vorbei.
Gleichzeitig stürmte Felipe mit zwei Männern durch den breiten Gang auf die Halle zu. Sein Gewehrlauf schleuderte einen Mann, der aus irgendeiner der Seitentüren des Ganges auftauchte, in den Raum zurück, und einer der beiden Männer schlug mit der Macheta zu.
Währenddessen peitschten am Vordereingang des Hauses einige Schüsse durch das Geschrei und Gebrüll von Männern. Dumpf und dröhnend glaubte Garcia Hufschlag zu hören. Er hatte wie immer, wenn er abwesend war, Maddalena das Kommando über die anderen Männer gegeben, und sie hatte mit ihnen hinter dem letzten Hügel der Hazienda gewartet.
Der Hufschlag wurde gleich darauf, während entsetztes, schrilles Geheul der Peonfrauen über den Hof schallte und die Schüsse nun verstummten, lauter. Zwei von Felipes Männern rannten über den Hof. Sie liefen an etwa einem halben Dutzend im Hof liegenden Peones vorbei, von denen nur zwei den Versuch, zum Haus und an die im ersten Zimmer liegenden Waffen zu kommen, überlebt hatten. Frauen schrien und wimmerten – Kinder plärrten, während sich andere Frauen und Kinder zu verkriechen suchten. Einer der beiden Bravados trat eine Frau, als sie händeringend rieben ihrem toten Mann kniete und gellend »Mörder, Mörder!« schrie.
Dann erreichten sie das schwere Tor, neben dem der Wächter reglos auf der Seite lag und mit glanzlosen Augen und einer Kugel im Kopf dem zielsicheren Schuß von Louis Charlton zum Opfer gefallen war.
Durch das auffliegende Tor jagten im nächsten Augenblick die ersten der übrigen Bravados. Ihre triumphierenden Siegesrufe vermischten sich mit dem Klagen und Stöhnen der Verwundeten, dem Heulen von Frauen und Kindern und dem erschrockenen Brüllen des Viehs in den Ställen.
»Ah, dios!« stieß Maddalena heraus, ehe sie absprang und zum Haupthaus lief. »Wir haben sie alle. Louis, komm, ich will sehen, was aus diesem hochmütigen Don Sebastiano geworden ist, der es einmal wagte, meinen Vater von dieser Hazienda zu jagen! Ah, wo ist der alte Schurke?«
*
Cerringa sah zurück. Die Wagen rollten jetzt über den Hügel, während Cerringa, der mexikanische Scout, auf die Hazienda zuritt. Etwa achtzig Schritte hinter Cerringa folgte James Bowlen, bester Mann von Benson und Hedge, ein kühler, bereits ergrauter und erfahrener Wagenboß. Bowlen hatte die Verantwortung für die Wagen und die Ladung. Er war noch nie auf der Hazienda selbst gewesen, sondern hatte seine Wagen immer an den Fluß gebracht.
Jetzt sah Bowlen in der tiefstehenden Sonne über die Hazienda hinweg. An den Peonhäusern außerhalb der Mauer hockten zwei Männer, den Rücken an der Hausmauer, die Hüte wie üblich nach vorn gestülpt. Eine Frau stand an einem Waschfaß, während zwei andere dabei waren, Maiskolben von den Körnern zu befreien. Der Rauch aus zwei, drei Schornsteinen stieg fast senkrecht in die stillstehende Spätnachmittagsluft.
Etwas weiter rechts des Weges, der vom Hügel aus zum Tor der Haziendamauer führte, stand ein Heuwagen. Die Ladung war verrutscht, lag zum Teil an der Erde, und drei Männer waren dabei, das Heu wieder aufzugabeln.
Bowlen konnte durch das aufstehende Mauertor in den Hof der Hazienda blicken. Männer standen im Kreis um einen mit einer Schnur an einem Pflock gebundenen Kampfhahn, den einer der Mexikaner mit einem anderen Hahn, den er ihm ruckartig entgegenstieß, reizte.
»Cerringa?«
Bowlens Ruf ließ Cerringa nicken und die Hand heben. Die Wagen rollten weiter auf das friedliche Bild im Tal zu. Bowlen atmete auf. Er hatte sich seit dem Morgen nicht mehr viel Sorgen wegen der Grenzbanditen gemacht. Hier, hinter den dicken Mauern der Hazienda, das wußte er, waren sie nun ganz sicher. Sie würden ein gutes Abendessen und eine ruhige Nacht vor sich haben.
Cerringa ritt nun dicht an jenem Heuwagen vorbei. Er hielt an, kniff die Lider zusammen und musterte die drei Männer. Er kannte sie nicht, er hatte sie, obwohl er zweimal hiergewesen war und einige von ihnen ihm begegnet waren, noch nie gesehen.
»Eh hallo«, redete Cerringa sie an. »Pech gehabt, wie? Don Sebastiano zu Hause?«
Der eine Mann wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann grinste er breit, daß sich sein kaulquappenähnlicher Mund fast von einem Ohr zum anderen zog.
»Si«, erwiderte er. »Ihr kommt früh, Amigos. Der Patron wird noch nicht mit euch rechnen, und die Eskorte ist auch noch nicht hier. Ah, zum Teufel, arbeite schneller, Pacco, sonst laden wir noch bei Dunkelheit auf.«
Er lachte danach, sah Cerringa an und hob die Hand.
»Du bist Cerringa, ja? Du mußt es sein. Gustavo und Umberto haben mir von dir erzählt. Schade, daß du sie nicht treffen wirst. Wir haben sechzig Rinder nach Cerralvo bringen müssen. Eh… weißt du, die Soldados haben immer Hunger, besonders, wenn sie nichts zu tun haben, hähä!«
Cerringa lachte mit, nahm sein Pferd herum und ritt weiter. Der Wächter am Tor blickte ihm entgegen, rief dann etwas in den Hof, und die Männer, die im Kreis um den angebundenen Hahn standen, blickten jetzt hoch.
»Adelante – hört mit dem Spiel auf!« schrie der Wächter lauter. »Es gibt Arbeit für euch, macht den Platz da frei!«
»Du alter Antreiber!« schimpfte einer der Peones. »Laß uns das Vergnügen, du ärgerst dich ja nur, weil du gerade Posten hast, was?«
Sie lachten, einer nahm den Hahn und steckte ihn in einen Tragekäfig.
Dann zerstreuten sie sich, und Cerringa erreichte den Wächter.
»Sie werden euch helfen«, versicherte der Posten eilig. »Ich habe schon jemand zu Don Sebastiano geschickt. Komm herein, Cerringa, wir haben kühles Pulque für euch alle. Und Wein – guten Landwein.«
Cerringa sah zu dem Tisch neben dem Hauseingang. Der Tisch stand an der Wand unter dem Säulenbaldachin, und Alfonso, der Majordomo der Hazienda, saß dort. Hinter ihm stand das Fenster des einen Raumes offen.
»Buenos dias, Señor Alfonso«, begrüßte ihn Cerringa. »Habt ihr uns noch nicht erwartet?«
»Nicht so früh«, erwiderte Alfonso. Er war groß und hager, weit über fünfzig Jahre alt, und stand nun langsam auf. »Seid willkommen. Ich hoffe, ihr hattet keinen Ärger unterwegs!«
Der Majordomo blickte einen Moment auf den frischgefegten Hof. Als Verwalter des Hauses war es seine Aufgabe, jeden Gast zu empfangen, und er trat drei Schritt bis an die Kante der Steinplatten unter dem Baldachin vor. Dort blieb er stehen.
Sein Gesicht war ausdruckslos, weder freundlich noch ängstlich. Hinter ihm in jenem Raum, dessen Fenster aufstand, dessen Inneres aber dunkel war, stand jemand und zielte mit seinem Gewehr auf seinen Rücken. Der Majordomo hatte das Gefühl, daß ihm das Gewehr mitten zwischen die Schulterblätter deutete. Die Furcht drohte ihm die Stimme zu rauben. Er wußte nur zu gut, daß sie seine Frau und Dona Isabel de Fiorentes gebunden in diesen Raum geschleppt hatten.
Wenn Cerringa etwas bemerkt, dachte der Majordomo voller Furcht und zwang sich, ein geduldiges, ruhiges Gesicht zu zeigen, bringen die Bravados die Frauen alle um. Großer Gott, sie haben fast alle Frauen gebunden in den Stall geschafft, auch meine Tochter, mein einziges Kind. Wenn ich einen Fehler mache, hat dieser Schurke Garcia gedroht, bringen sie uns alle um!
Cerringa, der Scout, kam näher, dann hielt er vor der Eisenstange und den beiden Pfosten an. Sein Blick war einmal über den Hof gegangen, aber Cerringa konnte nichts sehen, was ihm auffallen oder mißtrauisch machen konnte. Hier war es immer sauber, der Hof wurde öfter gesprengt und gefegt. Hier und dort standen einige Flechtkörbe und Tonnen. Die Peones schlenderten schwatzend davon. Daß sie sich langsam verteilten und jeder plötzlich eine Arbeit in der Nähe eines Flechtkorbes oder einer Tonne zu haben schien, bemerkte Cerringa nicht.
»No, keinen Ärger, Señor Alfonso«, erwiderte Cerringa lächelnd. »Ich hoffe, ich störe Don Sebastiano nicht.«
»Nun, er hat sich hingelegt gehabt«, erklärte der Majordomo völlig gelassen. Die Angst, daß sich seine Stimme durch ein Vibrieren verraten konnte, verging jetzt. Er wunderte sich über seine eigene Kälte. »Don Sebastiano ist vorgestern vom Pferd gestürzt. Nichts weiter, was man schlimm nennen könnte, Cerringa. Wenn du absteigen willst?«
Cerringa nickte. Man hörte das Rasseln der herankommenden Wagen, und Bowlen tauchte nun etwa zwanzig Schritt vor dem Tor auf. Cerringa steckte zwei Finger in den Mund und pfiff einmal schrill. Bowlen ritt weiter, nachdem er den Arm nach oben gestochen und den Fahrern einen Wink gegeben hatte, ihm zu folgen. Dann erst stieg Cerringa ab.
Der Majordomo deutete auf die Weinflasche auf dem Tisch und einen Stuhl. Einen Moment sah er zu den Wagen hin. Wenn er jetzt einen Warnschrei ausstieß, konnten die Wagen noch vor dem Tor halten. Er konnte die Männer und die Ladung retten. Und vielleicht würden die Texaner auch helfen, die Bravados zu vertreiben. Wahrscheinlicher aber war, daß sie ihre Wagen herumlenken und aus dem Bereich der Gewehre der Bravados jagen würden.
Es ist sinnlos, dachte der Majordomo bitter, sie würden ihnen die Pferde erschießen. Es sind fast sechzig Banditen in der Hazienda… es ist sinnlos, sie bringen sie und uns alle um.
In diesem Augenblick fuhr der erste Wagen durch das Tor. Bowlen war zur Seite geritten und wies sie ein.
»Fahrt zu zwei Reihen auf!« dröhnte seine Stimme über den Hof. »Hier ist Platz genug. Vorwärts, beeilt euch, damit wir ausschirren und abkochen können. Herein mit euch, Leute!«
In dieser Sekunde stand Lucky Louis Charlton, das Gewehr schußbereit in der Faust, hinter der offenen Balustradentür. Er konnte von seinem Platz aus die neun Wagen und die Fahrer und Begleitreiter genau ausmachen. Hinter den Transportwagen schaukelte nun der Heuwagen her. So harmlos sich der Wagen ausmachte – Felipe und Pacco hatten den richtigen Zeitpunkt für ihren teuflischen Plan genau abgepaßt. Der Wagen rumpelte hinter dem letzten Reiter her, der die Wagen sicherte. Er war kaum dreißig Schritt vom letzten Wagen entfernt.
Von der Höhe der Balustrade aus sah Louis Charlton das teuflisch geschickte Manöver. Neben Charlton stieß Maddalena Garcia ein leises, befriedigtes Zischen aus. Dann sah sie sich um.
Auf seinem Bett lag gebunden und mit einem Tuch zwischen den Zähnen der alte Don Sebastiano. Er hatte die Augen weit geöffnet. Zwar konnte er nicht sprechen, aber immerhin hören. Seine Hoffnungen hatten sich bis zuletzt an die Wagen und jene eiskalten, eisenharten Männer aus Texas geklammert. Jetzt sah der alte Haziendero das höhnische Lächeln Maddalenas.
»Hast du alter Schurke geglaubt, daß diese Gringos etwas bemerken würden?« fragte sie voller Hohn. »Ah, sie sind alle im Hof. Das war mein Plan, du alter Narr, hörst du – mein Plan! Jetzt haben wir sie!«
Sie fuhr beim letzten Wort herum. Dann trat sie an Charlton vorbei und auf die Balustrade. Maddalena Garcia hielt den Revolver in der Faust. Sie machte noch einen Schritt und erreichte die Brüstung der Balustrade. Sie hatte ihre Leinenjacke abgelegt und erschien mit ihren langen blauschwarzen Haaren und ihrer Bluse über den Wagen und Männern.
Charlton, der sich im Hintergrund hielt, bewunderte ihre Kaltblütigkeit und ihren Mut.
»Buenos dias, Señores«, sagte Maddalena Garcia laut und hell über die Männer und Wagen hinweg. Sie sah, daß die Männer die Köpfe hoben und fast alle zu ihr emporblickten.
»Buenos dias, Amigos – willkommen auf der Hazienda Loma Bonita. Und hier ist mein Willkommensgruß für euch!«
Ihre Hand erschien blitzschnell über der Brüstung. Die Männer unten, die bei ihren Worten zu ihr aufblickten, begriffen nicht, was sie wollte, aber sie sahen den Revolver.
Auch James Bowlen blickte zu dem Mädchen empor. Er kannte die Tochter des Hazienderos nicht, und er nahm an, daß sie es war, die sie nun begrüßte. Ihre Worte klangen freundlich, beinahe herzlich. Dann blickte Bowlen mitten in den Revolver. Dies war das letzte, was James Bowlen sah – eine Feuerlanze, die aus der Mündung des Revolvers brach.
Die Kugel traf James Bowlen mitten in den Kopf.
*
Cerringa hörte das Brüllen des Schusses über sich und fuhr herum. In derselben Sekunde polterte es drüben am Stall. Die vier Türen flogen mit einem Ruck auf.
Das scheppernde Klirren von Glas ertönte überall. Fensterläden am Haus schnellten auf, und ehe Cerringa einen klaren Gedanken fassen konnte, sah er James Bowlen mit ausgebreiteten Armen vom Pferd kippen. Hinter dem Mexikanerscout polterte irgend etwas. Der Scout hatte die Hand bereits an seinem Revolver, als ihm etwas zwischen die Schulterblätter stieß.
Während der Stoß Cerringa traf, sah er, daß die angeblichen Peones binnen zwei Sekunden in Tonnen und Körbe griffen. Vor Schreck starr stierte Cerringa auf die Waffen, die plötzlich in den Händen der Männer lagen.
»Hände hoch – nicht bewegen!« schrie es gellend über den Hof. »Nehmt die Hände hoch! Wir schießen euch nieder! Die Hände von den Waffen – schnell!«
Im letzten Wagen rutschte Bradford, einer der Texaner, der gerade die Leinen festgebunden und sich nach vorn gebeugt hatte, blitzschnell tiefer. Die Wagen standen in zwei Reihen nebeneinander, und Bradford handelte im Bruchteil eines Augenblicks.
»Verflucht!« knurrte Bradford. »Diese Greaser sollen…«
Seine Hand griff nach der Schrotflinte. Er wußte nicht, daß ihre einzige Chance auf diese nahe Entfernung nur in den Schrotflinten lag. Ohne sehen zu können, was sich rechts hinter dem neben ihm stehenden Wagen abspielte, riß Bradford die schwere Schrotflinte herum.
Jenkins, sein Partner, griff nach der anderen Schrotflinte, zuckte dann aber wie unter einem Peitschenhieb zusammen.
Aus dem Obergeschoß des Hauses, dessen Fensterladen krachend nach dem Aufstoßen an die Mauer geprallt waren, kam der dröhnende, brüllende Hall eines Gewehrschusses. Das Pfeifen der Kugel fuhr so hart an Jenkins vorbei, daß er sich zurückwarf und die Hand von der Flinte nahm.
In derselben Sekunde sah er, wie die Kugel in Bradfords Nacken schlug.
Bradford stürzte gegen den Eisenbügel des Sitzbretts. Dann neigte sich sein Körper weiter nach vorn. Und dann kippte Bradford über die Kastenkante neben dem Vorderrad zu Boden. Dort blieb er liegen, unfähig, sich zu erheben oder nach der Flinte zu greifen, die vor ihm am Boden lag. Sein Stöhnen drang zu dem leichenblaß gewordenen Jenkins empor.
»Nicht bewegen, Gringos – nicht bewegen, stillsitzen, ganz still!«
Die Stimme fauchte über die Wagen hinweg. Petersen, ein bärtiger blonder Mann, ein Riese mit ungeheuren Kräften, stierte auf die Bäume. Er und Johnson hockten auf einem der ersten Wagen, und sie hatten den Blick auf die Bäume zwischen Scheune und Haupthaus frei. Das dichte Blattgewirr hatte sich geteilt, die blanken Läufe der Gewehre blickten auf sie herab.
»Allmächtiger«, keuchte Johnson. »Eine Falle – verdammt – was tun…?«
»Nimm die Hände hoch«, ächzte Petersen, dem eine Gewehrmündung genau zwischen die Augen sah. »Versuche nichts – sie haben uns. Teufel, wie viele sind das?«
Es war an den anderen Wagen nicht besser. Und wenn es einen Fehler in den Berechnungen von Felice Garcia gab, dann den, daß er mit einer anderen Reaktion der verhaßten Gringos gerechnet hatte. Sie waren keine Mexikaner, die auch in einer aussichtslosen Situation, den sicheren und sinnlosen Tod vor Augen, an Widerstand dachten. Diese Männer waren durch hundert Fegefeuer gegangen, und der Krieg war jahrelang ihr Handwerk gewesen. Nur ein Narr kämpfte ohne Aussicht auf Erfolg. Wenngleich jeder Mexikaner gewußt hätte, daß er doch sterben mußte – den Amerikanern blieb immer noch die Hoffnung auf eine spätere Chance.
So reckte Petersen die Arme in die Höhe. Er knurrte voller Grimm dabei, während Johnson die Lippen zusammenpreßte und jetzt die ersten Bravados auf die Wagen zustürmen sah.
»Keine Maximilianos – keine Kaiserlichen«, zischte Petersen zwischen halbgeöffneten Lippen. »Mann, tu, was sie sagen – das sind Banditen – Bravados. Jetzt haben wir nur eine Chance… die Chance zu sterben! Die haben es auf unsere Ladung abgesehen! Vielleicht verschonen sie uns…«
Garcia kam, seinen Spencerkarabiner unter dem Arm, mit einem breiten, satten Grinsen aus dem Haupthaus und blieb auf dem erhöhten Teil an den Baldachinstützen stehen.
»Bueno, ihr seid klüger, als ich gedacht habe«, begrüßte er die Texaner höhnisch. »Wir werden euch jetzt entwaffnen. Ihr seid meine Gefangenen, verstanden? Später nehme ich euch mit, ich habe ein kleines Geschäft mit euch vor, versteht ihr? Die Señores Benson und Hedge besitzen noch viel mehr Waffen. Und werden sie euch jemals wiedersehen, werden sie mehr Waffen für El General Garcia liefern müssen. Sonst… por todos los santos, meine Freunde… werde ich ihnen eure Köpfe schicken. Seid jetzt vernünftig und gebt alles ab, was ihr bei euch tragt. Versteckt keine Waffe, meine Freunde, hört ihr? Wer eine Waffe versteckt, den hänge ich an die Äste der Bäume dort hinten. Adelante – durchsucht ihre Taschen gründlich!«
Es gab keinen Texaner, der nicht mindestens ein Gewehr oder einen Revolver auf die Brust oder in den Bauch gedrückt bekam. Einige standen mit den scharfen Klingen der Machetas am Hals reglos da und mußten es sich gefallen lassen, daß man ihnen die Taschen ausräumte.
Dann tastete man sie ab und stieß sie zu einer Gruppe zusammen. Bowlen lag tot im Hof, aber auch ihm hatte man die Taschen geleert. Jenkins wurde mit Petersen zu Bradford getrieben. Sie mußten ihn aufheben, und dann jagte man sie unter Flüchen und Stößen um das Haupthaus an den nördlichen Seitengiebel. Dort führte eine steile, schmale Steintreppe zu einem Keller hinunter, dessen schwere, eisenbeschlagene Tür aufstand.
»Hinein – alle hinein!« fluchte Garcia drohend. »Es sind dort nur zwei Keller, ich habe sie ausräumen lassen. Versucht nicht die Tür aufzubrechen oder eins der Gitter auszuheben. Meine Soldados werden euch dann erschießen. Hinein mit euch, Gringos, adelante… vorwärts!«
Trevor war einer der ersten Männer, die mit eingezogenen Köpfen in die kühlen, leicht feuchten zwei Steinkeller gestoßen wurden. Auf den ersten Blick sah Trevor, daß die Mauern aus meterdicken Felsbrocken bestanden, die sauber ineinandergefügt und behauen aufgesetzt worden waren. Die Fensterscharten verbreiterten sich nach innen, hatten vorn zwei Finger starke Vierkantstäbe aus Eisen im Kreuzverband und keine Glasfenster. Es waren Schachtlöcher, außen überdeckt von einer Steinplatte, so daß der hier seltene Regen gleich ablaufen und nicht in den. Keller eindringen konnte. Der zweite Blick Trevors ging zur Decke, und hatte er eine Hoffnung gehabt, dann gab es nun keine mehr. Die Decken wölbten sich zur Mitte höher. Sie bestanden aus Felsplatten.
Petersen stieß sich den Kopf. Sie legten den röchelnden Bradford hin, die Tür donnerte hinter ihnen zu. Ein Schlüssel drehte sich im Schloß. Das schwere Dröhnen kam, und sie wußten nun, daß die beiden Balken, die draußen an der Mauer gelehnt hatten, vor die Tür gerammt worden waren. An einem der Fenster zeigte sich plötzlich das eckige Gesicht Felipes. Der Mischling spähte in das Halbdunkel des Kellers hinunter. Sein gellendes, hämisches Lachen schallte durch den Schacht zu den Männern hinab.
»Muy bien!« lachte der Mischling schadenfroh. »Dort sitzt ihr sehr gut… muy bien, Amigos! Macht es euch bequem und schlaft ein wenig. Ihr werdet es auch nicht bei Licht müssen. Es schläft sich viel besser in der Dunkelheit, eh?«
Augenblicke später schabte es. Man warf einige Säcke vor die Schächte, und es wurde stockfinster.
*
Charlton war sieben Jahre jünger gewesen, als er seine Ausbildung zum Artilleristen durchgemacht hatte – und er war, da er sich immer für Waffen interessiert hatte, nicht der schlechteste Artillerist gewesen.
Garcia stand hinter ihm und sah ihm neugierig zu. Die kleine, vierpfündige Kanone, die in einzelnen Traglasten transportiert werden konnte, stand jetzt am Ende der Wagenreihen genau zwischen den Wagen. Die Entfernung bis zum Tor betrug sechzig Schritt. Es war bereits so dunkel, daß Charlton Felipe mit einer Laterne vor das Tor geschickt hatte. Charlton kurbelte das Rohr der Bronzekanone herunter, bis er über die feststehende Visiereinrichtung genau die Lampe sah.
»Diablo«, knurrte Garcia. »Du schießt ja in die Erde, Louis, wozu das? Ich denke, du willst Pferde treffen, eh?«
Charlton sah ihn kurz an. Er hatte Garcia erst vor zwei Minuten zu Gesicht bekommen. Garcia war im Haus verschwunden. Er hatte dort jeden Schrank durchwühlt und schließlich voller Wut den alten Don Sebastiano geschlagen, weil er nicht mehr als neunhundert Silberpesos und nicht ganz hundert Dollar gefunden hatte. Doch schließlich hatte er den Beteuerungen des Don geglaubt – es war nicht mehr Geld im Haus. Was es an Wertsachen gab, befand sich in einem Sack, den Garcia mit sich herumschleppte. Anscheinend traute er seinen eigenen Leuten nicht. Aus dem Hausanbau drang das Klagen der Frauen, die Garcia dort mitsamt den Kindern und Männern eingesperrt hatte.
Dieser geldgierige Schurke, dachte Charlton angewidert. Er fror leicht, als er an die unbeschreiblichen Szenen dachte, die sich nach der Überwältigung der Wagenmannschaft abgespielt hatten. Seine Verachtung hatte auch Maddalena gegolten. Charlton hatte ihr Gesicht beobachtet, während die siegestrunkenen Bravados über die Frauen herfielen.
»Hast du schon mal mit Kartätschen geschossen?« fragte Charlton spöttisch. »Es gibt zwei Arten von Kartätschengranaten – und hier ist nur eine. Wir haben keine Brandzündergranaten, verstehst du?«
»No«, brummte Garcia. »Was, zum Teufel, verstehe ich von Kartätschen, eh? Und was für Granaten haben wir?«
»Aufschlaggeschosse!« antwortete ihm Charlton kurz. »Sie haben nicht dieselbe Wirkung wie Brandzündergeschosse. Brandzündergeschosse detonieren nach achtzig Schritt Flugstrecke drei Meter über dem Boden und jagen ihre Kugeln nach allen Seiten. Hier drin sind hundertzwanzig Bleikugeln!«
Er klopfte auf die Granate, deren Warzen dem Geschoß Führung und Drall gaben. Dann schob er die Granate von vorn ins Bronzerohr der Kanone und stieß sie fest mit dem Rohrwischer auf.
»Hundertzwanzig Bleikugeln?« war Garcia erstaunt. »Alle Teufel! Dann kann man mit einem Schuß hundertzwanzig Menschen töten – ist das wahr?«
Dieser Idiot, dachte Charlton verächtlich. Glaubt der Narr wirklich, daß alle Kugeln treffen? Keine Ahnung – dieser Strolch, der sich General nennt.
»Wenn du zehn tötest, hast du Glück gehabt«, erklärte er. »Die Granate explodiert beim Aufschlag gegen den Boden. Dadurch wird nur ein Teil der Kugeln nach allen Seiten geschleudert. Eine ganze Menge trifft die Erde, andere irren ab – sie streuen – wenn du weißt, was das bedeutet.«
»Aber – wir haben vier Kanonen!« sagte Garcia eigensinnig. »Es sollen nur etwa dreißig Soldados kommen. Dann brauchen wir doch nur drei Kanonen, um sie alle zu erschießen.«
Charlton schüttelte den Kopf. Er hatte Maddalena bereits alles erklärt und nun wenig Lust, es noch einmal zu wiederholen.
»Du hast gesagt, ich sollte alle vier aufstellen – und das habe ich getan. Wer immer herkommt, wieviel Mann es auch sind, sie haben keine Chance zu entwischen.«
»Gut, ich weiß, du verstehst davon mehr als ich«, murrte Garcia. »Jetzt laß mich sehen, wo die anderen Kanonen stehen.«
Charlton ging mit ihm aus dem Tor. Hinter dem Hügel gab es eine Menge Büsche, die sich bis an den Weg herunterzogen. Die Entfernung bis zur Hazienda betrug vom Rand der Büsche etwa neunzig Schritt, und Charlton deutete nach oben.
»Dort steht die eine!« erklärte er mürrisch. »Wir haben den Karren neben den Punkt gestellt, auf den ich das Rohr gerichtet habe. Sobald die Juaristas hier sind, feuert Pacco die Kanone ab.«
»Por dios, nur er?«
»Wenn die Juaristas fliehen – was noch fliehen sollte«, sagte Charlton finster. »Du hast ihm zwanzig deiner Männer gegeben – sie liegen in den Büschen versteckt. Es wird keiner entkommen.«
»Bist du sicher?«
»Ja«, knurrte Chariton. Er deutete nach links zu den Peonhütten. Dort standen einige Maisstangenbündel. »Die dritte Kanone steht da drüben.«
»Wo?«
»Hinter dem Maisstroh!« sagte Charlton kopfschüttelnd. »Du siehst sie nicht. Man braucht nur die Strohbündel wegzustoßen. Felipe besorgt das. Er wird auch feuern. Jetzt sieh nach rechts. Das ist ein Heuhaufen, wie es scheint. Es ist nur eine mit Heu durchflochtene Kastenseite des Leiterwagens. Ignacio hat das Kommando. Sie werden die Sprossenseite umkippen, dann können sie feuern.«
»Diablo!« stieß Garcia heraus. »Ich werde dich zu dem Oberbefehlshaber meiner Artillerie machen, Louis! Wir schießen sie alle tot, jetzt weiß ich es! Gut – sehr gut, Louis. Wir schießen von allen Seiten auf sie. Sie werden alle sterben.«
Ungefähr das wird es geben, dachte Charlton. Ich lasse die Juaristas bis dicht vor das Tor kommen, ehe ich feuere. Sobald ich schieße, zünden auch die anderen beiden Kanonen rechts und links. Es wird ein Blutbad geben, ich wette, keine fünf Mann entkommen – und sie laufen genau vor Paccos Kartätschenladung. Vielleicht laufen auch einige in kopfloser Furcht davon, aber an den Hütten liegen zehn Mann. Rechter Hand sind fünfzehn, auf dem Hang zwanzig – der Rest ist hier im Hof. Niemand wird davonkommen. Verdammt, es wird ein Blutbad geben…
Er sah sich um, als Maddalena aus dem Tor trat. Der Schein der beiden Feuer im Hof, an denen die restlichen Bravados lagen und die Rolle der Wagenfahrer übernommen hatten, beleuchtete ihr schmales, wildes Gesicht.
»Nun, hat er endlich Zeit gehabt, sich die Aufstellung anzusehen?« fragte sie spottend nach einem Blick auf ihren Bruder. »Es wird Zeit, Felice, höchste Zeit. Die Juaristas müßten in spätestens dreißig Minuten hier sein.«
»Ah, Ramon wird sie anmelden«, antwortete Garcia wegwerfend. »Mach dir keine Sorgen, ich habe Manuel zu Ramon geschickt und ihm zwei Ersatzpferde mitgegeben. Sie sind in jedem Fall schneller hier als die Juaristas. Soldados haben es nie eilig.«
»Sie wollten so losreiten, daß sie nach Einbruch der Dunkelheit spätestens hier sein mußten«, sagte Maddalena unruhig. »Die Dunkelheit ist da – aber wo bleiben Ramon und Manuel? Bruder, sie müßten hier sein. Du hast Manuel doch genau beschrieben, wo er Ramon zu suchen hat?«
»Si – si«, knurrte Garcia gereizt. »Immer deine übertriebene Vorsicht und Angst, daß etwas nicht glücken könnte. Du wirst sehen – sie kommen gleich.«
Maddalena sah zum Hügel, aber dort oben blieb alles stumm und still.
»Ich weiß nicht«, murmelte sie halblaut. »Ich habe so ein Gefühl wie damals, als du nach San Luis Potosi reiten mußtest. Es war sinnlos, ich sagte es dir. Und dann kam dieses Unglück, das uns die Hazienda, allen Besitz und unseren Vater kostete. Ich habe dasselbe Gefühl.«
»Pah, deine Gefühle!« lachte Garcia. »Hast du auch Gefühle? Sie hat immer welche, manchmal denke ich, sie sieht alles schwarz. Sie redet immer vom Sterben.«
Charlton zuckte die Achseln. Es stimmte, Maddalena sprach oft vom Sterben, aber Angst… Angst hatte sie nie gezeigt. Und doch schien sie jetzt etwas wie Furcht zu spüren.
»Du solltest deine Schwester besser kennen, Felice.«
»Er… mich kennen?« stieß sie verächtlich heraus. »Er hat mich nie gekannt, Louis – noch nie! Felice, dieses Gefühl… ich fühle, daß etwas nicht in Ordnung ist. Felice, schick noch jemanden los, schnell. Schick einen Mann Ramon und Manuel entgegen. Sie müßten schon hier sein!«
»Närrin! Sie werden gleich kommen!« knirschte Garcia. »Mach mich nicht verrückt mit deinen Weibergefühlen. Du wirst sehen, heute werden wir die erste Schlacht gewinnen! Und morgen ziehen wir nach Cerralvo, morgen früh sind wir da und jagen die Juaristas zum Teufel. In einem Monat gehört uns die halbe Provinz – und in einem halben Jahr ganz Nordmexiko!«
»Louis… Louis, sage ihm, daß er einen Mann Ramon und Manuel entgegenschicken soll«, flehte Maddalena furchtsam. »Dieses Gefühl wird immer stärker. Damals, als sie kamen und unsere Hazienda überfielen… ich hatte dasselbe Gefühl, glaube mir. Felice, hör auf mich!«
»Valgame dios, diese Närrin!« fluchte Garcia. »Ich sage dir, sie werden gleich hier sein. Laß mich in Ruhe! Verschwinde! Du brauchst nicht zu kämpfen – geh ins Haus, los!«
»Louis…«
»Wenn er nicht will?« brummte Charlton. »Maddalena, es kann nichts passieren. Wir würden auch mit siebzig oder achtzig Juaristas, ja, auch mit hundertzwanzig, wenn es sein müßte, fertig. Vielleicht war es zuviel für dich, die letzten zwei Tage.«
Sie ging davon, und Charlton sah ihr kopfschüttelnd nach. Als sie im Haus verschwunden war, trat er an seine Kanone. Seine Hand strich über den glatten, kühlen Lauf hinweg. Er hörte Hufschlag herantrommeln und sah auf die Mündung des Vierpfünders.
Tod, dachte Charlton, Tod und Verderben wird sie ausspucken. Ich muß nur denken, daß Krieg ist – vielleicht hilft das.
Charlton stand reglos an der leichten Kanone. Er wußte nicht mal, ob eine halbe Minute oder nur zehn Sekunden vergangen waren, als ein schriller, gellender Aufschrei ihn herumfahren ließ. Der Schrei kam aus dem Haus.
Es war Maddalena!
*
Die Hand wanderte herum, und Concho Hurst folgte ihr mit seinen Blicken. Der Chiricahua deutete kurz zu dem aufgetürmten Heu, das in einem offenen Doppelrechteck lag. Flach an den Boden gepreßt, hatten sie sich beide um die Ecke der Mauer geschoben. Jetzt hob Concho Hurst knapp den Kopf. Und dann sah er es. Das erste Mondlicht fiel auf ein längliches, blankes Rohr, neben dem die Schatten von zwei Rädern und mehreren Männern aufragten.
Herrgott im Himmel, dachte Concho bestürzt – hier auch? Der Amerikaner… der Amerikaner! Drei Kanonen… eine oben am Hang, die zweite an den Hütten, die dritte hier… und die vierte?
Lautlos glitt der Chiricahua zurück hinter die Ecke, und auch Concho schob sich hinter die Mauer. Dort hob der Chiricahua die Hand – vier Finger hoch, dann eine Bewegung zur Mauer.
»Meinst du, sie steht im Hof?«
Der Stumme nickte kurz, huschte an der Mauer entlang und machte wieder sein Zeichen – gekreuzte Hände. Er stand jetzt, während Hurst blitzschnell die Hände faltete. Dann stellte Mattare den rechten Fuß in die Handflächen.
Langsam, dachte Concho, nur nicht, daß er zu weit über die Mauer taucht. Allmächtiger, wenn wir diesen Ramon nicht bemerkt hätten – was dann? Der Kerl lag über uns, ließ uns vorbei und trieb dann sein Pferd an, um uns im Bogen zu überholen. Hatte es höllisch eilig, der Schurke, weil er gesehen hatte, daß wir schnell ritten und es hundert statt dreißig Mann waren, die auf dem Weg hierher waren. Genug Teufel, beinahe zu weit!
Er hatte den Chiricahua hochgestemmt. Der blickte über die Mauer, zog sich aber nicht auf sie, sondern winkte heftig, so daß ihn Concho herabsinken ließ. Wieder hoben sich Mattares Hände, redeten…
»Ein Doppelposten… wo? Am Seitenflügel ganz rechts? Wir müssen zurück nach Süden und weiter hinten über die Mauer, wenn sie uns nicht bemerken sollen. Dann schnell, Mattare, schnell! Aber vorsichtig, bleib vorsichtig, hörst du?«
Das eckige Gesicht vor Concho verzog sich kurz, dann lief der Indianer vor ihm her, blieb stehen und deutete auf die Mauerkrone.
»Hier sehen sie uns nicht? Gut, dann rüber – du zuerst?«
Der Chiricahua nickte und schwang sich mit Conchos Hilfe hoch. Auf der Mauer blieb er liegen und half nun Concho. Danach glitten sie herab und standen im Garten der Hazienda. Sofort wandte sich Mattare nach rechts, glitt auf einige Zierbüsche zu. Es ging Richtung Haupthaus zu dessen Rückfront.
Ohne ihn, dachte Concho, hätte ich es nie geschafft. Er hat sie buchstäblich gerochen. Hier sind also keine Bravados, erst am Seitenflügel, sagte er? Teufel, dieser Ramon, wenn wir den nicht ausgequetscht hätten…
Mattare kroch jetzt und war schon an der Hauswand.
Schneller, dachte Concho, mach schneller, Mattare. Wenn Garcia mißtrauisch wird, was dann? Der rechnet bei Einbruch der Dunkelheit mit uns. Es ist jetzt dunkel, die warten, und wir kommen nicht, wir sind längst da. Die Juaristas liegen keine Steinwurfweite von der Haziendamauer entfernt im Südwesten, bereit, beim ersten Schuß von uns über die Mauer zu springen. Eine Gruppe hält drüben im Maisfeld im Rücken der Peonhütten. Wir müssen schnell sein, schnell, Mattare!
Der Chiricahua war an der Ecke zum Seitenflügel. Nur Steinplatten hier, zwei, drei kleinere Ziersträucher, die kaum Deckung geben konnten. Dazwischen Gras… ein heller Kiesweg. Mattare hob warnend die Hand – in der Hand das Messer. Rechts, zum Gras, dachte Concho. Dorthin? Nun gut!
Er glitt wie ein Schatten über die Steinfliesen, kroch genau hinter Mattare her von der Mauer fort, lag hinter dem einen Zierstrauch. Mattare blieb reglos vor ihm liegen. Stimmen – zwei Männer, keine zwanzig Schritt entfernt.
»… werden bald kommen. Was meinst du? Noch mehr Gewehre für uns…«
»Die Kanonen reißen sie in Stücke, Louis hat es gesagt. Es macht einmal bumm, dann sind sie tot, und dann reiten wir nach Cerralvo, wir werden Beute machen, sage ich dir, Beute!«
»Ja, sehr viel Beute, bestimmt! Ob sie schreien werden? Was meinst du, ob sie wirklich ersticken müssen?«
»Felipe sagt es – und was Felipe sagt, das trifft immer ein«, antwortete der andere. »Was wollen sie denn tun, eh? Wir gießen das Öl durch die Fensterschächte und stecken es an. Dann werden sie dort unten braten, si! Und wenn sie wirklich noch leben sollten, dann bricht ihnen die Gewölbedecke über den Köpfen zusammen und erschlägt sie alle. Diese verfluchten Gringos, was haben sie in Mexiko verloren, eh? Haben sie uns noch nicht genug bestohlen? Und umgebracht… ah, wie viele von uns haben sie umgebracht, damals, als sie uns Texas wegnahmen? Mein Onkel starb, mein Vater… Jetzt verbrennen wir sie. Sie werden braten in der Hölle… braten!«
Mattare wendete den Kopf. Concho Hurst nickte. Dann schob sich Mattare in Querrichtung nach rechts. Der nächste Zierstrauch stand dort, und wenn sie weiterkommen wollten, mußten sie so kriechen, daß er in Richtung auf die beiden Posten Deckung bot. Zum Glück lag dieses Stück Garten im Schatten des Seitenflügels. Der Boden war dunkel, Mondlicht fiel hier nicht her.
Concho kroch erst ganz dicht an den ersten Busch heran. Mattare war schon sechs Schritt weiter und lag genau in Richtung des zweiten Busches und der beiden Posten. Concho sah sie jetzt. Sie hockten beide keine zwei Schritt vor der kleinen Mauer, neben der ein Loch gähnte.
Der Keller, dachte Concho, richtig, hier war der Keller. Mein Vater brachte Don Sebastiano Wein aus den Bergen von Almansor mit, schweren Wein. Wie lange ist das her… sieben, acht Jahre? Die Peons schafften die Fässer in diesen Keller.
Die beiden Posten hockten auf einem Geländer an der kleinen Kellerhalsmauer. Der eine Bravado ganz außen. Er saß schräg. Wenn es hell gewesen wäre, hätte er die Bewegung sofort aus den Augenwinkeln sehen müssen. Doch er sah jetzt nichts.
Concho glitt immer weiter in Querrichtung hinter dem Zierstrauch heraus. Er folgte Mattare. Der lag längst am zweiten Busch. Etwa zwölf lange Schritte von dort bis zu den Posten, aber – Mattare war genau in ihrem Rücken.
Als Concho ihn anstieß, schob er sich weiter.
Schnell, dachte Concho, sie sitzen da und schwatzen, aber wenn sich einer umdrehen sollte… In derselben Sekunde sprang der Chiricahua. Das Messer stieß jäh zu.
Ein Schrei vor Concho, ein kurzer, kaum hörbarer Schrei, jäh abreißend, erstickend. Concho sprang auch und schlug zu, traf den ersten Posten von hinten, schlug ihm den Revolver über den Hut, danach noch einmal. Der Mann sackte lautlos zusammen, und Concho sprang auf die Mauer. Von dort aus sah er den zweiten Bravado, der mit Mattare die Kellertreppe hinabgesaust war. Der Kerl fiel rücklings gegen den nächsten Balken, der schräg an die Tür gerammt worden war. Sein Anprall schob den Balken beiseite. Der glitt ab, rutschte ein Stück an der Tür tiefer, bis er blockiert vom Kellerhals festhing. Am Balken fiel der Bravado zusammen.
Mattare sah hoch. Er hob die Hand und die Schulter.
»Du konntest nichts dafür«, sagte Concho leise. »Der Schrei ist keine zehn Schritt weit zu hören gewesen. Sei ruhig – warten wir ab, ob was bemerkt worden ist.«
Der Chiricahua stand still, sie lauschten, aber es rührte sich nichts. Als sie die beiden Balken weghoben, sahen sie, daß der Türschlüssel im Schloß steckte. Der eine Balken hatte ihn verdeckt. Mattare glitt die Treppenstufen hoch. Er holte den anderen Bravado herunter, ehe Concho aufschloß. Hinter der Tür war Totenstille, gespenstische Ruhe.
»Bowlen«, flüsterte Concho – die Tür war einen Spalt auf. »Bowlen… Petersen… Cerringa… keinen Laut, kommt her, aber leise, um Gottes willen, seid leise! Kommt her, sagte ich, ich bin es… Concho Hurst. Hier ist Concho Hurst – hört ihr mich?«
Innen ein Kratzen, dann eine heisere, gepreßt klingende Stimme: »Alle Teufel, das ist wirklich Concho. Concho, hier ist Trevor. Mann, Concho…«
»Nicht laut werden, seid ganz leise – kommt raus, kommt schon, wir haben keine Zeit!«
Da waren sie – vier Männer, die unter seinem Vater gefahren hatten. Sie starrten auf den toten Bravado hinab. Trevor bückte sich und nahm dem Kerl den Revolver ab.
»Concho, Bowlen ist tot – Bradford hat es schwer erwischt. Was machst du hier – woher kommst du?«
»Später«, flüsterte Concho Hurst. »Hinaus mit euch, schnell! Mattare, bring sie alle zur Mauer. Sie sollen leise sein. Schleicht euch draußen zum Kornfeld, dort liegen Juaristas – Cerringa, du kennst den Capitano aus Cerralvo?«
»Ja«, nickte Cerringa. »Figurentes, ich kenne ihn gut. Diese Schurken – dieses Teufelsweib, Garcias Schwester, sie hat Bowlen kaltblütig erschossen. Sie haben unsere Waffen, sonst würden wir ihnen…«
»Hinaus, schnell!« keuchte Concho. »Keine Zeit für lange Reden. Hallo, Bradford…«
Bradford trugen sie hinaus. Er hatte einen dicken Verband um den Hals und sah Concho an, die Zähne fest zusammengebissen.
Mann für Mann huschte aus dem Keller. Sie drückten sich an der Mauer entlang, dann liefen sie einzeln auf die Gartenbüsche zu. Petersen und Trevor trugen Bradford.
Concho Hurst sah sie verschwinden. Er hielt den Colt in der Faust und wartete an der Hausmauer. Eine Minute verstrich, ein paar leise, kratzende Geräusche drangen zu ihm herüber. Aber im Haus selbst blieb alles still. Um die Hausecke fiel der Lichtschein der im Hof brennenden Lagerfeuer. Manchmal tauchte dort ein Schatten auf, fiel lang und düster bis zu den Bäumen zwischen Scheune und Haupthaus. Gleich darauf sah Concho die geduckte Gestalt des Chiricahuas heranhasten.
»Alle in Sicherheit, Mattare?«
Der Indianer nickte knapp.
Als sie über die Terrasse zur Hintertür huschten und sie leise aufdrückten, hörten sie Gelächter. In der Halle brannten zwei Lampen. Das Licht fiel auf die große, geschwungene Treppe zum Obergeschoß. Aber niemand war zu sehen. Die Vordertür stand offen – das Gelächter kam aus dem breiten Durchgang. Dort fiel Lichtschein in schmaler Bahn gegen die Wand. Mattare hob die Hand, sie zuckte zweimal auf jenen Lichtschein zu.
Ein Zimmer – das erste vorn rechts, dachte Concho. Dort sitzen ein paar der Halunken, sie lachen.
Der Chiricahua glitt los, Concho ließ die Tür einschnappen. Dann folgte er dem Indianer, sich immer an der Wand haltend, zur Treppe. Hier blieb Mattare stehen, er lauschte, hob die Hand und deutete nach oben.
»Ja«, zischte Concho, »hinauf, schnell!«
Sechs, sieben Stufen kamen sie hoch, als der Chiricahua jäh erstarrte. Er duckte sich plötzlich, er glich einem wilden Tier, als er den Kopf ruckartig hob und warnend die Hand nach Concho ausstreckte. Dann drehte er sich blitzschnell um.
Concho Hurst sah seine blitzschnelle, zuckende Handbewegung.
Erst in diesem Moment öffnete sich oben irgendwo eine Tür. Schritte über ihnen. Concho sah sich um. Es war zu spät, hinauszuhetzen, sie hätten die Hintertür niemals erreicht. Schritte – lauter jetzt – ein Klirren, eine barsche, wütende Stimme: »Zum Teufel, irgendwo muß es sein. Der Hund scheint wirklich nicht mehr im Haus gehabt zu haben…«
Mattare glitt wie ein Schatten unter die Treppe und winkte Concho Hurst. Sie krochen bis in den tiefsten Winkel und hockten in diesem von keiner Helligkeit getroffenen, dunklen Dreieck eng aneinandergepreßt.
Keine fünf Sekunden später kam ein Mädchen quer durch die Halle, es blieb jäh in der Mitte stehen, als hätte jemand es plötzlich angehalten durch irgendeinen Ruf.
Concho zuckte zurück, rührte sich nicht mehr. Er hörte, wie Sand knirschte, den viele Stiefel in die Halle getragen hatten. Ohne das Mädchen sehen zu können, wußte er, daß es sich umsah. Garcias Schwester stand mitten in der Halle.
Hurst brach der Schweiß aus. Er wußte, sie brauchte nur drei Schritt weiter nach rechts zu gehen, dann mußte sie sie sehen können. Jetzt – jetzt bewegte sie sich… der Sand knirschte, sie machte einen Schritt… noch einen…, und dann…
»Pablo!«
»Si, Patronata?«
»Wer war hier?«
Die Augen von Mattare und Concho begegneten sich.
»Eh… Don Felice und Carlos!«
»Niemand sonst, Pablo?«
»No, Patronata«, sagte der Mann vorn im Gang. »Es war niemand hier.«
»Niemand, und – was ist das nur…«
Ihre Stimme wurde leiser, sie murmelte vor sich hin. Dann setzte der Schritt wieder ein und verlief sich im Gang.
Concho atmete flach aus, wartete, bis alles ruhig war. Auch die beiden Bravados waren jetzt im Hof.
»Los, Mattare!«
Der Indianer flog aus dem dunklen Dreieck und blickte im Laufen in den Gang. Er sah den Rücken des Mädchens. Es stand seitlich der Tür unter dem Baldachin, unbeweglich blickte es nach links. Als der Indianer die ersten Stufen hinter sich hatte, sah er Maddalena Garcia nicht mehr. Concho folgte ihm, sie hetzten in langen Sprüngen, wenn auch leise, die Treppe empor, duckten sich, ehe sie oben waren. Der Indianer schob sich behutsam an die oberste Treppenstufe, tauchte über sie und blickte in den Gang. Der Gang war gähnend leer, nur einige Bücher lagen verstreut am Boden. Ein Schrank stand sperrangelweit auf, Papier raschelte, als sie darauf traten. Sie waren jetzt in jenem Gang, der im Obergeschoß quer vor den Zimmern herlief, deren Fenster zur Vorderfront des Hauses hinausgingen.
Mein Gott, dachte Concho, mein Gott, wo war das Arbeitszimmer? Die Tür hier… oder die?
Der Indianer blieb stehen, als Concho die Tür leise öffnete. Jäh traf sie der rote flackernde Schein der Feuer im Hof. Er fiel durch die Frontfenster in den Raum, strahlte über sie hinweg und an ihnen vorbei bis in den Gang. Im Zimmer war kein Mensch, aber es sah aus, als war eine Granate mitten im Raum explodiert. Schränke, Truhen – alles ausgeräumt – Papiere und Bücher am Boden… ein fürchterliches Durcheinander, umgekippte Stühle, einige aufgeschlitzte Sessel…
»Weiter!« zischte Concho. »Die nächste Tür!«
Sie war auf. Concho kam geduckt in das Zimmer, den Colt in der Faust. Das erste, was er sah, war das Bett. Der Mann lag gebunden und mit einem Knebel im Mund auf dem Bett. Sein Gesicht wurde vom roten Feuerschein in etwas Helligkeit getaucht – ein Gesicht, über das Blut gelaufen war, im eisgrauen, fast weißen Bart und im Kopfhaar klebte – ein verschwollenes Gesicht.
Der nächste Blick traf eine Chaiselongue. Ein Mädchen lag dort – die Arme über die Kanten gezogen, die Handgelenke an die Beine gebunden, einen Knebel zwischen den Lippen, auf dem Unterarm ein paar dunkle Stellen, wie von einem Stock, dessen Spitze glühend gewesen und auf ihre Haut gedrückt worden war. Conchos dritter Blick traf die Augen des Mädchens, große, weit offene dunkle Augen, die ihn starr ansahen. Er kam gegen das Licht herein, den Colt in der Faust, das Messer in der anderen Hand.
»Sagen Sie nichts!« keuchte Hurst. »Nicht schreien, nicht laut werden. Ich schneide Sie jetzt los, dann müssen Sie mir folgen. Draußen ist die ganze Garnison Cerralvos – die Hazienda ist so gut wie umstellt. Wir bringen Sie hinaus, hören Sie? Kennen Sie mich noch, Don Sebastiano… Don Sebastiano…«
Der Alte wendete langsam den Kopf, schien halb ohnmächtig zu sein und gar nichts begriffen zu haben.
»Don Sebastiano – ich bin Concho Hurst. Mein Vater belieferte Sie früher – vor dem Krieg – erinnern Sie sich? Ich bin Concho Hurst, ich bringe Sie hinaus, ehe die Juaristas angreifen. Don Sebastiano…«
Mattare huschte zum Fenster und hob die Hand. Der Blick des alten Haziendero folgte dem Indianer wie unter einem hypnotischen Zwang. Die Hände bewegten sich – redeten. Erst in dieser Sekunde sah Concho das Lächeln. Der alte Mann lächelte – die Sprache der Hände – jetzt wußte er, wer gekommen war.
»Gut«, keuchte Concho. »Sie wissen, wer wir sind. Wir haben die Garnison in Cerralvo alarmiert – aber wir kamen zu spät. Bleiben Sie ruhig – ganz ruhig. Wir müssen Sie unbemerkt hinausbringen, ehe die Juaristas stürmen. Und wenn es das letzte wäre, was Garcia tun könnte – aber er würde Sie beide töten. Sie müssen hinaus. Bleiben Sie ganz ruhig, Señorita Isabel…«
Er beugte sich über das Mädchen, schnitt ihr die Fesseln durch, nahm ihr den Knebel aus dem Mund. Sein Blick traf ihren Arm. Brandstellen… Zigarrenglut… Garcia!
Das Mädchen lag ganz still, nur ihre Augen ließen den Mann nicht los. Die Erinnerung war längst gekommen. Sie hatte ihn, beleuchtet vom Schein der Lagerfeuer draußen, hereinhuschen sehen. Das Gesicht… sie hatte es nie vergessen. Damals war sie fünfzehn Jahre alt gewesen, als ihre Mutter noch lebte und die Fiesta gefeiert wurde. Es war immer ein großes Fest, wenn auf der Hazienda Loma Bonita die Herrin Geburtstag hatte. Eine Fiesta-Feuer draußen, lachende, singende Menschen, die Klänge der Musiker aus Cerralvo…
Der Mann, dachte Isabel de Fiorentes, Concho Hurst… damals… sie waren gekommen, alle Nachbarn, weil es so üblich war. Darunter die Verwandten der Hursts, die Familie seiner Mutter. Reiche Leute, angesehene Leute, die eine Hazienda hier hatten.
»Mr. Hurst… Mr. Hurst…«
Concho sah auf sie herab, ein Lächeln um den schmalen Mund.
»Ich sagte doch, ich käme wieder…«
Er flüsterte nur, er lächelte.
»Concho Hurst…«
Die Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie weinte lautlos, spürte den Schmerz kaum am Arm.
»Ganz ruhig«, zischte er. Seine Hand war da, strich über ihr Gesicht. »Ganz ruhig, ich bringe Sie fort – in Sicherheit!«
Die Hand war schon wieder fort, der Mann huschte zu dem Bett hinüber, das Messer blinkte. »Mattare… was ist?«
Die Hände redeten.
»Gut – paß auf, Mattare!«
»Señor… Señor Hurst…«
»Nicht anstrengen – nicht reden, Don Sebastiano!«
»Señor Hurst«, flüsterte der Alte. »Ich bin verwundet… meine Hüfte… Schulter… Ich kann nicht gehen!«
»Wir werden Sie hinausschaffen, keine Sorge, Don Sebastiano. Nicht aufregen – ganz ruhig bleiben!«
»Señor Hurst – retten Sie meine Tochter… ich bin alt und müde… Meine Tochter, mein Kind…«
»Sie beide!«
Das war alles, was er sagte. Unten klirrte es, etwas schurrte metallisch. Mattare stieß einen jener Kehllaute aus, drehte sich um, seine Hände sprachen.
Mit einem Riesensatz flog Concho an das Fenster. Er sah den Mann kommen, einen großen Mann, den Colt an der Seite, das Mädchen mit den langen schwarzen Haaren neben ihm. Feuerschein beleuchtete sie – beschien das Gesicht des Mannes.
Wo, dachte Concho, wo habe ich das Gesicht schon mal gesehen? Ich habe es gesehen, aber wo?
Mattare stieß ihn an, beugte sich über den alten Haziendero. Unten kamen die beiden Männer, jeder ein Bündel Waffen auf den Armen, aus dem Haus. Sie gingen über den Hof.
»Mattare – schaffst du es?«
Die Handbewegung sagte alles – der Indianer zog Don Sebastiano hoch, drehte ihn um, legte ihn auf den Rücken.
»Miß… Señorita, kommen Sie!« Concho hob sie hoch, nahm sie auf die Arme.
»Concho Hurst…«
»Ja«, sagte er leise und trug sie schon durch den Gang zur Treppe. »Ja, ich habe immer an die Fiesta gedacht. Es war der schönste Tag meines Lebens, ehe das große Sterben drüben begann. Halten Sie sich nur fest…«
Er hat daran gedacht… der schönste Tag seines Lebens… Jetzt trug er sie auf seinen Armen die Treppe hinab. Mattare lief mit dem alten Mann zur Hintertür, stieß sie auf. Hinaus, nur hinaus.
Concho stürmte ihm nach, hörte irgendwo die Stimme jenes Mädchens mit der Leinenjacke, den Patronengurten und dem tödlichen Revolver im Hof, ehe er durch die Hintertür war. Isabel klammerte sich jäh fester an ihn und begann zu zittern. Auch sie hörte die Stimme.
»Oh, diese Teufelin. Sie ist eine Teufelin! Oh, dios, sie ist eine Teufelin!«
»Keine Angst, diese Teufelin wird nicht mehr lange leben, Isabel!«
»Sie ist furchtbar. Sie sagte, sie würde mich den Bravados überlassen und zusehen, sie sagte… oh, dios, was sie alles sagte…!«
Er lief schon mit ihr über die Terrasse, rannte dann quer durch den Garten auf die Mauer zu.
»Wer hat das mit Ihrem Arm getan, Isabel?«
»Garcia… er glaubte nicht, daß wir nicht mehr Geld im Haus hatten. Vater sollten gestehen…«
»Garcia«, knirschte Concho. »Garcia… Isabel, wer ist der Amerikaner bei Garcia – wer ist dieser Mann?«
»Sie nennen ihn Louis. Mehr weiß ich nicht, Louis.«
»Louis«, murmelte Concho Hurst. »Louis… Louis… Louis Charlton! Der Steckbrief in Fort McIntosh!«
Jetzt wußte er, wer der Mann war. Dann erreichten sie die Mauer. Don Sebastiano sank herunter, das Mädchen lehnte bleich an den Steinen.
Der Indianer brauchte nicht mehr auf die Mauer. Dort tauchten plötzlich Hände auf, Köpfe… Juaristas neben Texanern.
»Schnell, helft ihnen herüber!« zischte Concho. »Dann kommt, kommt, wir müssen sie überraschen, ehe sie merken, daß ihre Geiseln verschwunden sind, schnell doch…«
Er hob Isabel hoch, sah Arme nach ihr greifen. Ihr Blick suchte ihn noch einmal, dann war sie verschwunden. Auch den alten Haziendero schafften sie über die Mauer. Dann kamen die Juaristas, die Texaner tauchten auf, hatten Revolver bekommen. Immer mehr fielen über die Mauer – zwanzig, dreißig, vierzig Mann… immer mehr…
»Vorwärts!«
Ehe sie noch loslaufen konnten, drang der Schrei zu ihnen. Ein hoher, schriller und entsetzter Schrei gellte durch das Haus!
Maddalena Garcia, dachte Concho – es ist diese Teufelin! Sie ist im Haus, sie hat das Zimmer leer gefunden…
Und dann stürzte er vorwärts!
*
Sie drehte den Schlüssel um und stand im Gang.
Dieses hochmütige, kastilische Gesindel, dachte sie. Ich werde bei ihnen bleiben, und wenn wir verlieren sollten, dann bringe ich sie und mich um. Dieses stolze, verfluchte Pack, wir sollten sie…
Dann riß sie die Tür auf. Sie wollte den alten Don Sebastiano sehen, die Angst der Tochter schüren.
»Na, ihr…«
Ihre Stimme brach, ihre Augen weiteten sich jäh. Das Bett… der Lichtschein… ein leeres Bett, Stricke am Boden – niemand auf der Chaiselongue… das Zimmer… leer!
Die Angst schnellte in ihr hoch.
Sie schrie.
»Louis… Louis!«
Sie schrie seinen Namen. Dann flog sie herum, raste wie eine Furie durch den Gang an das Endfenster. Von hier aus konnte sie den Kellereingang am Seitenflügel sehen. Vier, fünf Sätze tat sie an der Treppe vorbei, dann sah sie nach unten.
Dort unten lag einer zwischen Balken im Kellereingang – lang ganz still auf dem Rücken… tot!
Plötzlich lief sie, sie stürzte zur Treppe, raste die Stufen hinunter, den Colt erhoben.
Louis sah sie. Sie lief mit wehenden Haaren aus dem Haus, stürzte schreiend auf ihn zu.
»Louis, die Gefangenen sind fort. Jemand ist im Haus. Er hat die Texaner befreit! Louis, schnell, Louis… sie sind überall, sie kommen! Louis…«
Sie krallte sich an ihm fest, riß ihn fast um. Dann zog und zerrte sie ihn herum.
»Die Pferde, Louis, auf die Pferde! Die Gefangenen sind frei!«
An den Feuern sprangen die Bravados auf und starrten verstört zu ihnen hin.
Mein Gott, durchfuhr es Charlton, das ist kein Wahnsinn, sie bildet sich nichts ein. Los, zu den Pferden, zu den Pferden und raus hier! Was – was ist dort? Was denn, was läuft da, was kommt dort, was…?
Er sah sie hinter jenen Feuern weit hinten im Garten. Dort kamen Schatten, rannten über den Rasen, stürmten an Büschen vorbei auf die Bäume zu. Sie kamen – es waren viele… viele. Sie wollten in den Hof, sie rannten wie schweigende, todbringende Schatten…
»Lauf!« brüllte Charlton und hatte den letzten Wagen erreicht. »Lauf, nimm die Pferde! Hinaus, warte auf mich, hinaus!«
Plötzlich wußte er, daß alles verloren war. Er hörte die Bravados schreien. Er sah sie an die Scheunen rennen. Sie hatten die Schatten wie er gesehen. Ihre Schreie gellten durch die Nacht. Und dann war plötzlich das heulende, schrille Angriffsgeschrei der Juaristas da. Sie hatten diesen Schrei von Benito Juarez und dessen Yaqui-Indianern übernommen.
Ein fürchterlicher Ruf, ein langgezogenes, grauenhaftes Heulen, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Der Tod kam, die Schreie kündigten ihn an.
»Lauf!« brüllte Charlton, seine Stimme überschlug sich. »Lauf doch!«
Er warf sie auf ein Pferd, drückte ihr die Zügel eines anderen in die Hand.
»Weg mit dir – hinaus!«
Jetzt – jetzt war das nervenzerfetzende Heulen der Angreifer überall. Es kam von allen Seiten. Schüsse knatterten belfernd los. Da holte er aus, gab dem Pferd einen Schlag, sah rechts einen der Bravados aus dem Corral rasen. Der Mann hing im Sattel, das Gatter stand auf, die Pferde preschten ihm nach. Es waren zwanzig, dreißig, immer mehr. Sie rasten auf die Wagen zu. Zwei, drei andere Bravados rannten schräg auf die Pferde zu, hetzten neben ihnen her, sprangen auf, während die Pferde, verrückt geworden durch dieses fürchterliche Angriffsgeschrei, durchgingen.
»Weg!«
Er schlug zu, das Pferd sprang an.
»Louis!« schrie sie gellend. Ihre Stimme ging im Dröhnen der Hufe, im Krachen der Schüsse unter. »Louis…!«
Fort, vorbei, weggejagt!
Charlton flog herum, seine Augen glühten. Etwas tun, nicht sterben wollen – etwas tun!
Links sah er sie liegen und schießen. Sie lagen unter den Wagen – Bravados, die eine andere Mentalität als Amerikaner hatten. Bravados kämpften, auch wenn es aussichtslos war, weil sie wußten, daß sie sterben mußten. Und mußten sie sterben, dann taten sie es auf ihre Art… sinnlos, das war gewiß, aber sie starben lieber kämpfend.
Charlton war herum und packte den Lafettensporn der Kanone. Was wog schon eine vierpfündige Gebirgskanone?
»Herum mit dir!« schrie Charlton, wuchtete, stemmte sich ein. »Geh doch – verdammtes Ding – herum!«
Feuerschein auf dem Bronzelauf, das grelle Heulen eines Querschlägers, der den Lauf traf. Das Singen einer Kugel, die gegen den Radreifen prallte. Charlton schwenkte die Kanone.
Da – da, sie kamen, sie rannten näher, sie stürmten.
Kommt, dachte er. Kommt doch. Das Ding und ich… das Ding hier… wartet nur…
Die rechte Hand fiel auf die Kurbel der Höhenverstellung. Die Spindel wirbelte, der Schubstangenhebel ruckte, das Maul der Kanone senkte sich.
Genug, dachte Charlton. Die Linke fuhr in die Tasche, riß das Streichholz heraus. Er sah über den Lauf, sah die Schatten, hatte das gellende Geschrei in den Ohren. Luft, dachte Charlton, die macht mir Luft, die verschafft mir zehn Sekunden, wette ich. Luft… Luft!
Das Streichholz zischte, die Schnur war da, ein bläuliches Flämmchen raste los. Und sie liefen, sie kamen – diese Narren. Sie kamen tatsächlich, liefen zwischen den Bäumen durch, trampelten über die Erde, auf die das Maul der Kanone zeigte.
Charlton duckte sich tief, rannte los, lief im Zickzack. Sechs Schritt kam er von der Kanone weg – acht, neun…!
In dieser Sekunde kam das Brüllen und schien die Gebäude einstürzen lassen zu wollen. Ein Donner, ein schmetterndes, grollendes Bersten! Und dann Schreie – gellende, furchtbare Schreie…
Er sah sich um, sah gar nichts, nur eine Wolke dort, wo die Kartätschengranate gegen den Boden gedonnert war, wo hundertzwanzig Kugeln im brüllenden Explosionsknall nach allen Seiten gespritzt waren.
Laufen, Charlton, Zickzack… Haken schlagen… Lauf, Mann! Etwas schwirrte, jaulte, fauchte, pfiff an ihm vorbei. Er lief, raste auf das Tor zu, hielt sich ganz links an den Ställen. Nur nicht mitten im Hof und gegen das offene Tor wie eine Zielscheibe rennen!
Vor ihm rannten zwei Bravados, schrien, machten den Fehler, den ein Mann wie Charlton niemals gemacht hätte. Sie kamen fast bis ans Tor. Den ersten erwischte es, ehe er die Höhe des Tores erreicht hatte. Er schlug einen Purzelbaum wie ein Hase. Den zweiten Narren traf es, als er mitten im Tor war. Er lief schreiend noch zwei Schritte, ehe er auf das Gesicht stürzte.
Charlton kam, fegte mit zwei Riesensätzen um den Torflügel, rannte dann am Mauerpfosten vorbei. In dieser Sekunde erwischte es ihn. Der Hieb traf sein Bein. Er knickte zusammen, schlug hin. Schmerz im Bein, aber er rollte sich weg. Bloß nicht im Tor liegenbleiben, nur nicht gerade hier aufstehen, wenn – wenn er es noch konnte.
Er schaffte es, er kam hoch, Schmerzen im Bein, ein Brennen, ein Stechen bis in die Hüfte. Jetzt sprang er in seltsamen hüpfenden Sätzen nach rechts. Linker Hand sah er Felipe rennen, auf die Pferde zustürzen. Mit Felipe liefen jedoch keine sechs Mann. Dafür tauchten Juarista-Soldaten an den Peonhäusern auf, schossen, schrien, rannten wie Teufel hinter Felipe und dessen letzten Leuten her.
Charlton raste nach rechts und hörte den Schrei.
»Louis, hierher! Louis, komm!« Maddalena – Maddalena, dort kam sie und trieb die Pferde auf ihn zu. »Louis, Louis, schnell!«
»Komm, du verdammte Närrin! Kommst du?«
Garcias Stimme, heulend fast, schrill vor Wut und Angst.
Idiot, du verfluchter Idiot, dachte Charlton. Er zog sich hoch und sah sie losjagen – Garcia mitten unter den anderen. Felipe nun mit nur noch vier Mann hinter Garcia her.
»Louis… Louis, wohin, wohin?«
»Nicht nach – dieser Idiot! Da oben rennen sie, sieh doch!«
Sie schrie vor Entsetzen, als sie im Mondlicht die Gestalten der Bravados in wilder Flucht den Hang herabsausen sah. Hinter den Bravados tauchten Reiter auf, jagten schnell näher, drohten sie einzuholen. Sie kamen auch Garcia in die Quere und blockierten ihm den Rückweg.
»Louis, Felice… wir sind umzingelt. Louis, wir kommen nicht heraus!«
»Sei ruhig!« schrie er sie an. »Komm mit!«
Irgendwo in ihm war doch ein warmes Gefühl für sie. Sie hätte mit ihrem Bruder davonjagen und ihn im Stich lassen können. Aber sie hatte gewartet und ihm sein Pferd gebracht.
Charlton preschte auf den angeblichen Heuhaufen rechts zu. Dort war kein Mensch mehr. Diese Narren waren fortgerannt und hatten sich auf die Pferde geworfen. Jetzt steckten sie mit Garcia in der Falle. Dieser Idiot hatte nicht rechnen können, war blindlings geflohen. Nun war der Weg versperrt. Die Juaristareiter formierten sich zu einer Linie, preschten auseinander, bildeten eine Kette. Die Kette mußte sie alle erwürgen!
»Louis, was – was tust du?«
Er flog aus dem Sattel, knickte um, fiel hin, aber er fiel neben die zweite Kanone. Erst als er stöhnend hochkam, den Sporn packte, wuchtete und die Kanone schwenkte, begriff sie.
»Halt das Pferd eisern fest!« schrie er sie an. »Abstand, sonst gehen sie durch. Die sind das nicht gewohnt. Äh, Felice… General Felice… Idiot verfluchter… Wohin jetzt, he? Zurück zur Hazienda? Da bringen sie euch auch um! Paß auf, du größenwahnsinniger Narr! General Felice Garcia… haha!«
Er mußte plötzlich lachen. Lachte wie ein Irrer, als er kurbelte und das Rohr sich hob. Noch einmal schwenkte er den Lauf ein Stück seitwärts.
Dann zielte er kurz und nahm das nächste Streichholz. Der Vierpfünder zeigte auf die Kette Reiter. Sie ritten in den Schuß hinein, Charlton wußte es. Wenn es auch nicht die Reiter voll erwischte – es würde einen Teil der Pferde treffen. Und damit war eine Lücke da, war ein Weg frei. Mit dem Gedanken rannte Charlton auf sein Pferd zu und schwang sich hoch.
»Los, komm. Komm mir nach!«
Vielleicht begriff sie gar nicht, was er meinte, aber sie folgte ihm blindlings, weil sie ihm vertraute. Charlton ritt so schnell er konnte, war jedoch noch keine drei Längen davon, als das Brüllen kam und sein Pferd durchzugehen drohte. Es raste los, stob auf die Wolke zu, die jäh am Hang stand.
Dort jagten Pferde auseinander – reiterlose Pferde. Dort wälzten sich andere Pferde und Reiter am Boden. Der eine Schuß hatte gesessen, schaffte ein größeres Loch, als Charlton jemals gedacht hatte. In panischer Furcht nach diesem gewaltigen Knall jagten die Pferde einfach davon, und ihre Reiter konnten sie nicht zügeln.
»Komm, Maddalena, komm!«
Sie war an seiner Seite, sah sich nach ihrem Bruder um. Der erkannte die Chance, wendete – und nun fegten auch Garcia und seine Leute in die Lücke und preschte den Hügel hinauf.
»Jetzt hat der Narr begriffen!« schrie Charlton. »Endlich hat er verstanden! General Felice Garcia…«
Das Gelächter schüttelte ihn so, daß er im Sattel schwankte. Er ritt weiter, er wußte, sie würden ihm nachkommen, und er fegte auf die Büsche und die dort stehende Kanone zu. An der war keine Seele zu sehen. Die Bravados waren fortgerannt, die Juaristas hatten sie verfolgt – und die Kanone stand hier verlassen. »Warte, Maddalena!«
»Louis, Louis, ohne dich wären wir verloren gewesen!«
Gewesen, dachte er, als er den Sporn anhob und die Kanone leicht schwenkte, über die heraufrasenden Bravados und Garcia hielt, während sich unten die Juaristareiter neu formierten und die Verfolgung aufnahmen. Ich werde sie aufhalten mit diesem letzten Schuß, aber ganz stoppen kann ich sie nicht. Es sind genug übrig…, und wir haben keine zwanzig Mann mehr. Haha, verloren sind wir so oder so…
Er wußte, er hatte nur noch eine Chance… Er mußte sie alle verlassen und wegreiten – allein!
*
Mondlicht lag über dem tiefen Taleinschnitt, Felsen in bizarren Formationen.
Jetzt, dachte Chariton, höchste Zeit für mich. Der verdammte Schurke Garcia! Als hätte er es gerochen, was? Bleibt der Hundesohn die ganzen Stunden an meiner Seite. Endlich ist er weg. Der Teufel soll ihn holen!
Garcia war nun vorn. Dort ritt auch Felipe. Der kannte die Sierra, hatte hier jahrelang gejagt. Felipe führte, Pacco, sein Bruder, hing mit einem Brustverband mehr tot als lebendig neben ihm auf seinem Gaul. Dann kamen die anderen – und zwischen ihnen nun Maddalena.
Maddalena, dachte Charlton, tut mir leid, Maddalena. Sie sind uns auf den Fersen, keine halbe Meile hinter uns. Wie immer du zu anderen gewesen bist – zu mir warst du wie meine Frau. Ich werd nie wieder ein Mädchen wie dich haben – nie mehr. Tut mir leid für dich, Maddalena, tut mir leid…
Staub kam, Sandboden war da. Der Staub hüllte die Reiter ein.
Plötzlich belferte es vor ihnen los. Gewehre peitschen keine dreihundert, vierhundert Schritt vor ihnen durch die Mondnacht. Das Feuer nahm nach wenigen Augenblicken zu, bis es sich anhörte, als kämpften dort zweihundert Mann.
»Louis, was ist das, Louis?« schrie Maddalena und jagte zu ihm zurück.
»Sie haben uns überholt«, stammelte Charlton mit bleichen Lippen. »Allmächtiger, ich verstehe es nicht, aber sie müssen uns überholt haben – und sie kommen auch von hinten! Maddalena, darum – darum sind sie hinter uns geblieben, sie hielten Abstand. Und wir dachten, als die Entfernung größer wurde, daß wir sie abhängen konnten. Oh, wir Narren! Ein anderer Trupp muß uns überholt haben und hat den Weg versperrt. Wir sitzen in der Falle, Maddalena…«
»No… no, das ist nicht wahr, Louis. Das darf nicht wahr sein! Louis…«
Sie schrie auf, als zwei, drei durchgehende Pferde vor ihnen auftauchten. Auf dem einen Pferd lag Pacco und brüllte, daß vorn niemand durchkäme, alles sei verloren. Kaum war er bei ihnen, als noch mehr Männer kamen. Garcia erschien mit aschfahlem Gesicht, versuchte das Pferd aus der Schlucht zu treiben, aber die Wand war zu steil. Der Gaul strauchelte, überschlug sich dann. Garcia tauchte heulend vor Wut aus der Staubwolke auf. Dann rannte er vor den anderen her den Hang hinauf. Sie machten es ihm nach, ließen ihre Pferde stehen, aber die letzten zwei Mann waren noch nicht ganz oben, als Reiter auftauchten und schossen. Es gab nur dünne Staubfahnen, die den Weg der fallenden Körper anzeigten.
Charlton hielt Maddalena gepackt, riß sie mit sich. Sie waren rechtzeitig über die Schlucht gekommen und liefen nun auf eine Bergflanke zu, um die tief unten die Schlucht im Bogen führte. Steine kamen, Felsblöcke, es ging immer höher.
»Lauft doch, lauft!« brüllte Garcia, der so wenig wie die anderen bemerkt zu haben schien, daß Charlton und Maddalena verschwunden gewesen waren. »Höher hinauf, immer höher. Da oben bekommen sie uns nicht. Sie müssen auch zu Fuß klettern, können ihre Pferde nicht gebrauchen. Höher… ganz oben hinauf. Vielleicht geht es dort weiter!«
»Louis, ich – ich kann nicht mehr. Louis…«
»Komm«, sagte er heiser. Er hatte den Mund voller Staub und konnte kaum sprechen. »Ich stütze dich.«
»Dein Bein, Louis, du kannst doch nicht gut gehen. Louis…«
»Komm weiter!«
Er hielt sie an der Hand und kletterte höher. Von oben sah er sie kommen – sie waren rechts und links über die Schluchtwand gestiegen und gingen den Berghang von zwei Seiten an. Es waren fast vierzig Mann – und sie waren noch zwölf – ganze zwölf!
Felipe, der Pacco nicht hatte helfen können, Felipe war der erste, der ganz oben war. Hundertachtzig Schritt über der Schlucht. Er blieb stehen und schwieg. Dann setzte er sich.
»Felipe – Felipe!« brüllte Garcia.
»Felipe, warum hältst du an? Felipe, was ist?«
»Nichts«, sagte der Mischling mit stoischer Gelassenheit. Er wirkte vollkommen ruhig. »Ich bin kein Vogel!«
»Was? Bist du verrückt? Was sagst du da?«
»Ich kann nicht fliegen, General!«
Garcia kletterte, fluchte, bis er aufschrie, als er an Felipe vorbei wollte und jäh den schwindelnden Abgrund vor sich hatte. Es war nichts vor ihnen außer Luft. Die Wand fiel fast senkrecht in die Tiefe, sie war länger als vierhundert Schritt. Vielleicht hätten sie noch einmal entwischen können, aber die Juarezsoldaten schienen genau zu wissen, daß es keinen Ausweg mehr gab, sobald sie rechts und links weit genug in die Höhe gekommen waren. Sie stiegen jetzt bereits tief unten wie in einem gewaltigen Halbkreis durch die Felsen.
»Diablo… Teufel, Teufel!« brüllte Garcia. »Aus! Alles aus! Verkriecht euch zwischen den Felsen, versteckt euch! Jetzt sollen sie erst einmal versuchen, uns zu holen. Sie müssen herauf – und wir sehen sie. Wir schießen ihnen die Köpfe ab, wenn sie uns zu nahe kommen. Verteilt euch, schnell!«
Unten peitschte es trocken und hart durch die Mondnacht. Einer der Männer schrie auf und fiel zwischen die Steine. Die anderen waren binnen drei Sekunden verschwunden. Sie verkrochen sich nun alle an dieser Seite des Berges. Das Schießen setzte von unten ein, die Kugeln irrten meist als Querschläger ab.
»Louis«, sagte Maddalena neben ihm dünn und zitternd, »Louis, es ist aus, ja?«
»Ja«, antwortete Charlton dumpf. »Komm nach, wir müssen hier weg. Sie könnten dich treffen!«
Er kroch vor ihr her, während die anderen schossen, und Garcia schrie, sie sollten die Patronen sparen, solange diese Hunde da unten ihnen nicht zu nahe auf das Fell rückten. Charlton schob sich um die letzten Felsen nach oben. Er erreichte einen kleinen Vorsprung und sah unter sich die Wand steil in die dunkle Tiefe fallen. Aber sie lagen hier sicher vor Kugeln.
»Louis, hörst du… sie schießen nicht mehr. Louis…«
Sie lag neben ihm, das Gesicht an seiner Schulter.
»Ja, sie wären Narren, wenn sie es täten. Sie brauchen nur zu warten. Die Sonne wird kommen, der Durst. Vielleicht halten wir es zwei Tage aus, vielleicht auch drei. Dann können sie uns einsammeln.«
»No, wir werden kämpfen!«
»Kämpfen – hier?« fragte er verwundert. »Das ist doch Wahnsinn. Es ist aus, begreifst du nicht?«
»Es ist aus, wenn man keine Patrone mehr hat.«
Charlton sah sie an und tastete nach seinem Bein.
»Laß«, sagte sie, »ich verbinde dich. Morgen sind wir tot… vielleicht erst gegen Mittag, aber… wir werden sterben, Louis. Weißt du, ich habe es immer gewußt. Wir hätten zusammen leben und alt werden können. Oder wir mußten jung sterben. Nun sterben wir…«
Sterben, dachte Charlton. Ich nicht! Und wenn, dann schieße ich so lange, bis sie mich erwischt haben!
»Louis… Louis!«
Das Krachen war da wie die grelle, sengende Mittagssonne. Ein Brüllen, ein Prasseln folgte, ein massenhaftes Klatschen und Heulen.
Maddalena schrie, preßte sich jäh an ihn, sie zitterte am ganzen Leib.
»Louis, was war das?«
»Die Kanone«, sagte er kaltblütig. »Sie haben eine hergebracht. Ich dachte es mir schon. Jetzt haben sie das verdammte Ding dort unten. Sie brauchen nicht mehr aus den Gewehren auf uns zu schießen, sie haben die Kanone. Keine Angst, uns erreicht nichts.«
»O Gott – dios, dios, wer – wer schreit da so, Louis?«
Jemand schrie wie ein Tier, das in der Schlinge sitzt.
»Einer der anderen«, murmelte er. »Die Kartätschenkugeln fliegen überall hin. Einen hat es erwischt. Es war ein schlechter Schuß – zu tief. Der nächste wird besser sitzen!«
Sie klammerte sich an ihn und wartete. Charlton lag still, er zählte die Sekunden. Zehn Sekunden für einen mittelschnellen Kanonier, die Zündschnur einzuführen, weitere zehn, um die Pulverladung festzustoßen, fünf bis zehn für die Granate. Für das Richten würden sie fünfzehn Sekunden brauchen – mehr nicht. Diese Gebirgskanonen waren schnell eingerichtet.
»Was zählst du?«
»Sie schießen gleich – paß auf…, jetzt ungefähr müßten sie fertig sein.«
Rumms!
Ein Doppelecho, ein berstender Knall kurz hinter ihnen. Das Pfeifen von Kugeln in der Luft, das heulende Geschrei von Männern. Jemand schrie, daß sie hochrennen sollten, aber als wirklich einer über die Felsen tauchte und auf dem schmalen Band, auf dem auch Maddalena und Charlton lagen, Deckung suchen wollte, knatterten unten die Gewehre. Der Mann schrie gellend auf. Dann fiel er in die Tiefe.
»O Gott, Louis…«
»Sei ruhig, sie schießen gleich wieder. Hier kommt keiner mehr hin, die schießen sie ab, sobald sie eine Nasenspitze sehen. Gleich…«
Das Brüllen war da, der schmetternde Schlag, mit dem die Kartätsche sich zerlegte. Wieder schrien Männer, jemand wimmerte klagend. Gewehrfeuer setzte von oben ein. Garcias heisere, sich überschlagende Stimme kreischte: »Schießt! Schießt! Trefft die Hunde hinter der Kanone! Ah, es ist zu weit. Teufel, ihr müßt höher halten – zielt über sie! Diese Hunde, sie schießen mit der Kanone!«
Es peitschte und knatterte, bis das nächste Brüllen alle anderen Geräusche fortblies.
»Garcia… Garcia!« wehte gleich darauf das Echo die Stimme zu ihnen hin. »Garcia… ergeht euch, sonst schießen wir weiter! Garcia – antworte!«
Garcia antwortete nicht. Aber Felipe sagte etwas.
»Er ist tot! Wollt ihr euch ergeben?«
»No«, sagte jemand. »Niemals. Sie sollen mich nicht lebend…«
»Tot… tot?« Das Flüstern war neben Charlton, ein Würgen. »Louis, hast du – gehört?«
»Ja!«
»Er ist tot – mein Bruder ist tot!«
Sie kroch ganz eng an ihn, ihre Hände krallten sich in seine Schultern.
»Louis, Louis, wir müssen sterben.«
»Nicht hier, sie erreichen uns mit keiner Kugel, Maddalena. Tut mir leid um deinen Bruder, aber…«
»Ja, es – es ist gut, Louis. Ich – ich liebe dich, ich liebe dich, hörst du? Louis…«
Plötzlich sprang sie auf.
Er jagte hoch, weil sie unten schossen. »Runter, Maddalena, runter…«
Er schrie einmal, als sie sich herumwarf und ihn festhielt. Er sah nun ihr Gesicht vor sich und reagierte zu spät. Es gelang ihm nicht mehr, sie fortzustoßen. Sie hing an ihm, als wäre sie festgewachsen.
So warf sie sich zur Seite und fiel über die Kante. Sie riß ihn mit und sah ihn an, während sie in die Tiefe stürzten. Es gab keine Gedanken mehr bei diesem Fall, dem ersten Aufprall an irgendeinem Zacken. Sie fielen gemeinsam in die Tiefe.
Louis Charlton hatte die Schwester des Teufels geliebt.
Jetzt folgte er ihr in die Hölle.
*
Es war ein Jahr später, Juarez schon Präsident, die Banden verjagt, Frieden über Mexiko.
Mondschein lag über der Hazienda, die Zikaden schrillten ihr Lied. Laternen hingen überall, Feuer flammten durch die Nacht.
Fiesta auf Loma Bonita. Musik hinter den Mauern, lachende, tanzende Menschen. Der Brunnen plätscherte leise. Das Mädchen saß auf seinem Rand, die Hand fuhr durch das Wasser.
Sie tanzen, dachte sie. Mein Geburtstag, meine Fiesta. Alle sind fröhlich, weil die Herrin von Loma Bonita ihre Fiesta gibt. Die erste im Frieden.
Gelächter überall. Gläser klirrten. Jemand sang von der Nacht, von Ramona und Liebe…
Liebe, dachte sie, Liebe? Ob er weiß, was Liebe ist, der Mann, der Amerikaner mit den hellen Augen? Vor einem Jahr ging er fort, er sagte, er käme wieder, wenn er soweit wäre. Wann kommt er, wann ist er soweit… wann? Er hat gelächelt, als er davonfuhr mit den Wagen.
Sie beugte sich vor und starrte ins Wasser. Sie sah einen Schatten in jenem Spiegel, der sich nun verzerrte. Jemand stand hinter ihr. Sie hatte ihn nicht gehört. Die Musik war zu laut, die Gäste zu fröhlich…
Der Mann stand da und sah auf sie herab. Er war groß, hatte blauschwarzes Haar und ganz helle Augen, wie das Wasser des San Juan Rivers unter der Mittagssonne.
Mein Gott, dachte sie, mein Gott – und dann hob sie den Kopf.
»Ich bin soweit – und ich bin da!«
Als er die Hand ausstreckte, legte sie ihre Finger hinein. Er schloß die Hand vorsichtig und doch fest. Dann zog er sie empor, sah sie an und lächelte.
»Komm«, sagte er leise. »Es ist acht Jahre her – wir haben acht Jahre nachzuholen, Isabel, oder?«
»Concho!«
Sie flüsterte nur. Sie war mittelgroß und reichte ihm knapp bis zur Schulter.
»Concho…«
Don Sebastiano sah sie gehen, sah dieses Lächeln, das den Mann Concho Hurst traf. Neben Don Sebastiano stand sein Sohn und Erbe. Auch er sah es und blickte seinen Vater an.
»Also er…«, sagte der Sohn und Erbe leise. »Und du – was sagst du dazu?«
»Ein Hurst«, sagte der alte Mann. Er lächelte, wenn auch etwas wehmütig. »Sie holen sich ihre Frauen immer aus diesem Land, mein Sohn. Ich hätte es schon wissen müssen, als sie begann, englisch zu lernen…«
»Wie sie jetzt lacht!« staunte der Bruder. »Vorhin traurig, als ob es nicht ihre Fiesta war. Und jetzt… sie lächelt, als hätte ihr jemand ein Geschenk gemacht!«