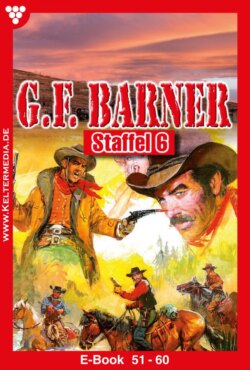Читать книгу G.F. Barner Staffel 6 – Western - G.F. Barner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHarry Lowman sitzt am Boden, ein stoppelbärtiger, ungepflegter Bursche, der mehr als ein Jail von innen kennt. In seiner Umgangssprache heißt das: Er hat gesiebte Luft geatmet. Nur Lowman selbst hält nichts von dieser gesiebten Luft. Sie ist zumeist ungesund.
»Oh, Hölle«, sagt Lowman. »Dieser Halunke, dieser Gauner! Der ist ja noch schlechter als ich! Großer Geist, der ist wahrhaftig noch verflucht schlechter, als ich es jemals gewesen bin!«
Das will einiges heißen, kann doch kaum ein Mensch schlechter sein als Lowman, der Mann, der ein Leben zuviel besitzt. Warum, das wird man noch sehen. Im Augenblick fühlt Lowman nichts als eine so irrsinnige Wut, daß er jeden Menschen in seiner Nähe umbringen könnte.
Gestern hat er den Kerl getroffen – Amandeus Hipokrates Mortimer – so hat dieser Windhund, dieser greuliche, sich genannt. Ein biederes Gesicht, kein so gemeines wie das Lowmans. Ein sanftes, freundliches Gehabe hat der Kerl an sich gehabt. Salbungsvolle Worte hat er geleiert, wie ein greulicher Weltverbesserer. Und mit Lowman gespielt und gewürfelt. Und verloren hat er, der greuliche Säuseler, nicht viel, beileibe nicht, drei Dollar und ein paar Cent. Danach hat er gesagt:
»Mr. Lowman, ich würde dir gern noch einige Becher Gesellschaft leisten, aber ich habe leider kein Geld mehr. Darum laß mich erquicklich ruhen, ich bedarf des Schlafes.«
»Der Schurke«, sagt Lowman gurgelnd und ballt die Hände, als wenn er den feisten Kerl am Hals hält und zudrückt. »Erquicklich schlafen, der Ruhe bedürfen. – Oh, ich verdammter Idiot, daß ich auf sein Gesabbere hereingefallen bin, ich, Lowman, ausgerechnet ich! Meiner Treu, wenn ich den erwische. Da werde ich doch munter. Das Feuer ist beinahe aus. Und was ist vor mir? Das ist doch – denke ich – und weiter hab’ ich wirklich nichts gedacht. Da kauert der Kerl vor mir. Und hat seinen Revolver in der Hand. Und den haut er mir – Hölle und Verdammnis – mitten auf meinen alten Hut. Und nun ist er weg.«
Lowman sitzt da. Blickt sich um und sieht nichts mehr. Sein Pferd ist weg, sein Maultier ist davongeflogen, samt Ausrüstung. Nur sein Gewehr und den Revolver hat Lowman noch.
Daß er ein Pferd haben muß, das versteht sich ganz von allein. Ohne Pferd ist ein Mann kein Mann
mehr.
In dem Moment, in dem Lowmans Gedanken sich auf ein Pferd und die Beschaffung eines solchen vierbeinigen Untersatzes richten, ist Lowmans Serie von Verwünschungen gegen Hipo Mortimer beendet.
Und nun sieht Lowman anders aus. Er wirkt kalt, grimmig und entschlossen. Seine schwarzen, scharfen Augen richten sich auf einen unbestimmbaren Punkt am Himmel.
»Ich muß einen Gaul haben!« sagt er finster.
»Hipo Mortimer, ich wette, es dauert keine drei Tage, dann sehen wir uns wieder. Und dann drehe ich dir nicht nur die Ohren und die Nase nach hinten?«
Zwölf Meilen bis zur nächsten Stadt. Vier Stunden für Lowman, der schon immer schlecht zu Fuß war.
*
Der Junge ist ganze sechzehn Jahre alt. Er hat vom Leben noch keine allzu große Ahnung. Darum kennt er auch nichts davon, wie es ist, wenn man ein Leben zuviel besitzt.
»He, Archie, bist du bald fertig?«
»Ja, Mr. Williams, gleich!«
Er hebt den Kopf und sieht zur Tür des Glasverhaus hinten im Store. Dort ist die Lampe an. Williams sitzt am Tisch, der eine grüne Filztuchplatte hat. Neben ihm steht die Petroleumlampe mit dem gelben Schirm. Und vor Williams die Tageskasse, ein Geldkasten aus Blech mit einem Vorhängeschloß. Den Kasten nimmt Williams immer mit hoch in sein Schlafzimmer.
Der Geizkragen, denkt der Junge, zwanzig Dollar im ersten Gehilfenjahr für den Monat. Dabei muß ich alle Arbeit machen. Und der Kerl ruht sich aus. Nur wenn eine Lady in den Laden kommt, dann dienert er und macht Bücklinge, daß er mit der Nase den Staub vom Tresen wischen könnte, wenn es dort welchen gäbe.
Gregory Williams zählt sein Geld und rechnet aus, was er heute verdient hat. Fünfhundertsiebzehn Dollar und achtundsechzig Cents in der Kasse. Ein ganz guter Tag, wie?
Einen Moment stützt Williams den Kopf in die Hand und streicht sich über die zerfurchte Stirn. Nachher noch ein Spielchen machen, nur ein kleines, und zwei Gläser Porter trinken. Wird der Bengel denn nie fertig?
»He, Archie, wie lange dauert es denn noch?«
Archie arbeitet schon vor dem Glaskasten und fegt den Schmutz auf die Kehrschaufel.
»Ich bin fertig, Mr. Williams!«
»Na, das wird auch Zeit. Du kannst abschließen, Archie. Ist der Schuppen auch zu?«
»Ja, Mr. Williams, ich habe ihn vorhin verschlossen.«
»Hast du es auch nicht wieder vergessen, Archie?«
Williams gähnt, greift nach der Kaffeekanne und gießt sich lauwarmen Kaffee ein. Eine Frau müßte man haben, schade, die nette Molly Higgins von den Sattler-Higgins ist zur Küste gezogen. Aber Lydia Blooming von den Bäckerei-Bloomings, die sollte man heiraten.
Williams trinkt Kaffee und schließt die Augen. Das Geschäft läuft gut, warum eigentlich keine Frau nehmen? Die kann den Store besorgen, damit Williams seinem Vergnügen, dem Fischen, manchmal nachgehen kann. Am Fluß sitzen und angeln, wie?
Archie, der Junge, geht zur Hintertür. Dort ist ein Vorhang in der Ecke, hinter dem Handfeger und Kehr-schaufel ihren Platz haben. Der Besen wird an den Haken gehängt. Williams kann wild werden, wenn man Besen oder Handfeger auf die Borsten stellt oder legt. Er will den Besen aufhängen.
Als er den Vorhang aufzieht, kommt eine Hand heraus und packt ihn jäh am Hals.
Lowman greift zu wie jemand, der ein Stück Eisen umklammern will. Schon eine halbe Stunde hat er hinter dem Vorhang gestanden und genug gesehen: Williams und den Geldkasten, die Scheine und Münzen.
Lowmans Hand packt den Jungen, gleichzeitig macht der Bandit einen wilden, kurzen Schritt nach vorn und zieht das rechte Knie blitzschnell hoch.
Der Junge ist starr, knickt dann aber lautlos ein. Sein Besen fällt zu Boden, es poltert einmal hölzern im Flur. Lowman hält ihn gepackt und hebt die rechte Hand hoch.
Es ist nicht allzu hell im Flur hinten, aber dennoch sieht der Junge den Revolver, der hochkommt und ihm in der nächsten Sekunde genau an der Stirn liegt.
Archie blickt stier und atemlos auf die Hand des Mannes, den Zeigefinger, den der Mann am Abzug des Revolvers hält, und schließt dann entsetzt die Augen.
»Keinen Laut!« zischt Lowman scharf. »Du hast eine Kugel im Kopf, wenn du schreist, Archie!«
Archie macht die Augen wieder auf. Er sieht nicht viel vom Gesicht des Mannes, nur zwei Augen zwischen Hutrand und Halstuch.
»Willst du schreien, na?«
Er versucht den Kopf zu schütteln. Seine Kehle ist ihm wie zugeschnürt, er bekommt keinen Ton heraus, kann nicht atmen, die Hand drückt ihm die Kehle zusammen.
Dann lockert sich der Griff, der Revolver geht von der Stirn fort und zeigt nun auf seinen Bauch.
Großer Gott, denkt Archie entsetzt, ein Überfall, ein Bandit!
Er hat die Kehle frei und holt Atem. Und da sagt Williams auch schon:
»Archie, hast du abgeschlossen?«
Seine Stimme kommt aus dem Glaskasten, die Stimme klingt dumpf.
»Antworte, sonst bringe ich dich um, antworte ihm, los!«
»Ja, Mr. Williams!«
Er bekommt es würgend heraus und schluckt schwer und mühsam. Verzweifelt stiert er den Mann an, sein Blick flackert, er denkt daran, daß nicht abgeschlossen ist. Der Mann muß durch die Tür hereingekommen sein.
»Dann geh nach oben, bring die Schlüssel vorher her, Archie!«
Der Mann stößt ihm den Revolver in den Bauch und drängt ihn auf die Tür zu.
»Zieh sie ab!« sagt er zischend. »Los, zieh die Schlüssel ab und klimpere mit ihnen, wenn du gehst. Klimpern, verstanden?«
Er kann nur nicken. Der Mann tritt hinter ihn und drückt ihm den Revolver nun in den Rücken. Archie geht auf die Tür zu und zieht das Schlüsselbund ab. Beinahe schließt er um, aber da wird der Druck stärker in seinem Rücken.
»Nicht zuschließen, Trottel! Umdrehen, gehen!«
Archie stirbt fast vor Angst und stolpert über den Besen. Die Schlüssel in seiner Hand klirren heftig, der Mann stößt ihn hart an, packt ihn mit der Linken am Kragen und schiebt ihn vor sich her.
Da ist die Tür von Williams Büro.
Die Schlüssel klimpern von allein. Er braucht nicht mal das Bund zu schütteln, seine Hand zittert so schön, daß alle Schlüssel aneinanderschlagen.
Im Büro sitzt Williams, schließt die Kasse zu, steckt den Schlüssel in die Westentasche und hört Archie kommen.
»So, Junge, dann…«
Und weiter sagt Williams nichts.
Er sieht den Jungen in der Tür auftauchen, aber hinter ihm einen Hut, die Augen eines Mannes, der ein Hals-tuch über die Nase gezogen hat.
Im gleichen Moment, als Williams den Mann auftauchen sieht und das kreidebleiche, vor Schreck und Furcht starre Gesicht des Jungen erkennt, dreht er sich auf seinem Drehstuhl nach links.
Williams hat die linke Schublade des Schreibtisches noch offen. In der Schublade liegt sein 32er Smith and Wesson.
Die Hand von Williams schnappt zu, die Schublade bekommt einen Stoß von seinem Arm.
Und der Junge einen von Lowman, daß er nach vorn schießt.
Lowman erkennt kaum, daß Williams in die Schublade greift, als er mit der Linken ausholt. Seine Hand trifft den Jungen mitten in den Rücken. Archie stößt einen schwachen, dumpfen Laut aus, dann fliegt er hinter Williams her bis an das Wandregal und landet bei den Ordnern und Heftern mit den Rechnungen und Bestellscheinen.
Durch die Tür aber kommt Lowman mit einem Tigersatz herein. Harry Lowman hält den Revolver in der rechten Hand. Er springt auf den Drehstuhl zu, sieht den Mann herumkommen und hebt die rechte Hand hoch.
Williams hat den Mann innerhalb von zwei Sekunden direkt neben sich. Er versucht, den Revolver zu heben. Er keucht, duckt sich, nimmt den Arm blitzschnell hoch, doch zu spät.
»Du verdammter Narr!« sagt Lowman scharf und fauchend.
»Wirst du wohl...«
In der nächsten Sekunde saust seine Hand nach unten. Williams’ linker Arm liegt noch auf dem Tisch. Er kommt jäh gegen den Kasten, schiebt den Kasten weg und über die Tischkante. Dann poltert es am Boden, der Kasten liegt unten. Der Drehstuhl aber kippt. Williams neigt sich, stürzt dem Kasten nach und bleibt dicht vor dem Stuhl, dessen Lehne sich einmal dreht, am Boden liegen. Über ihm steht mit kalten, glitzernden Augen Harry Lowman und weiß, daß er es hat!
Da liegt der Kasten. Dort liegt auch Williams. Und am Regal kauert der Junge, unfähig zu schreien oder eine Bewegung zu machen. Lowmans Revolver zeigt auf ihn. »Steh auf, Junge«, sagt der Bandit zischend. »Hoch mit dir, hoch! Stehst du wohl auf?«
Danach bückt er sich, packt Williams an der Jacke und zieht ihn hinter sich aus der Tür in den Gang zum Store. Der Junge zittert heftig, als er ihm folgt und Williams wieder zu Boden fallen sieht. Jetzt richtet sich der Blick der dunklen Augen auf ihn.
»Stricke, schnell!« Das ist alles, was Lowman sagt. Er steht vor dem Tresen, den Revolver in der Hand, sieht den Jungen zum Pfosten gehen, an dem die Stricke aufgerollt hängen. Als der Junge mit den Stricken bei ihm ist, stößt Lowman ihn an, dreht sich herum und reißt ihm die Hände auf den Rücken. »Einen Laut, dann bist du tot, Junge!« Er bindet ihm die Hände, zwingt ihn dann, sich zu setzen und fesselt ihm auch die Beine. Dann stopft er ihm ein Taschentuch als Knebel in den Mund. Er bindet ihm mit einem Handtuch die Augen zu, legt ihn neben den Tresen und beugt sich über Williams. Nach kaum drei Minuten liegen Williams und Archie gefesselt am Boden. Aus Williams’ Tasche fehlt der Schlüssel. Sehen können sie beide nichts. Williams beginnt zu murmeln, es klingt dumpf und brummend unter dem Knebel. Scheine rascheln, Geld klimpert. Lowman kichert einmal leise, als er Williams packt, ihn zur Stütze des Storedaches trägt und ihn dort anbindet. Das Gemurmel des Storebesitzers wird lauter, aber es kümmert Lowman wenig. Dann holt er den Jungen und bindet ihn hinten am Regal fest. Lowman steht still, sieht sich um, huscht zum Regal mit den Hüten. Dort nimmt er sich einen neuen Hut, packt drei, vier Hemden zusammen und greift nach den Tabakwaren.
Harry Lowman wendet sich danach ab. Er wirft keinen Blick mehr auf Williams oder auf den Jungen. Er hastet durch den Store, bläst die Lampe aus und schleicht sich aus der Hintertür. Die Schlüssel wirft er, nachdem er abgeschlossen hat, in den Hof. Aus dem Stall holt er zwei Pferde.
Und dann ist er fort.
Der Store liegt verlassen in der Dunkelheit.
Lowman grinst und sagt kichernd:
»Das wird Morgen, ehe sie die beiden finden!«
Vielleicht sollte ihm sein Instinkt etwas sagen, aber der Instinkt hat ihn schon einmal verlassen, als er Hipo Mortimer traf.
Williams wollte ein Spielchen machen, nur ein kleines wie jeden Montag. An diesem Abend kommt er nicht wie sonst.
Einer der Männer will nachsehen, warum Williams seiner Gewohnheit und dem Versprechen, das er am Nachmittag noch dem Bäcker gegeben hat, untreu wird.
Der Mann findet den Store verschlossen und dunkel. Er denkt, daß Williams zu Hause sein muß und ruft zu den Fenstern hoch. Als Williams nicht antwortet, ruft er nach dem Jungen, der ist sicherlich hier.
Es klopft, es dröhnt leise und dumpf.
Kurze Zeit später sind sie im Store und nehmen Williams den Knebel aus dem Mund. Er holt tief Luft und brüllt los, er sei beraubt worden. Er flucht böse und gibt dem Jungen die Schuld.
Sie laufen los und rennen zum Sheriff, aber der ist nicht da. Nur sein Deputy ist im Saloon bei Smith und trinkt sein Abendbier. Der Deputy heißt Sam Kellogg und nimmt zwei Laternen und ein Pferd mit. Dann reitet er los, nachdem er die Spuren gefunden hat.
Und er macht einen Fehler, er
reitet allein. Die anderen sehen kei-ne Chance, in der Nacht den
Mann noch zu finden. Er sieht die Chance. Er ist jung und verspricht sich etwas.
Sam Kellogg will den Burschen finden.
Und ins Jail bringen.
Er weiß nicht, daß er es mit Harry Lowman zu tun hat. Und daß Harry Lowman etwas besitzt, was sonst niemand hat:
Ein Leben zuviel!
*
Lowman rollt sich wie eine Katze zusammen. Dann legte er sich zurecht und schließt die Augen. In zwei Stunden wird es hell sein. Wenn man ihn sucht, dann nicht vor dem Morgen. Bis hierher werden sie ihm kaum folgen können. Lowman versteht es, seine Spuren zu löschen und zu verschwinden. Zuerst ein Stück im Sutton Creek geritten, dann gewartet, bis harter Felsboden kam. Aus dem Bach und nach Nordosten zum Powder River. Wieder drei Meilen im Wasser und dann scharf nach Westen gebogen.
Nun steckt Lowman hoch oben in einem Tal. Wenn er dreißig Yards geht, dann kann er in die anderen Täler blicken. Der richtige Platz für jemanden, der Verfolger zu erwarten hat. Er rechnet aber kaum damit, daß sie ihn finden. Vielleicht werden sie die Fährte von zwei Pferden ausmachen, aber folgen können werden sie der Fährte kaum.
Er schläft ein, grinst im Schlaf und träumt von Hipo Mortimer. Hipo grinst ihn an. Dann nimmt Hipo den Revolver. Er sieht Mortimers rundes, fleischiges Gesicht über sich, den Revolver – und stöhnt einmal.
Und dann wacht Harry Lowman auf.
Der Traum ist vorbei.
Der Tag ist da, die Sonne scheint.
»Zum Teufel!« sagt Lowman heiser und fährt sich über die Augen. »Der Kerl wird mich noch hundertmal erschrecken. Ich träume jede Nacht von ihm. Donner, schon so spät?«
Es ist neun Uhr, er hat länger geschlafen, als er es wollte. Er gähnt einmal, dann macht er sich über den Packen her, frühstückt und erinnert sich an den Store. Sie werden schon suchen.
Lowman steht auf, geht langsam zum Hang, hält dort an und nimmt eine Zigarette. Als sie brennt, geht er weiter. Er taucht oben am Hang auf, blickt nach Westen.
Im gleichen Augenblick wirft er sich auch schon zu Boden. Er fliegt förmlich hinter den nächsten Busch zurück, ist ein Stück zu tief gekommen und kriecht dann blitzschnell höher. Gleich darauf liegt er lang hinter dem Busch. Er biegt die Zweige etwas auseinander, starrt auf den Hügel da drüben und sieht den Mann kommen.
Der Mann reitet schnell, prescht den Hang herab und genau neben jener Spur her, die Lowman in der Nacht hinterlassen hat. Einen Moment beißt Lowman sich erschrocken auf die Lippen. Seine erste Reaktion ist der Gedanke, die Pferde zu nehmen und davonzujagen. Ehe der Bursche dort herankommen kann, wird Lowman längst im langen Tal sein und einen Vorsprung herausholen können.
Dann jedoch sagt sich Lowman, daß er den Mann unmöglich abschütteln kann. Wenn er auch zwei Pferde hat, der Bursche dort wird seine Spur ausmachen.
»Alle Teufel!« knirscht der Bandit erschrocken. »Der hat einen Orden und zwei Laternen am Sattel hängen. Daher also, etwas ist schiefgegangen, er muß in der Nacht schon aufgebrochen sein. Der kommt seit Stunden hinter mir her. Hölle und Pestilenz, hat man Williams zu früh gefunden? Was nun?«
Er denkt einen Moment nach, rutscht dann zurück und weiß, daß er keine zwei Minuten Zeit hat. In wilden Sätzen fliegt er zu seinen Pferden, reißt sein Gewehr aus dem Scabbard und sieht sich um.
Der Mann wird auf der Spur über den Hügel kommen und die Pferde sehen. Und dann wird er sein Tier zurückreißen.
Lowman handelt blitzschnell, reißt einen Busch aus, wirft ihn unter die noch am Boden liegende Decke und legt seinen Gurt auf den Sattel. Mit einigen Griffen zieht er hastig die Decke zurecht, beult sie aus und nickt zufrieden. Dann rennt der untersetzte Mann, der ein Leben zuviel besitzt, in langen raumgreifenden Sprüngen nach links.
Die Sonne ist nun vor ihm, er läuft nach Südosten. Seine Lungen schmerzen, so schnell versucht Lowman die Büsche links am Hang zu erreichen. Sein Verfolger – Lowman ist sicher, daß er sich nicht irrt – wird niemals annehmen, daß Lowman hier gerastet hat, ehe er nicht die Pferde zu sehen bekommt. Kaum erreicht Lowman die Büsche, als er sich hinwirft.
Er ist jetzt kurz unterhalb der Hangkrone und kriecht so schnell er kann in der Deckung der Büsche auf die Höhe. Im Augenblick, als er die Höhe erreicht, zuckt sein Blick nach rechts. Er wagt sich nicht vorzustellen, was geschehen sein würde, hätte ihn der Verfolger noch schlafend gefunden. Nun sieht er, verdeckt durch die Zweige, seinen Mann kommen. Der Reiter treibt sein Pferd den Hang hoch. Er hat nicht einmal das Gewehr in der Hand und rechnet nicht damit, schon auf Lowman zu stoßen. Es ist sein Fehler. Lowman rechnet damit und kriecht hastig auf den nächsten Busch zu.
Jeden Moment muß der Mann hoch genug sein, um in das Tal blicken zu können. Sein Pferd kommt die letzten Schritte, es muß gleich auf dem Hang sein.
In diesem Augenblick sieht Sam Kellogg das Camp unter sich. Kellogg, der den Wind gegen sich hat, zuckt heftig zusammen. So jung Kellogg auch ist, in diesem Moment handelt er blitzschnell. Der Mann unter ihm müßte ihn hören, er müßte ihn längst gehört haben, auch wenn der Wind gegen ihn steht.
Der Gedanke ist es, der Kellogg jäh die Warnung signalisiert.
Und nur dieser Gedanke bewahrt Kellogg vor der Kugel.
Harry Lowman handelt kaltblütig und ohne abzuwarten. Er zielt, sieht den Mann im Sattel zucken, seine hastige Bewegung, die die Zügel anreißt und das Pferd zum Stehen bringt.
Und genau darauf hat Lowman gewartet.
In diesem Moment ist Lowman nichts als der um sein Leben kämpfende Bandit, der er immer gewesen ist und bleiben wird. Er visiert, er paßt den Augenblick ab und drückt dann ab.
*
Genau zur gleichen Sekunde aber kommt Kellogg der Gedanke. Kellogg wittert jäh die Falle und wirft sich blitzschnell links vom Pferd. Mitten in seinen Abstoß hinein hört er den brüllenden, scharfen Krach des Gewehres. Der Knall kommt, die Kugel zischt um Haaresbreite über ihn hinweg. Er vermeint noch den Luftzug zu spüren. Kellogg kann noch im Sturz sein Gewehr mitnehmen. Er landet an einem Busch zwischen dem harten Kiesgeröll auf dem Hang und rollt sich sofort nach rechts fort. Vor ihm springt sein Pferd zur Seite. Kellogg sieht noch im Rollen die träge, langsam zerflatternde Wolke des Pulvers links über dem Hang. Er weiß nun, wo sein Mann liegt.
Dann ist das Pferd fort.
Und der Mann schießt nicht mehr.
Kellogg rollt, kommt hinter den Busch und reißt sein Gewehr herum. Er liegt nun einige Schritte unterhalb des Hanges. Als er das Camp vor Augen hatte, sah er es aus dem Sattelsitz. Sein Pferd war noch nicht ganz auf der Höhe. Nun liegt er unterhalb des Hanges und weiß eins nicht: Lowman ist schon nicht mehr da.
Es ist Lowmans teuflischer Instinkt, der ihn den fehlgehenden Schuß geradezu riechen läßt. Vielleicht würde ein anderer Mann noch einmal feuern, vielleicht würde er auf das Pferd schießen, aber Lowman ist kein Narr. Ein Pferd, das am Boden liegt, gibt jedem Mann Deckung. Und nichts kann Lowman weniger recht sein als eine Deckung für den Burschen, der ihm gefolgt ist.
»Verdammte Sache!« zischt Harry Lowman, als er sieht, daß sein Schuß nicht getroffen hat. »Warte, Bursche, dich erwische ich doch noch!«
Einen Moment packt ihn die Furcht, denn der Mann ist zu schnell gewesen. Aber der Moment ist zu kurz, um Lowman zu lähmen. Blitzschnell rollt er sich unter der verräterischen Pulverwolke weg. Er rollt nach rechts und genau über den Hang. Für zwei, drei Sekunden ist
Lowman nicht sicher, ob ihn sein Verfolger beim Wegrollen entdeckt. Hinter dem Hang liegt er still, eilt nach oben und denkt dann:
Er war noch nicht über den Kamm hinweg, also liegt er nun an der anderen Seite. Warte, Bursche, ich erwische dich.
Er springt hoch und rennt los. Vor ihm sind einige Steine, ein Felsblock und ein paar Büsche. Lowman fliegt auf den Felsblock zu, duckt sich dann und kauert hinter ihm. Er keucht, blinzelt rechts am Felsen vorbei und nimmt sein Gewehr hoch. Wenn sich der Bursche zeigt, drückt er ab.
Er zeigt sich nicht, alles bleibt still. Behutsam rutscht Lowman ein Stück tiefer. Er gleitet wie eine Schlange auf den Busch zu, der vielleicht zehn Schritte vor dem Felsblock steht. Als er ihn erreicht, wendet Lowman vorsichtig den Kopf nach hinten.
Von hier aus kann Lowman gerade noch die Spitzen jener Büsche sehen, hinter denen er beim ersten Schuß gelegen hat. Das wilde Lächeln, das um Lowmans Lippen spielt, könnte auch das hämische Grinsen eines Teufels sein. Lowman nimmt einen Stein hoch, holt aus und schleudert ihn haargenau in die Büsche hinein.
Kaum hat er geworfen, als er den Krach hört.
Der Narr, denkt Lowman, der dumme Kerl. Er schießt auf jede Bewegung. Nun, warte, du denkst, ich bin noch oben, was? Das wird beinahe das letzte sein, was du jemals denkst!
Er schiebt sich weiter, er kriecht und sieht den Kamm vor sich. Dieser Kamm ist steil. Lowman blickt nur nach oben, denn nur daher kann sein Mann auftauchen. Dabei aber schiebt sich Lowman immer weiter. Da ist seine alte Fährte, dort oben steht etwas links das Pferd. Er kann gerade noch den Kopf des Pferdes ausmachen, ist nun auf dessen Höhe.
Im nächsten Moment hört Lowman das leise Klicken über sich. Er erstarrt, sein Gewehr kommt langsam hoch. Das Klickern hält an, es ertönt nun bereits etwas links vor Lowman.
Die Büsche, denkt Lowman. Er kriecht, er will auf mich zu und hier herüber. Freundchen, närrischer kannst du es nicht machen!
Sofort gleitet Lowman auf dieser Seite des Hanges weiter. Er hütet sich, ein Geräusch zu machen, preßt sich hinter einen Busch und wartet.
Drüben klickert es leise, es zieht sich nach links.
Der Mann kommt.
Sam Kellogg kriecht. Er hat Deckung, aber kurz vor dem Hang wird es aus sein.
Dort, denkt Kellogg und starrt auf die Büsche, zwischen denen es sich gerade noch bewegt hat, wenn es auch nach seinem Schuß ganz ruhig geworden ist, da liegt der Halunke. Ich möchte wissen, ob er mich sieht. Wenn nicht, dann kann ich über den Hang springen, ich muß ihn aus seiner Deckung treiben. Kommt er, dann erwische ich ihn.
Kurz vor ihm steht der letzte Busch.
Kellogg erreicht ihn nun, er preßt sich in die Deckung und zieht langsam sein rechtes Bein an. Dann stemmt er die Stiefelspitze gegen den Boden, setzt die linke Hand ein und ist bereit aufzuspringen und über den Kamm zu hetzen.
Sieht ihn der Mann, dann wird er schießen. Laufen, denkt Sam Kellogg und der Schweiß bricht ihm aus, als er an das Stück von sieben, acht Schritten freier Fläche denkt, über die er rennen muß. Laufen!
Er zaudert, er ist noch nicht ganz ruhig und holt tief Atem. Dann spannt er sich und stößt sich jäh ab.
Sam Kellogg kommt blitzschnell hoch, rennt los, reißt im Laufen sein Gewehr herum und feuert von der Hüfte aus. Zweimal, dreimal brüllt sein Gewehr los. Die Kugeln schlagen in den Busch ein, der sich vorhin bewegt hat. Er sieht deutlich aufsteigende Staubwolken an den Einschlagstellen der Kugeln.
Der Bursche, denkt Kellogg, er schießt nicht. Sollte ich ihn getroffen haben? Warum schießt er nicht?
Er hat den Hangkamm erreicht, macht einen letzten, wilden Sprung und krümmt sich zusammen.
Und dann sieht er seinen Mann!
*
Es ist Kellogg, als wenn ihm eine Faust in den Magen fährt. Aus den Augenwinkeln erkennt er den Mann, der keine fünfundzwanzig Schritte links von ihm hinter dem Busch kniet und sein Gewehr an der Hüfte hält.
Einen Moment blickt Kellogg mitten in das Gesicht Lowmans. Er weiß, daß er verloren ist, daß dieser Mann ihn ausgetrickst hat.
Das Gewehr zeigt auf ihn, er kann nicht mehr schießen, er schafft es nicht, aber er kann sich noch seitlich drehen.
Verzweifelt stößt sich Kellogg ab. Er kommt herum, hat den Mann vor sich, sieht die Feuerwolke aus dem Gewehr schlagen und stößt einen heiseren Schrei aus.
Dann surrt die Kugel. Sie trifft, sie dreht ihn weiter. Er stürzt auf die Steine, sieht vor sich einen Felsblock und denkt nur noch, während ihn der Schmerz zu lähmen droht, daß er rollen muß.
Sam Kellogg, Deputy des Sheriffs in Baker City, prallt auf und wälzt sich herum. Der Hang ist steil, und der Rest seines Verstandes sagt Kellogg, daß seine einzige Chance dieser steil abfallende Hang sein kann. Er rollt weiter, er stößt sich ab, verliert sein Gewehr und kommt tiefer.
Harry Lowman aber steht nun breitbeinig und mit eiskalten Blicken den Mann beobachtend, hinter dem Busch. Lowman dreht sich mit, das Gewehr an der Hüfte wandert weiter. In dieser Minute ist ihm zumute, als wenn es nicht zu ändern sein wird. Treibt man Lowman in die Enge oder kommt man ihm nach, dann beißt der Mann, der ein Leben zuviel besitzt, wie ein wildes Raubtier um sich. Er ist jetzt genau das – ein gefährliches, seine Chance bis zur letzten Konsequenz nutzendes Raubtier.
Vor ihm rollt der Mann tiefer. Er kommt am Felsblock vorbei. Was immer er dabei denkt, eins ist sicher: Er will hinter einen Busch, um Deckung zu haben. Aber er besitzt sein Gewehr nicht mehr.
Dort stehen Büsche. Kellogg sieht sie und weiß es: Nur hinter ihnen hat er noch eine Chance. Dann gibt es keine mehr – nicht eine.
Sam Kellogg erreicht die Büsche, Zweige brechen peitschend über sein Gesicht und Hände hinweg. Er ist durch, stemmt sich ein, reißt den Revolver heraus und hat ein taubes, lahmes Gefühl in der rechten Seite sitzen. Und dann schnellt er verzweifelt hoch.
Der Mann steht, sein Halstuch ist herabgerutscht, sein Gesicht wird von der Sonne getroffen.
Kellogg reißt den Arm hoch.
Er sieht weit hinter dem Mann die kleinen weißgrauen Wolken am Himmel. Er ist auf der Hälfte des Hanges, er blickt hoch zum Himmel.
Und dann hört er den Knall.
Die Wolken, denkt Samuel Kellogg, die Wolken.
Harry Lowman aber blickt über sein Gewehr hinweg in das Tal.
Die Sonne scheint, die Büsche werfen Schatten. Und Lowmans Schatten ist schrecklich lang, als er langsam über das Geröll den Hang hinabgeht. Steine klickern unter seinen Tritten. Er bleibt an den Büschen stehen, betrachtet die gebrochenen Zweige und bückt sich dann langsam.
»Komm mir nicht nach!« sagt er dann in jäh ausbrechender Wut und stampft heftig mit dem Fuß auf. »Was kommst du mir denn nach, du Narr, was? Wer hat dich eingeladen, mich zu verfolgen? Ich sage dir, ich muß schießen, ich sage dir, ich gehe nie wieder ins Jail, nie wieder, hörst du?«
Der Mann antwortete nicht.
Der Wind trägt Lowmans wildes Reden fort.
Er muß weg, er weiß es. Andere können kommen, andere werden ihn suchen, diesen Deputy.
Drei Pferde, denkt Lowman, und seine Wut ist vorbei wie ein Windhauch, der ihn einmal gestreift hat, nun habe ich drei Pferde. Nach Süden, erst nach Süden, bis in die Nacht reiten. Und dann verschwinden, das Deputypferd müde rennen lassen. Fort, nichts als fort!
Keine fünf Minuten später sitzt er im Sattel und reitet auf seine Pferde zu.
Gesehen hat nur einer sein Gesicht, die anderen nicht.
»Warum kommt ihr mir nach?« fragt er störrisch und düster, als er mit den drei Pferden das Tal verläßt. »Ihr bekommt mich nie mehr, hört ihr?«
Es ist keiner da, der ihm Antwort gibt.
Nur die Hufe trommeln.
Lowman ist auf der Flucht.
Eines Tages wird Lowman nicht mehr zu flüchten brauchen und sich zwischen anderen Leuten wie einer unter vielen bewegen. Er wird kaum auffallen.
Und doch, eines Tages kommt jemand.
Bis dahin ist Harry Lowman sicher, daß niemand ihn erkannt hat und keiner ihn finden wird.
Bis dahin besitzt er es:
Ein Leben zuviel.
*
Es geschieht so viel in diesem Land. Jeden Tag hört man von Männern, die irgendwo umgekommen sind, jeden Tag von Überfällen, von Prügeleien und Messerhelden. Der Mann, der diese Dinge in der Zeitung liest, lächelt nur geringschätzig. Er erinnert sich, daß er einmal durch die Berge ritt und jemanden traf, an dessen Feuer er kam. Sie spielten mit Würfeln. Und als er merkte, daß der Bursche, dem er am Feuer begegnet war, den Teufel in den Adern haben könnte, fürchtete er plötzlich um sein Geld, das er in den Taschen hatte.
Wenn sich Towers an jene Nach erinnert, dann beschleicht ihn ein Kältegefühl. Und wenn er an den Mann denkt, dann denkt er nur an dessen Augen. Seit Tagen versucht Towers sich einzureden, daß der Bursche ihn niemals finden wird. Der Bursche sucht einen gewissen Amandeus Hipokrates Mortimer, aber keinen Slade Towers.
Es ist schon immer Towers Art gewesen, sich abgerissen zu kleiden, sobald er geschäftlich unterwegs sein mußte. Niemand, der Towers auf seinen Geschäftsreisen begegnete, konnte ahnen, daß Towers eine Menge Geld bei sich trug. Abgerissen aussehen, kein zu gutes Pferd reiten und die Leute bluffen.
Den Mann, den er am Feuer traf, hat er auch geblufft.
Zu gut, denkt Slade Towers und stiert auf die Zeitung. Du großer Geist, das ist er, das ist Lowman, niemand sonst. Da steht es schwarz auf weiß: Pferde gestohlen, einen Store ausgeraubt. Zum Teufel, das ist Harry Lowman. Und wo steckt er nun?
Towers steht auf, wischt sich über das feiste Gesicht und geht zu seinem Schrank. Dort nimmt er eine Flasche heraus, gießt sich ein Glas randvoll und trinkt es hastig leer. Doch auch danach wird ihm nicht besser. Gewiß, weder das Pferd noch das Maultier stehen in seinem Stall. Beide Tiere sind längst verkauft.
»Verdammt, verdammt!« sagt Towers stockheiser. »Ich habe ihn nur bluffen wollen. Er sollte glauben, ich sei ein armer Kerl, der Geld brauchte. Ich dachte – nimm ihm seine siebenhundert Dollar ab, laß ihn zurück, der Bursche ist dir unheimlich. Wie er dich angesehen hat, Slade, was? Als wenn er genau wußte, daß ich mich verstellte und mehr Geld in der Tasche hatte als er. Da befiel mich ganz einfach Angst, daß er mich umbringen würde. Ich hielt ihn für einen kleinen, billigen Halunken, der einen für zehn Dollar totschlagen würde. Du großer Geist, wenn der mich sucht?«
Der Gedanke läßt ihn noch einmal zur Flasche greifen. Er trinkt hastig, kaut den Whisky buchstäblich, dann denkt er an seine Gerissenheit, die ihn immer und überall durchgebracht hat. Diesmal, das fürchtet er, kann sie ihm nicht helfen. Er greift wieder zur Zeitung und liest die Sache über
Lowman noch einmal. Sie wissen also nicht, wie Lowman aussieht, sie kennen seinen Namen nicht?
»Das ist es«, murmelt Towers heiser. »Den Namen, keine genaue Beschreibung. Der Kerl wechselt einfach seine Kleidung, und schon erkennt ihn keiner mehr. Wenn ich ihnen seine Beschreibung gebe, he?«
Er spielt einen Moment mit dem Gedanken, dann verwirft er ihn wieder. Wenn er das macht, dann wird Lowman reden. Der Kerl wird alles abstreiten. Und beweisen wird man ihm kaum etwas können. Kommt er aber danach heraus, dann wird es gefährlich.
»Dann bin ich so gut wie sicher tot!« stellt Towers ächzend fest. »Ich muß mir etwas einfallen lassen. Verdammte Geschichte, wenn er hier auftaucht und findet mich?«
Er lauscht, Schritte auf der Treppe, jemand kommt leise hoch. Plötzlich beginnt Towers zu frieren. Wenn es Lowman ist, wenn der Bursche schon in der Stadt ist?
Towers greift unter den Rock. Die Schritte sind verstummt, alles ist still im Flur. Nur von unten her dringt Gelächter herauf. In der Hand von Towers liegt der Revolver. Er spannt den Hammer, richtet den Lauf auf die Tür und hält den Atem an.
Unten in seinem Saloon lachen sie. Sie lachen. Und er hat eine greuliche Angst.
Da sind die Schritte wieder, sie nähern sich langsam und leise der Tür.
Harry Lowman kommt. Lowman vergißt sicher nicht, daß er am Feuer niedergeschlagen und ausgeraubt worden ist. Die Schritte halten vor der Tür an. Towers bricht der kalte Angstschweiß aus. Es klopft an der Tür.
Und dann sagt der Mann draußen heiser:
»Boß, bist du da?«
Towers atmet aus. Er kann erst nach einigen Sekunden sprechen und holt tief Luft.
»Ja, Cliff, was ist?«
»Boß, unten im Saloon ist jemand, der spielt hoch und gewinnt dauernd.«
»Warte!«
Er läßt hastig den Hammer des Revolvers zurückgleiten und steckt die Waffe ein. Dann öffnet er und sieht Cliff, seinen Keeper, durchbohrend an.
»Was schleichst du herum wie eine Nachteule?« fragt er grimmig. »Mußt du immer so schleichen, Mensch? Komm schon herein. Also, was ist unten los?«
»Der Spieler sitzt seit einer Stunde am Spieltisch und gewinnt laufend, nachdem er zuerst verloren hat. Hohes Spiel, Boß. Soll ich was tun?«
»Spielt er falsch?«
»Er sieht nicht aus, als wenn man ihn das fragen kann, Boß! Ich glaube, der Bursche ist schnell mit dem Revolver!«
»Aha. Na gut, laß ihn spielen.«
»Aber er stört unseren Spieler.«
»Zum Teufel, das ist jetzt gleichgültig! Cliff, hast du Sweney und Randolph gesehen?«
»Nein, Boß, aber vorhin gingen sie zu Fletchers Inn.«
»Dann hast du sie also doch gesehen, Mensch. Schick Steve los, er soll sie suchen und ihnen sagen, daß ich sie sprechen will.«
»Boß, die beiden rauhen Burschen? Die bringen dich in Verruf, sie suchen überall Streit. Du weißt doch, wie sie sind. Was willst du von ihnen?«
»Mensch«, erwidert Towers zischend, und seine blaßblauen Augen sehen Cliff starr und grimmig an. »Ich habe dir gesagt, daß du Steve schicken sollst. Alles andere geht dich nichts an. Sie sollen herkommen – sofort, verstanden?«
Die beiden schlimmsten Kerle, denkt Cliff verwirrt, mit denen er sonst nichts zu tun haben wollte. Was hat das zu bedeuten? Denen zahlt man fünfzig Dollar, wenn sie jemanden umbringen sollen, und die will er sprechen?
»Ist gut, Boß. Und der Spieler?«
»Laß ihn spielen, aber keine Unterstützung, wenn er falsch spielt und dabei auffällt, verstanden?«
»Ja, Boß.«
Er geht hinaus. Towers schließt die Tür zu und wartet. Sweney, denkt der Salooner und zieht leicht fröstelnd die Schultern zusammen, der ist so rauh, daß man sich die Haut aufreißt, wenn man nur in seine Nähe kommt. Und Randolph soll draußen zwei Digger überfallen haben, die Silbererz bei sich hatten. Teufel, ich habe keine andere Wahl! Wenn Lowman hier auftaucht und mich sieht, dann kann ich mein Testament machen. Und ehe ich das mache, eher wird Lowman auf irgendeine Art verschwinden.
Er geht ruhelos im Zimmer hin und her, hört nach einiger Zeit die Tür unten klappen und schwere Schritte auf der Treppe. Die Schritte nähern sich der Tür und Steve, sein Stallhelp, sagt heiser:
»Boß, Sweney und Randolph!«
Towers öffnet, läßt die beiden Männer ein und betrachtet sie einige Sekunden. Zwei breitschultrige Männer, Randolph etwas größer als Sweney, aber genauso verschlagen und rauh wirkend. Während Sweney den Hut nicht von seinen roten Haaren nimmt und sich an die Wand lehnt, zieht Randolph kurz seinen schäbigen Stetson und bleckt die gelblichen Pferdezähne. Er hat krauses braunes Haar. Eine schiefstehende Nase ist ihm als Andenken an irgendeine Prügelei geblieben.
»Da sind wir, Towers«, sagt Randolph mürrisch. »Was ist los, gibt’s was?«
»Setzt euch hin, ich habe mit euch zu reden.«
Sweney schießt Randolph einen kurzen, stechenden Blick zu und verzieht das Gesicht, als wenn er sagen will: Sieh mal einer an. Der gute Towers, der sonst nicht viel mit uns im Sinn hat – auf einmal kommt er und will was von uns. Sei vorsichtig, Randolph, erst warten, was er will.
Sie gehen zum Tisch, setzen sich umständlich und warten auf Towers. Der bringt drei Gläser zum Tisch, gießt sie voll und blickt die beiden rauhen Burschen seltsam an.
»Zuerst«, sagt er dann grinsend und wohlwollend, »laßt uns einen trinken, Freunde. Und dann wollen wir uns über die Geschäfte unterhalten. Also, auf euer Wohl!«
»Auf deins«, sagt Sweney doppelsinnig. »Uns geht es ganz gut, Towers!«
Sie trinken, blicken den Salooner dann lauernd an und warten.
»Was haltet ihr von fünfhundert Dollar?«
Sweney, der geldgierigere von beiden, verschluckt sich und erhebt sich halb.
»Ich sagte fünfhundert«, murmelt Towers kühl. »Sweney, ich will nicht wissen, was ihr sonst so macht, mich geht das nichts an. Ich zahle dem von euch fünfhundert Dollar, der mir einen ziemlich großen Gefallen erweist.«
»Für fünfhundert«, antwortet Sweney, ohne sich zu besinnen oder sich noch vorzusehen, »tue ich dir jeden Gefallen. Wer soll dran glauben, Towers?«
Der Salooner zuckt leicht zusammen und sieht Sweney einen Augenblick verwirrt an.
Randolph aber kratzt sich am Kinn. Dann sagt er kanpp:
»Dasselbe gilt für mich!«
»Oder für euch beide«, antwortet Towers träge. »Wenn ihr die Arbeit zusammen besser schaffen könnt, dann gebe ich euch achthundert – für jeden vierhundert. Das Risiko ist nicht so groß wie für einen einzelnen, wie?«
»Ja«, sagt Sweney. »Was für ein Risiko, Towers? Ist es ein Mann?«
Towers gießt noch einmal die Gläser voll und grinst dabei verstohlen.
Es ist also wahr, was man über die beiden Burschen sagt. Für fünfhundert Dollar ziehen sie den Teufel an den Haaren aus der Hölle!
»Ja, es ist ein Mann!«
Die beiden smarten Burschen sehen sich an. Dann sagt Sweney:
»Der ist schon tot.«
Und Randolph brummt:
»Er lebt schon zu lange. He, ist der Kerl gefährlich?«
»Würde ich euch sonst fünfhundert Dollar zahlen wollen?«
Sie wechseln den nächsten Blick und Sweney sagt, vorsichtiger geworden:
»Wie gefährlich ist er?«
»Für euch nicht, da er euch nicht kennt und euch nicht für eine Gefahr halten kann, Freunde. Er ist schnell, nun gut, aber niemand verlangt, daß ihr ihn von vorn erwischt.«
»Aha!« sagt Randolph tief brummend. »Kennen wir ihn denn?«
»So wenig wie er euch kennt. Es kann sein, daß er gar nicht auftaucht, es kann aber auch sein, daß er schon bald kommt.«
»Will er was von dir?«
»Wahrscheinlich bekomme ich eine Menge Ärger«, murmelt Towers. »Wir kennen uns von früher her – ich habe ihn einmal hereingelegt, aber das ist für euch nicht wichtig. Von heute an paßt ihr auf. Ich zahle euch allein für das Aufpassen jeden Tag zwanzig Dollar, jedem von euch, ist das klar? Seht ihr ihn, und es ist gleich, wer von euch ihn zuerst sieht, sorgt dafür, daß er mich niemals mehr besuchen kann.«
»Der Donner«, erwidert Randolph. »Du läßt es dich eine Stange Geld kosten. So spendabel war nicht mal Mansfield!«
»Halte doch den Mund, Randolph!« fährt ihn Sweney grob an. »Was interessiert das schon Towers, he? Also, wie sieht er aus, To-
wers?«
Der Salooner lehnt sich zurück, schließt einen Moment die Augen und denkt an Mansfield. Der hat den größten Saloon in der Stadt. Bei ihm trinken sich die beiden Burschen hier regelmäßig voll und brauchen nichts zu bezahlen, das ist ihm immer schon merkwürdig vorgekommen. Noch merkwürdiger aber ist es gewesen, daß der erste Inhaber des Saloons eines Tages blau und grün geschlagen aufgefunden wurde und danach den Saloon an Mansfield verkaufte.
Sieh mal einer an, denkt Towers, die beiden Burschen haben das also besorgt, wie? Nun gut, das ist auch ein Rezept, wie man zu einem Saloon kommen kann, was?
»Der Mann, den ich nicht sehen will«, sagt er dann langsam, »heißt Harry Lowman. Ich denke, das ist sein richtiger Name, er wird wohl noch einige andere haben, aber als wir uns kennenlernten, hatte er keinen Grund, einen falschen Namen anzugeben. Er ist so groß wie Randolph, schwarzhaarig und trägt seinen Revolver verdammt tief…«
Und dann gibt er ihnen eine so genau Beschreibung von Lowman, daß sie ihn erkennen müssen.
»Seine Augen«, sagt er fortfahrend, »sind stechend scharf und schwarz wie die Nacht. Er kann harmlos blicken, aber das täuscht. Würdet ihr ihn erkennen?«
»Sicher«, sagt Sweney kurz. »Weißt du, was er für ein Pferd reiten wird, oder kommt er mit der Stagecoach?«
»Er wird sicher zu Pferd kommen, aber was für einen Gaul er reitet, das weiß ich nicht. In jedem Fall aber wird er vorsichtig sein, wenn er herkommt. Vielleicht erkennt ihr ihn schon daran. Er wird sich so benehmen, als wenn ihm jeden Moment etwas in den Weg kommen kann.«
Die beiden Burschen nicken, dann schenkt Towers ihnen noch ein Glas ein und murmelt warnend:
»Ihr bekommt jeden Tag zwanzig Dollar, hier sind die ersten für euch beide. Aber betrinkt euch nicht wieder bei Mansfield, sondern paßt auf, Ihr könnt es so einrichten, daß einer immer aufpaßt und der andere schläft. Wie ihr das macht, ist eure Sache, aber entwischt er euch und kommt her, dann erbt ihr keinen Cent mehr, verstanden?«
»Für fünfhundert Dollar vergeß ich zu schlafen«, sagt Randolph grinsend. »Verlaß dich nur auf uns, uns ist noch keiner, der es nicht sollte, durch die Lappen gegangen. Komm, Sweney, fangen wir beide an, was?«
»Du nimmst das Ende von hier bis zum Nordausgang der Stadt, ich das bis zum Süden hin, was?«
»In Ordnung, Sweney«, erwidert Randolph. »Ist noch was, Towers?«
»Ja, vergeßt, daß ich mit euch gesprochen habe. Redet ihr, dann ist es aus!«
»Wir bringen uns doch nicht selber um unser Geld«, murmelt Sweney beleidigt. »Du siehst den Kerl nie, das verspreche ich dir!«
»Ich besorge ihm was, daß ihm die Lust vergeht dich zu besuchen!« verspricht Randolph und geht grinsend zur Tür. »Keine Sorge, der Kerl wird dich nie belästigen, Towers.«
Damit gehen sie hinaus.
Towers sieht ihnen nach und reibt sich die Hände, als er die Tür fest verschlossen hat.
*
Es ist Zufall, daß sich Sweney und Randolph auf der Höhe des Saloons treffen, aber der Zufall bringt einige Dinge an den Tag.
»Na?« fragt Randolph grinsend. »Hast du ihn gesehen, Sweney?«
»Du vielleicht?« erkundigt sich Sweney bissig. »Warum laufen wir eigentlich beide herum und halten unsere Augen auf? Einer könnte schlafen!«
»Ja«, sagt Randolph spottend, der Sweneys Geldgier nur zu gut kennt. »Du würdest auch sicher schlafen können, während ich meine Runde machte, wie? Ich wette, du würdest unausgesetzt davon träumen, daß ich den Kerl allein erwischen könnte und du leer ausgingst. Stimmt’s?«
»Sollte dir so passen, ihn allein zu erwischen. Ich kenne dich!« antwortet Sweney bissig. »Immer hinter dem Geld her, was? Vielleicht kommt er gar nicht?«
»Der wird schon kommen. Und wenn nicht – wer weiß, wie lange wir aufpassen sollen. Ist auch nicht schlecht – in drei Tagen sechzig Dollar verdient und nur ein wenig Schuhsohlen abgerannt. Wenn ich den Kerl sehe, bekommt er drei Zoll!«
Sweney geht los.
Randolph gähnt einmal. Es ist bereits Mitternacht. Die Miner sind da, es ist Wochenende, und in der Stadt herrscht der übliche Lärm und Betrieb.
Randolph sieht alles und jeden. Er steckt sich im Windschatten hinter dem Store eine Zigarre an, raucht und lehnt sich an die Wand.
Hier ist er mehr als hundert Yards von Towers Saloon entfernt und blickt hin. Von Sweney ist nichts zu sehen.
Der geldgierige Schurke, denkt Randolph, ehe ich dem das Geld gönne, lege ich mich krumm. Einmal muß er seine Lehre beziehen!
In diesem Augenblick wendet er den Kopf und blickt die Straße hoch.
Und dann entdeckt er den Reiter.
Randolph, der besonders auf die Reiter achtet, fixiert den Mann auf hundet Schritt, als er unter der Laterne vor der Bäckerei herreitet. Der Mann reitet scharf rechts am Gehsteig drüben, er kommt nur langsam voran, hat die linke Hand an den Zügeln und die rechte anscheinend in der Nähe des Revolvers. Viele reiten so, viele hat Randolph in den vergangenen Tagen schon so reiten sehen. Jedesmal ist es nicht der Mann gewesen.
Obwohl die immerwährenden Enttäuschungen Randolph zugesetzt haben, denkt er nicht daran, aufzustecken und einem Fremden weniger Beachtung zu schenken.
Randolph geht um die Ecke in die Gasse neben dem Store und behält den Reiter im Auge. Der Mann kommt drüben am Buchladen vorbei, dann jedoch schwenkt er, reitet genau auf Randolph zu und wechselt die Straßenseite. Es kommt Randolph vor, als wenn der Mann etwas sucht, denn er blickt sich öfter um. In der dunklen Ecke kann Randolph nicht gesehen werden. Er drückt sich eng an die Wand und starrt dem Mann entgegen.
Gleich darauf nähert sich das Pferd dem Storebalken. Es wird angehalten. Und wieder blickt der Mann sich um. Allerdings fällt auch jetzt noch kein Licht auf sein Gesicht. Er hat den Hut in die Stirn gezogen, die Lampe bescheint nur seine Beine. Als Randolph die Beine sieht, furcht er die Brauen und will aufgeben. Der Mann trägt einen prächtigen Anzug, Halbstiefel unter der Hose und keine Sporen. Er wird hier in der Nähe zu Hause sein. Der Reiter steigt nun ab, bindet sein Pferd an, aber noch immer kann
Randolph nicht in sein Gesicht blicken. Dann geht der Mann in den Store.
Clay Randolph betritt den Gehsteig, schiebt sich bis nahe an das Fenster und blickt nun in den Store.
Der Fremde steht vor dem Tresen, man kann seine Stimme hören, er deutet auf das Regal und sagt:
»Ah, mein Freund, ich sehe, hier raucht man diese prächtigen Zigarren wie bei mir zu Hause. Ich sage es doch immer, einen guten Storehalter erkennt man an seinem Zigarrensortiment. Prächtige Marke aus Wheeling. Ein Dutzend, mein Freund, wenn es recht ist.«
Die Lampe, denkt Randolph, sie muß in sein Gesicht scheinen, wenn er sich zu mir wendet. Donner, der trägt ja einen prächtigen Anzug, alle Wetter!
Und da sieht der Mann nach links.
Es ist Randolph, als wenn ihn jemand tritt.
Sein Mann, kein Zweifel, das ist Harry Lowman!
Randolph zuckt zurück, als wenn eine zischelnde Schlange vor ihm aufgetaucht wäre. Er braucht eine volle Minute um zu begreifen, daß nicht Sweney, sondern er das Glück gehabt hat, Lowman zu entdecken. Unfaßbar – oder hat er sich doch geirrt – ist es vielleicht gar nicht der Mann, der Towers ein Vermögen wert ist?
Clay Randolph atmet scharf durch, dann riskiert er den nächsten Blick. Der Fremde hat nun den Hut abgenommen. Es ist das Gesicht, Towers’ Beschreibung paßt genau. Und Lowman redet sanft und freundlich, er trägt einen so feinen Anzug, daß selbst der hartgesottene Randolph niemals in ihm einen Schurken vermuten würde, der in die Stadt gekommen ist, um Towers umzubringen. Denn das soll ja angeblich die Absicht dieses feinen Mannes sein.
Adams, der Storebesitzer, lächelt geschmeichelt, als er gelobt wird. Gute Zigarren, ausgezeichnete Sorte, wie? Nun ja, wenn Lowman nichts von Zigarren verstehen soll, wer denn? Immerhin mußte er einige Zeit in der gesiebten Luft Zigarren für eine Fabrik drehen.
»Ich führe nur noch eine Sorte, die besser sein dürfte, für besondere Kunden«, sagt Adams gerade. »Es ist Queens Nummer sechs, Sir. Wenn Sie einmal probieren wollen?«
»Queens?« fragt Lowman erstaunt. »Nein, nicht möglich. Dieses herrliche Kraut findet man hier auch? Mr. Adams, Sie sind nicht nur ein guter Storehalter, sie verstehen mehr vom Geschäft als die meisten Ihrer Kollegen, die ich bisher traf. Beachtlich, höchst beachtlich!«
Adams wirft noch einen Blick auf den feinen Anzug und schleppt dann den Karton Queens Nummer sechs herbei. Genießerisch die Augen schließend, zieht der elegante Besucher an der Zigarre und sagt, die Augen wieder öffnend:
»Kolossal, in der Tat, höchst beachtlich. Diese Stadt kann sich gratulieren, einen solch beschlagenen Fachmann zu besitzen. Vom Besten nur das Beste, ein altes Handelswort, mein lieber Mr. Adams!«
Der liebe Mister Adams, der nicht weiß, wem er gegenübersteht, dienert tatsächlich. Und Lowman fragt:
»Ich hoffe, daß die führenden Leute dieser Stadt es zu schätzen wissen, daß Sie die Sorte hier führen. Mein Freund Mortimer raucht doch sicher auch die Marke?«
Mortimer, denkt Randolph draußen und umklammert sein Messer, du großer Geist – was will er denn mit Mortimer? Ich denke, er sucht Towers? Verflixte Geschichte, sollte es doch nicht Lowman sein?
»Mortimer? Sir, ich kenne keinen Mortimer!«
»Nicht?« fragt Lowman höchst verwundert. »Aber Mortimer kennen Sie nicht? Er hat zwar einen Tick, manchmal reist er wie ein Vagabund durch die Gegend, aber in Wirklichkeit ist der gute Mortimer ein reicher Mann. Sicher hat er sich hier wieder einen seiner Späße geleistet, der Spaßvogel. Ich werde Ihnen doch besser beschreiben, wie mein Freund Mortimer aussieht, Mr. Adams. Also…«
Draußen aber spitzt Randolph die Ohren und lauscht. Die Beschreibung paßt haargenau auf Towers. Das muß auch Adams merken.
»Dick, groß und wasserblaue Augen?« fragt da schon Adams verwundert. »Sir, ich kenne da einen Mann, aber es ist unmöglich, daß es sich bei dem um diesen Mortimer handelt. Der Mann, den Sie mir da beschreiben, Sir, wohnt hier, er besitzt den Saloon hundert Yards weiter rechts die Straße hinauf und heißt Towers.«
»Towers?« fragt Lowman und zieht die rechte Braue hoch. »Towers? Woran erinnert mich der Name nur? Ich glaube, Mortimer hatte einen Stiefbruder, den Sohn seiner Stiefmutter, den diese mit in die Ehe brachte. Kann sein, daß der Towers hieß – ich möchte es beinahe annehmen. Haben Sie vielleicht mal einen Schecken bei Towers gesehen? Kann ja sein, daß er ihn hat, denn Mortimer besitzt dieses Pferd. Er kann es ja bei Towers gelassen haben.«
»Nein, Mr. Towers hat nur zwei Pferde, einen Grauschimmel und eine Fuchsstute.«
Grauschimmel, denkt Lowman blitzschnell. Halunke, du bist es. Also doch, überall habe ich nach dir gefragt, in Pacerville, in Granite City, und niemand hat dich gekannt. Mortimer, unbekannt, nie gesehen. Die Beschreibung meines angeblichen Freundes Mortimer hat nirgendwo eine Reatkion bei den Leuten hervorgerufen! Und hier – ah, der gehörnte Schurke ist es, kein Zweifel, der Grauschimmel beweist es. Man muß die Leute nur richtig fragen.
»So«, sagt er scheinheilig und zuckt bedauernd die Achseln. »Dann finde ich meinen Freund Mortimer auch hier nicht. Er hat mir vor einem Jahr einmal aus dieser Gegend geschrieben. Er hatte die Absicht, sich hier niederzulassen. Aber vielleicht sollte ich doch diesen Mr. Towers fragen, ob er der Halbbruder meines Freundes Mortimer ist?«
»Versuchen Sie es nur. Mr. Towers wohnt schon anderthalb Jahre hier, wir sprechen öfter zusammen. Von einem Halbbruder hat er mir nie etwas gesagt.«
»Nun ja, ich kann mich auch nicht genau erinnern, ob mir Mortimer diesen Namen genannt hat«, erwidert Lowman bedauernd. »Wenn es sich gerade so einrichten sollte, daß ich ihn treffe – ich wollte eigentlich heute noch weiter. Einen schönen Store haben Sie, Mr. Adams, Sie sind zu beneiden.«
»Aber es gibt noch drei hier, meiner ist bescheiden, Sir!«
»Das würde ich nicht sagen«, murmelt Lowman und ist in Gedanken weit fort. »Dies ist wirklich einer der schönsten Stores, die ich jemals gesehen habe. Nun, Mr. Adams, bitte verkaufen Sie mir eine große Packung dieser prächtigen Queens Nummer sechs. Falls ich bleiben sollte, welches Hotel würden Sie mir nennen können, in dem es ruhig zugeht?«
»Nun, vielleicht Browns Hotel? Ein sehr gutes Haus, die Ingenieure aus den Minen kommen dort zusammen.«
»Danke, mein lieber Freund, vielleicht bleibe ich hier, nur ruhig muß es sein, ich brauche sehr viel Ruhe. Sollte ich reiten, dann komme ich vorher und kaufe noch etwas Mundvorrat.«
Er lächelt so schön falsch, wie er es nur kann. Und Adams kennt dieses Lächeln nicht, hinter dem sich ein Teufel versteckt. Der Teufel in Lowmans Gehirn hat den Plan schon ausgebrütet. Ja, Lowman wird die Stadt verlassen. Und vorher bei dem guten Adams einkaufen. Er wird fortreiten auf jenem Pferd, daß er in Payetteville kaufte, um im Bogen nach Idahos Grenze zurückzureiten. Ein ganz einfacher Trick Lowmans, billig und schon oft erprobt.
Lowman grinst, als er aus der Tür geht. Keiner hat sein Pferd jemals gesehen, dieses Pferd ist ehrlich gekauft, wenn auch mit gestohlenem Geld. Und keiner wird ihn sehen, wenn er in die Stadt zurückkommt, um Hipokrates Mortimer zu besuchen, der eigentlich Towers heißt. Er mußt diesen Towers nur erst sehen, dann wird er zu Adams gehen und sagen, daß er doch weiterreiten will. Und in der Nacht kommt er zurück. Amandeus Hipokrates Mortimer wird danach nicht mehr sprechen können. Er wird stumm sein wie ein Fisch!
»Du hast mich zu sehr geärgert«, sagt Lowman zischend, als er auf die Straße tritt. »Niemand legt Harry
Lowman auf die Nase – nicht ungestraft. Und bestehlen darf mich erst recht keiner. Das vergesse ich nie und keinem.«
Er geht zu seinem Pferd.
*
Randolph steht hinter der Ecke und hat ein Messer in der Hand. Er will es schon losfliegen lassen, aber im letzten Augenblick überlegt er es sich doch noch.
Der Kerl wird bestimmt versuchen, an Towers heranzukommen. Zuerst wird er ihn sehen wollen, um sicher zu sein, daß es auch sein Mann ist.
Er hat schon wieder ein Leben zuviel, der Harry Lowman. Nur weiß er es nicht.
Plötzlich stört ihn etwas. Sein Instinkt arbeitet, der Instinkt eines Wilden, eines Bösen.
Es ist nichts als diese instinkthafte Regung, die Lowman den Kopf wenden läßt. Aber in diesem Augenblick ist Randolph schon weg, verschwunden hinter der Ecke, untergetaucht.
Und doch bleibt das Gefühl in
Lowman bestehen. Er verliert es nicht. Er reitet schnell über die Straße, sieht Browns Hotel drüben und biegt in die Gasse ein. In der Gasse macht er jäh kehrt. Er weiß nicht, was los ist, aber ihm ist unbehaglich zumute.
So dreht er sein Pferd, sitzt blitzschnell ab und huscht zurück an die Ecke.
Lowmans Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen.
Ein großer breitschultriger Mann kommt hastig über die Straße und starrt auf die Gasse, in der Lowman gerade verschwunden ist. Er kommt seitlich vom Store heraus. Und läuft beinahe.
In diesem Moment zischt Lowman wie eine Schlange und knirscht mit den Zähnen. Der Mann geht ihm zu schnell. Lowman wittert etwas und dreht sich um, rennt zu seinem Pferd und reitet langsam weiter. Dort hinten ist eine Laterne an einem Haus. Laternen hängen nur dort, wo die Gasse eine Biegung macht.
Lowman ist an der Ecke. Und sieht den Mann folgen. Noch eine Ecke muß kommen. Dann wird er das Pferd anhalten, absteigen und gehen. Wer immer ihm folgt, er wird sich wundern. Lowman sieht nie nach hinten. Der Bursche kennt Lowmans Trick nicht.
Er reitet weiter. Ein Hof, ein Schuppen. Umrisse von länglichen Kästen.
Särge, denkt Lowman, sieh mal einer an, Särge!
Der Gedanke an Särge läßt ihn lächeln. Er weiß, er kann keine sechzig Yard von jenem Saloon entfernt sein, er muß sich hinter ihm befinden.
Harry Lowman ahnt etwas, aber die letzte Bestätigung fehlt noch. Dort ist ein Haltebalken. Lowman steigt ab, der Mann folgt ihm nicht. Eine ungewisse Bewegung ist lediglich am Ende der Gasse an jener Ecklaterne zu erkennen, mehr nicht.
Der wartet, denkt Harry. So, das Pferd ist festgebunden. Jetzt gehen – genau auf ihn zu. Ich wette, will er etwas, dann verdrückt er sich. Hat er ein reines Gewissen, dann wird er stehenbleiben und mich vorbeilassen. Oder habe ich mich geirrt, will der doch nichts von mir? Wie soll Hipo wissen, daß ich komme? Doch wer sagt, daß Hipo es nicht ahnt und sich vorbereitet hat? Und wenn er überall seine Leute hat? Verdammte Sache, den Kerl muß ich lebend haben, der soll sprechen. Und wenn ich ihm die Zähne mit Gewalt lockern muß!
Er geht los. Scheinbar trägt er keinen Revolver, der gute Lowman, der sanfte.
In Wirklichkeit hat er den Rock offen und somit den Revolver griffbereit.
Lowman kommt auf die Ecke zu, ist unter der Laterne. Doch niemand zu sehen. Sein Mann ist fort. Verflixte Sache, wo ist der Bursche?
Lowman blickt vorsichtig im Weitergehen nach links. Keine Nische drüben, kein dunkler Fleck. Aber die Gasse herauf, zurück zur Main Street, ist da vielleicht eine Nische, in der sich jemand verstecken kann?
Sie ist da, etwa zwanzig Yard hinter der Ecke. Dort gähnt eine Lücke zwischen den Häusern. Harry Lowman geht stur auf diese Lücke zu. Der Mann wartet dort, er fühlt es. Und sofort arbeitet sein Gehirn und rechnet sich etwas aus.
Wird der Mann gleich schießen, oder wird er erst den Arm heben, wenn Lowman gut zu sehen ist? Er muß mich gegen das Licht von der Straße her sehen, denkt Lowman, erst dann ist ein sicherer Schuß möglich. Nun gut, erst dann. Also gehen und zählen. Wie lange braucht jemand, um zu feuern?
Er rechnet und geht. Und hat keine Furcht. Das ist Harry Lowman – eiskalt und überlegen, wenn er etwas ausführt. Er will den Mann lebend – keinen Schuß. Vielleicht sind noch andere da?
Die dunkle Nische kommt. Und Lowman vertraut auf seinen Stern, auf seine Begabung, die Dinge rechtzeitig zu erkennen, sie zu analysieren. Der Mann wird warten, bis er sich gegen das helle Licht der Main Street abhebt.
Vier Schritt breit ist die Nische.
Lowman sieht nicht hinein, er wendet nicht den Kopf. Immer nur gehen, ruhig, sorglos erscheinen. Dunkelheit gähnt rechts von ihm. In der Dunkelheit steht der Mann, irgendwo lauert er.
Kein Frösteln mehr im Rücken, aber seine Ohren nehmen das kleinste Geräusch nun wahr. Da schabt etwas, es ist hinter ihm, es bewegt sich jemand. Am Holz seines Hauses schurrt etwas leicht vorbei.
Und Lowman ist sechs Schritt gegangen. Nun knirscht es leicht. Ein Fuß tritt auf irgendeinen Zweig oder ein Stück Holz. Es ist an der Ecke. Jetzt muß der Mann den Arm heben, wird er zielen und nun abdrücken.
Harry kommt wie ein Tiger herum und hechtet sich zur Seite. Da blitzt es. Der Schein der Laterne hinten an der Ecke fängt sich auf einem blitzenden Gegenstand. Aber kein Schuß.
Etwas surrt heran, es kommt und faucht an Lowman vorbei. Drei Zoll Stahl! Lowman duckt sich, spannt sich und schnellt sich ab. Seine Hand fährt unter die Jacke, der Revolver wird herausgerissen. Und da sieht er den Mann.
Hinter ihm klirrt es einmal in der Gasse, irgendwo scheppert Stahl an einem Stein. Lowman rennt federnd los, er hat sechs Schritt zu machen.
Da ist der Mann, ein dunkler Schatten, mehr nicht.
»Steh still!« sagt Lowman. »Ich erschieße dich sonst, Mensch!«
Der Mann dreht sich um, er ist fort, verschwunden in der dunklen Nische. Und Lowman setzt ihm nach, obwohl der Bursche nun seinen Revolver herausziehen und aus nächster Nähe auf ihn feuern könnte. Doch er schießt nicht. Da ist ein Zaun, Lowman sieht ihn nun. Der Zaun ist gerade mannshoch, der andere ist schon an ihm, zieht sich hoch, will hinüber und hängt auf dem Zaun. Er liegt genau auf der Oberkante der Zaunbretter.
Aber nun ist Lowman schon bei ihm, Lowman, der laufen kann wie ein Hase.
»Du Halunke!« faucht er und springt, holt aus und schlägt zweimal zu, als der Mann doch noch rutscht und auf die andere Seite stürzt.
Er setzt über den Zaun wie ein Panther und landet auf dem stöhnenden Mann, der gerade wieder hochkommen will. Da sitzt Lowman auf ihm und packt ihn. Der wollte ihn umbringen, der wollte ihn töten.
Lowman knurrt wie ein wildes Tier und drückt ihn zu Boden.
»Dir werde ich!« krächzt er zischelnd und voller Wut. »Will mich umbringen, der Kerl, will Harry Lowman nachschleichen und ihn aufhalten! Hast es nicht besser gewußt, was?«
Er sieht sich um. Alles ruhig, keiner da. Nichts rührt sich hier hinter den Häusern. Lowman steckt seinen Revolver ein, greift unter die Weste und zieht sein Messer heraus.
»Komm mit!« sagt er dann grimmig. »Kommst du mit? Du sollst lernen, wie es ist, wenn man Harry Lowman ein Messer in den Rücken werfen will. Kommst du mit, du Kerl?«
Er schleppt ihn bis zum Zaun und macht es gründlich mit ihm. Der wird nicht so schnell erwachen, der nicht!
Schon klettert Lowman, nach einem sichernden Blick, über den Zaun und hastet zu seinem Pferd. Da ist ein Seil in der Tasche. Er nimmt es und brummelt voller Gift und Galle vor sich hin. So schimpfend und knurrend kommt er zurück zu diesem Kerl und bindet ihn. Er sieht sich wieder um, einige Bäume stehen hier im Garten. Und Lowman schleppt den Burschen zu einem Baum und bindet ihn fest. Dann beschäftigt er sich mit ihm und macht ihn munter, bindet ihm sein Halstuch vor den Mund und merkt, daß der Mann gleich wach wird.
Er wartet. Er sieht ihn an und schürzt die Lippen.
Nicht mit Lowman, wie?
*
Der Mann macht die Augen auf. Und obwohl es dunkel ist, sieht Lowman genau sein Gesicht vor sich, die flatternden Augen und den starren Blick, als der Mann ihn vor sich erkennt.
»Du Kerl!« sagt Lowman wild wie ein Wolf. »Ist dir nicht geglückt, was? Wolltest du dir etwas Geld verdienen, he? Da hast du was dafür, da hast du was! Ich will dich lehren, Lowman nachschleichen zu wollen!«
Der Mann bäumt sich auf, als er in Lowmans schwarze, funkelnde Augen blickt. Lowman packt ihn, reißt ihm das Halstuch herunter und sieht ihn an, während er ihn wild rüttelt.
»Du!« sagt er zischend wie eine Schlange. »Machst du nur einmal den Mund auf und redest etwas Falsches, dann bist du geliefert, dann bist du dran!«
Er zeigt ihm sein Messer. Der Mann verdreht vor Entsetzen die Augen. Jemand wie Lowman ist ihm noch nicht begegnet.
Randolph friert am ganzen Körper, er zittert vor Furcht, er stirbt beinahe vor grausamer Angst.
Das ist ein Teufel, denkt Randolph. Wie er herumgekommen ist, wie er es gewußt hat. Der riecht alles, der merkt alles. Oh, der bringt mich um!
»Nichts mehr tun«, sagt er krächzend und ist kaum seiner Stimme mächtig.
»Oh, Lowman, tu mir nichts, ich sage alles, ich rede freiwillig, ich kann dir helfen.«
»Ich helf mir selber«, erwidert
Lowman eisig. »Wer hat dich geschickt, Towers? Und wer wartet noch auf mich? Machst du den Mund auf, du hinterlistiger Schurke?«
Der Kerl hat Angst, denkt Lowman und grinst innerlich vor Befriedigung, daß einer richtige Angst vor ihm hat. Das ist gut, Angst müssen sie vor mir haben, mir gehorchen. Hier kennt mich keiner. Towers hat einen Saloon, eine gesunde Grundlage, um einmal auf andere Art sein Geld zu verdienen. Dem werde ich Furcht einblasen, daß er heult.
»Nur noch einer, Sweney wartet noch!«
»Wo, Mensch? Sagst du es?« fragt Lowman heiser. Und spielt mit dem Messer.
»Drüben, die Straße hoch«, sagt der hartgesottene Randolph furchtsam. »Jenseits des Saloons, er hat die andere Hälfte der Straße im Auge zu behalten.«
»Woher hat der Lump Towers gewußt, daß ich unterwegs bin?«
»Das weiß ich nicht. Aber er hat uns gesagt, daß wir dich nicht zu ihm lassen dürfen.«
»Soso, nicht zu ihm lassen, hähä, dem werde ich! Was hat er geboten?«
»Fünfhundert«, stammelt der rauhe Randolph würgend. »Und für jeden Tag, den wir aufpassen, zwanzig Dollar.«
»Und wo steckt er nun, der Lump Towers, wo ist er?«
»Im Saloon, manchmal unten, manchmal oben, ich weiß nicht, ob er jetzt schon oben ist.«
»Und Sweney, sieht der ab und zu im Saloon nach? Rede, Mensch, sonst…«
»Nein, wir passen nur draußen auf!«
»Habt ihr das schon öfter gemacht?«
»Nein, nein, nicht für ihn. Es kam für uns mächtig überraschend, daß er uns brauchte, Lowman.«
»Mr. Lowman, verstanden?«
»Ja, Mr. Lowman.«
»Und sonst, für wen habt ihr da gearbeitet? Erzähle mal, spuck alles aus, was du weißt. Aber sag die Wahrheit.«
Er schlottert an allen Gliedern, der Messerheld Randolph. Und redet, so schön hat er lange nicht geredet. Dann unterbricht ihn Lowman und fragt:
»Dieser Mansfield, wer ist das?«
»Er hat nun den größten Saloon in der Stadt.«
»Ssst«, sagt Lowman und schließt einen Moment die Augen, denkt nach. Ein Gedanke kreist in seinem Kopf, ein vager Gedanke, eine Idee!
Er denkt, der Kerl, der ein Leben zuviel besitzt. Und wenn er denkt, dann wird es greulich, ganz fürchterlich wird es dann.
Sein Gegenüber am Baum aber stiert ihn an und schnattert mit den Zähnen. Kalt ist ihm, entsetzlich kalt. Was denkt dieser Teufel, was geht in ihm vor?
Da macht Lowman die Augen wieder auf und blickt ihn starr an. »Auf die Art hat er den Saloon bekommen, der Bursche? Kann er schießen? Hat er Freunde, viele Freunde?«
»Freunde, solange er zahlt.«
»Solange er zahlen kann«, erwidert Lowman und kichert. »Ei, solange er zahlen kann. Und Towers, hat der Freunde?«
»Towers? Ja, er ist ein angesehener Mann, wirklich«, sagt Randolph.
»Kennst du noch ein paar Burschen, die für Geld alles machen?«
»Ja, ja«, versichert der Messerheld Randolph. »Es gibt hier genug davon. Eine Minenstadt – wie soll es anders sein? Jeden Tag passiert hier was!«
»Dann fällt es ja nicht auf, wenn dir was passiert, he?«
Randolph wird leichenblaß und würgt. Der Teufel vor ihm kichert höhnisch, spielt mit dem Messer.
»Ich kenne alle Leute hier, ich kann dir nützlich sein. Wenn du Towers haben willst, helfe ich dir, ich schwöre es.«
»Mensch, ich habe ihn auch ohne dich. Kommt man von hinten in den Saloon und in sein Zimmer?«
Er redet, er beschreibt die Räume, den Gang, weiß alles und will nur eins: am Leben bleiben.
Towers hat zu wenig bezahlt. Kein Leben ist mit Geld zu bezahlen, wie? Randolph bettelt. Und Lowman fragt.
Nach einer halben Stunde sieht er ihn an und grinst. »Du kommst mit, du wirst ihn mir bringen, sonst stirbst du hier.«
»Ja, ja, ich tue es.«
»Ich werde ihn nicht umbringen!« sagt Harry Lowman und stößt den japsenden Randolph mehrmals in die Rippen. »Ich verspreche dir, ich werde ihm kein Haar krümmen. Du mußt nur alles tun, was ich sage. Wenn du das tust, dann bist du in einem Jahr ein reicher Mann, dann kannst du alle Teufel tanzen lassen und brauchst nie mehr zu arbeiten, Randolph. Du mußt ihn nach oben bringen. Paß auf, wie wir es machen, hör gut zu. Und machst du einen Fehler, dann weiß ich, daß ich dich nicht gebrauchen kann, dann taugst du nichts mehr für die schöne Welt. Du willst doch gut leben, so gut wie die anderen, na?«
»Ja sicher, aber wie?«
»Das sage ich euch schon. Jetzt hör zu!« Er redet. Der Teufel hat einen Plan. Und den Plan macht er wahr.
Ihm kann nichts passieren, denn er hat etwas, was sonst niemand hat:
Ein Leben zuviel!
*
Slade Towers steht hinter seinem Tresen. Er spült Gläser, schenkt ein und unterhält sich. Dann blickt er wieder auf den Spieler, der nun schon vier Tage in der Stadt ist und heute erneut in den Saloon gekommen ist. Der Fremde ist schlank, hat lange Finger und muß falschspielen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, denn der Bursche gewinnt immer wieder.
Der verdammte Kerl, denkt Towers, während er einige Gläser füllt, er gewinnt und gewinnt, wie macht er das nur? Er wechselt keine Karten aus. Und doch muß es nicht mit rechten Dingen zugehen, kann es gar nicht. Ich möchte wissen, wie er es anstellt. Ob ich ihm sage, daß er hier nicht mehr spielen soll?
Wenn das so weitergeht, dann muß ich mir einige Leute einstellen, es wird bald einen gewaltigen Krach geben, das ist immer so. Verliert einer zuviel, dann fängt er Streit an.
Er blickt hoch, weil die Seitentür aufgeht und der Luftzug ihn trifft.
In der Tür steht Randolph.
Randolph winkt, der will etwas. Du großer Gott, es wird doch nicht etwa mit Lowman zusammenhängen?
Towers verliert vor Schreck fast die Flasche aus der Hand. Die Tür schließt sich wieder, Randolph ist fort. Towers merkt, wie ihm der Schweiß ausbricht. Ich bin zu Bett, denkt Towers, ich darf mich nicht aufregen, mein Herz, das halte ich nicht aus. Was ist denn nun schon wieder? Er würde doch nicht kommen, wenn es nichts Wichtiges gibt!
Unwillkürlich greift er unter die Jacke, faßt nach dem Revolver. Das Griffstück der Waffe hat eine seltsam beruhigende Eigenschaft für ihn. Es wird schon nicht so schlimm sein. Was kann Randolph schon wollen?
Towers stellt die Flasche unter den Tresen, dreht sich um und klopft an die Tür zur Küche. Gleich darauf kommt Cliff heraus und sieht ihn fragend an.
»Übernimm den Tresen, ich muß mal nach oben, Cliff!«
»Ja, Boß!«
Towers geht auf die Tür zu, sucht dabei etwas in der Jackentasche, so sieht es aus. Wenn Randolph nun nicht im Flur ist, sondern Lowman?
Aber Randolph ist da, steht schon auf der halben Höhe der Treppe und winkt heftig.
»Wo bleibst du denn, Slade?« fragt er heiser. »Ich muß dir etwas sagen, komm schnell nach oben!«
»Hast du wieder kein Geld mehr?« Towers versucht zu scherzen. »Was ist so wichtig?«
»Nicht hier – wenn jemand kommt – oben! Im Browns ist er, komm schnell!«
»Was?«
Towers spürt, wie ihm das Blut zu Kopf steigt. Randolph geht schon die Treppe ganz hoch und bleibt vor der Tür zu Towers’ Wohnung stehen. Hastig nimmt der Salooner noch auf der Treppe den Schlüssel, kommt asthmatisch keuchend herauf und kann es nicht mehr aushalten.
»Wer ist da, der Kerl?«
»Pst, wenn jemand kommt, Slade! Ich sage dir, da ist etwas im Gange. Der Kerl sieht zwar anders aus, aber…«
Towers hat die Tür auf und schiebt Randolph hinein. Es ist dunkel im Zimmer. Towers hastet zur Lampe, steckt sie an und sieht Randolph an der Tür lehnen.
»Schließ ab, Mann!«
Randolph dreht sich um, schließt zu und kommt an den Tisch, an
dem Towers keuchend stehengeblieben ist.
»Also, was ist, Randolph?«
»Verdammt seltsam«, murmelt Randolph heiser. »Slade, etwas ist nicht richtig. Ich stehe neben dem Store, da kommt ein Reiter, ich passe auf alle Reiter besonders auf, weißt du?«
»Ja, ja, weiter, Mensch, weiter!«
»Nun gut, der Kerl ist blond, so ein großer, hagerer Kerl mit zwei Revolvern. Er geht in den Store, ich bleibe draußen und sehe ihn mir an, als er richtig im Licht steht. Er hat kaum eine Ähnlichkeit mit diesem Lowman, aber er hat sich nach dir erkundigt, nach einem Amandeus Hipokrates Mortimer. Ich dachte schon, das bist du schließlich nicht, aber dann gab er Adams eine Beschreibung von diesem Mortimer, und das bist du. Ist dir was?«
Towers verfärbt sich. Er schließt die Augen, hält sich am Tisch fest und atmet rasselnd.
»Er erkundigte sich auch nach deinen Pferden. Er meinte, das mit dem Namen, das wäre ganz einfach, du hättest einen Stiefbruder, er redete so dummes Zeug von einem Stiefbruder und der Ähnlichkeit zwischen euch. Und dann sagte er, er würde wohl wieder wegreiten, er müßte noch weiter. Aber er ist nicht weggeritten, er ist im Browns. Ich bin ihm nach. Und weißt du, was er im Browns gesagt hat?«
»Was?« fragt Towers ächzend. »Was hat er gesagt?«
»Sie sollten ein Zimmer neben dem seinen freihalten. Spätestens morgen früh würde ein Freund von ihm kommen.«
»Ein – oah – Freund von… oah! Und hat er den Namen genannt?«
»Nein. Was soll ich machen,
Slade?«
Salde Towers dreht sich um, hastet zum Fenster und zieht vorsichtig den Vorhang beiseite, um einen Blick auf die Straße zu werfen.
»Ist er noch im Browns – oder wo ist er, Randolph?«
Randolph hüstelt. Und schweigt. Und dann klickt die Tür ins Schloß.
Die Tür ist zugefallen.
Und Randolph? Wo ist Randolph?
Towers fährt herum. Er stöhnt einmal, faßt sich an die Brust und torkelt gegen die Wand. Randolph steht noch immer am Tisch. Vor der Tür aber…
Towers bekommt keine Luft mehr und faßt sich mit beiden Händen an den Hals.
Da steht er, seine schwarzen Augen sehen ihn an. Und in der Hand hält er einen Revolver.
»Amandeus Hipokrates Mortimer!« sagt der Mann, der ein Leben zuviel besitzt. Sein Mund ist leicht geöffnet, das Raubtier zeigt die Fänge. »Nun siehst du mich wieder, Hipo. Wollen wir wieder würfeln, aber nicht um Geld. Um dein Leben, Hipo, nun, wie ist das?«
Towers blickt ihn an, auf das kleine, runde Loch im Lauf des Revolvers. In Lowmans Augen ist nichts als das, was Mortimer-Towers schon damals am Feuer erkannte. In den Augen kann man es lesen, wenn sie so sind wie jetzt.
Randolph aber lächelt, Randolph, der Schurke, der Verräter, er sieht ihn an und grinst.
»Willst du nicht würfeln, Freund Hipo?« fragt Lowman sehr leise und freundlich. »Hast du Angst, du könntest verlieren, wie? Wer mich hereinlegt, der bezahlt dafür, Freund Hipokrates. Ich will weder mein Geld haben, noch will ich mein Pferd und mein Maultier zurück – ich will dich haben, verstehst du?«
»Nein, ich schreie, ich rufe um Hilfe!«
»Ehe einer kommt – was meinst du, finden sie dich lebend vor, Hipo?«
»Es war nur ein Scherz, ich wollte… ich hatte… ich wußte nicht…«
»Was wußtest du nicht?«
»Ich hatte Geld bei mir, viel Geld. Ich dachte, du würdest es erkannt haben. Darum habe ich dich…«
»Du lügst! Du bist ein heuchelnder Schuft und wolltest mein Geld haben!«
»Nein, nein, ich schwöre. Ich fürchtete, du würdest mich wegen des Geldes umbringen. Gleich als ich dich am Feuer sah, wußte ich es, aber ich hatte Angst, wieder fortzureiten. Du würdest mir nachgekommen sein, Lowman. Glaube mir doch, ich hatte nur Angst!«
»Du lügst, Freund Hipo, aber nicht gut genug!«
»Ich sage die Wahrheit, ich schwöre es! Als ich dich überfiel, da dachte ich zuerst daran, dich nur zu binden und liegenzulassen und dir nichts zu nehmen. Aber dann sagte ich mir, daß du mir auf deinem Pferd nachkommen würdest.«
Er redet nun fließender, die Angst läßt ihn schneller sprechen. »Ich versuchte es mit einem Trick. Ich dachte, wenn du mich für einen gewöhnlichen Wegelagerer und Trick-Dieb halten müßtest, dann würdest du zwar fluchen, aber niemals in mir einen Mann vermuten, der in einer Stadt einen Saloon besitzt. Ich habe nicht gedacht, daß du nach mir suchen würdest, daß du mich jemals finden würdest. Dann habe ich in der Zeitung…«
»Sei still, sonst drücke ich ab, du Halunke!«
Das kommt so fauchend heraus, daß Towers augenblicklich die Lippen zusammenpreßt.
Er bringt mich kaltlächelnd um, genauso wie die anderen, denkt Towers. Ich weiß es! Wie er mich ansieht, diese Augen!
Da kommt er, bleibt vor ihm stehen und hält ihm den Revolver vor die Weste – die angeblich weiße –, streckt die Hand aus und nimmt ihm einfach die Waffe weg. Towers wird immer kleiner, er wünscht, durch die Wand gehen zu können. Aber es gibt keine Möglichkeit zu verschwinden, es geht nicht.
»Du kannst gehen, Randolph«, sagt da Lowman langsam und kichert. »Und komm erst in einer Stunde wieder, auf die Minute genau in einer Stunde. Dann bringst du diesen Sweney mit herauf. Seht zu, daß euch niemand dabei entdeckt, verstanden?«
»Ja, Boß!«
Der geht, denkt Towers, der schleicht hinaus wie ein geprügelter Hund, der gehorchen muß. Mein Gott, was wird das?
Lowman kichert noch immer, geht rückwärts zur Tür und dreht den Schlüssel um.
»Hinsetzen, Hipo! Dort auf den Stuhl setzen und die Hände auf den Tisch legen. Und dann wollen wir uns mal unterhalten. Was danach kommt…«
Towers schlurft zum Tisch, ein Mann, der sich nicht mehr gerade halten kann vor Furcht. Dann hockt er sich auf den Stuhl, kauert zusammengesunken und die Hände auf der Tischplatte vor Lowman. Einmal hat er diesen Banditen tricksen können, aber auch nur, weil er schlief. Und ein Mensch wie Lowman, der glaubt einem anderen nur einmal etwas, wenn er hereingefallen ist. Danach wird er voller Mißtrauen sein.
Es gibt keinen Trick mehr, mit dem er Lowman loswerden könnte. Towers weiß es.
»Was willst du haben, Lowman?«
»Was hast du gelesen? Du hast gesagt, daß du in der Zeitung etwas entdeckt hast. Keine Angst, ich habe die Zeitungen auch studiert, du Dreckskerl. Und weißt du, wer daran schuld ist, daß ich es tun mußte? Du, du Schleicher, du Erzgauner. Hätte ich mein Geld und mein Pferd gehabt, na?«
So hat Towers die Sache noch nicht gesehen. Du großer Gott, das ist ja wahr. Lowman würde es nie nötig gehabt haben. Towers verfärbt sich und atmet wie ein sterbenskranker Mann.
»Du weißt also was«, fährt Lowman mit monoton eindringlicher Sprechweise fort. »Du weißt zuviel, Towers, du wirst reden, wenn du kannst, wenn, verstehst du?«
Das ist es, denkt Towers entsetzt. Er mußte sich sagen, als er die Zeitungen las, daß ich hinter dem unbekannten Banditen ihn vermuten würde. Er ist mehr darum gekommen, weil ich schweigen muß. Dies ist der Grund, und der Grund ist einleuchtend. Darum bringt er mich zum Schweigen.
»Lowman«, sagt er mühsam und hebt beschwörend die Hände. »Du kannst alles haben, was du willst. Ich habe eine Menge Geld. Ich gebe es dir, aber laß mich am Leben. Was hast du davon, wenn du mich umbringst? Gut, Tote reden nicht mehr, aber sie können dir auch kein Geld mehr geben. Und mit Geld, Lowman, kann man alles machen!«
»Eben, eben«, erwidert Lowman sarkastisch grinsend. »Aber vielleicht will ich kein Geld? Das Risiko ist mir zu groß, mein lieber Freund Hipo!«
»Nenn mich doch nicht immer Hipo.«
»Ich nenne dich so, wie es mir paßt, verstanden?«
Da ist er wieder, dieser teuflische Funke in seinen schwarzen Augen, die Wildheit, dieses unheimliche Etwas!
»Ja, ja, Lowman.«
Er sieht ihn an, bettelnd, wie niemals zuvor jemanden und stottert:
»Lowman, ich bin ein armer Teufel gewesen, ich habe vor anderen Leuten gespielt und mußte oft hungern. Dann habe ich geerbt und bin hierhergekommen. Ich weiß, wie es ist, wenn man arm ist. Hör zu, Lowman, zehntausend für mein Leben!«
Der Bandit kichert nur. Das Kichern macht Towers verrückt, er hat nie jemanden so kichern hören.
»Nicht genug!« krächzt Lowman schließlich.
»Oh, großer Geist, zwölftausend, dann bin ich beinahe arm.«
»Hähähä, reicht nicht. Mehr, Towers, mehr!«
»Ich habe ganze fünfzehntausend gespart!«
»Also dreißigtausend, was? Bursche, ich kenne euch Krämerseelen zu genau. Weißt du, wieviel ich brauche?«
»Ich werde es auftreiben, ich habe Freunde, ich kann…«
»Fünftausend, mehr nicht!«
Towers sitzt da, sein Unterkeifer klappt herab.
»Fünf… Nein, hör auf, mich zu quälen, sage doch, was du haben willst!«
»Fünftausend und deine Unterstützung!«
»Meine was…?«
»Du hörst wohl schlecht, lieber Freund Hipo, was? Ich brauche fünftausend und deine Unterstützung, mehr nicht. Hör zu, ich habe Adams erzählt, daß du einen Stiefbruder hast. Durch ihn haben wir uns kennengelernt, wir kennen uns schon sehr lange, sagen wir vier Jahre?«
»Ich verstehe nicht, was das soll.«
»Du verstehst nichts, weil du dumm bist, weiter nichts«, brummt Lowman. »Wir kennen uns, dein Stiefbruder heißt Mortimer, Hipokrates Mortimer, ein schöner Name, nicht wahr? Ich werde bei dir wohnen, einige Tage nur, ich werde in dieser Stadt bleiben. Und allen Leuten werden wir erzählen, daß ich der Freund deines Stiefbruder und damit auch dein Freund bin. Du bekommst die fünftausend Dollar in kurzer Zeit zurück, in ganz kurzer Zeit, Hipo. Nur wenn du redest, dann bist du tot. Ich werde mit dir ein Geschäft machen, dein Schweigen und deine Unterstützung für meine Pläne. Machst du nicht mit, dann gehen wir gleich und machen einen Spaziergang.«
Er sieht ihn an.
Er ist verrückt, denkt Towers, was für ein Plan? Was will er, hiebleiben? Aber wenn sie ihn jemals finden? Was wird dann sein?
Lowman sieht ihn an und sagt plötzlich:
»Sie finden mich nicht.«
Vier Worte auf Towers’ letzte Gedanken. Towers wird kreidebleich und stiert ihn entsetzt an. Er kann Gedanken lesen der Unheimliche.
»Lowman, ich…«
»Mansfield«, sagt Lowman und spannt langsam den Revolverhammer. »Weißt du, wie Mansfield zu seinem Reichtum gekommen ist?«
»Mansfield? Was heißt das, Lowman?«
»Das heißt, daß er bald wieder arm sein wird. Aber ich denke, man kann es auch anders machen, so wie er es gemacht hat. Ich werde den Saloon übernehmen.«
Towers starrt ihn entsetzt an. Was sagt der Mensch da? Den Saloon übernehmen? Und wie stellt er sich das vor?
»Denkst du, es geht nicht zu bewerkstelligen, Freund Hipo? Es wird gehen, ich sage es dir.«
Er kann wirklich Gedanken lesen, denkt Towers und schluckt verzweifelt an dem Kloß, der ihm in der Kehle steckt.
»Lowman, ich kann Mansfield nicht leiden, aber es könnte auffallen. ich weiß einen besseren Weg.«
»Du weißt was, dann sage es!«
»Da unten sitzt ein Spieler, und Mansfield spielt selber zu gern. Ihn juckt es, wenn er Karten sieht. Man müßte einen Spieler haben, der Mansfield hereinlegt und ihn verlieren läßt. Ich wette, Mansfield sieht rot, er hängt zu sehr an seinem
Geld. Er wird sein Geld zurückhaben wollen und jemanden hinter dem Spieler herschicken, der… Verstehst du?«
»Umständlich, zu umständlich, wenn auch nicht schlecht. Du möchtest gern den größten Saloon in der Stadt haben, he?«
Er sieht ihn an und weiß es. Der dicke Towers träumt davon.
»Gib mir das Geld«, sagt Lowman. »Ich mache dich dazu. Habe ich genug verdient, dann gehe ich weg. Ich will soviel haben, daß es bis an den Rest meiner Tage reicht. Dann kannst du hier verdienen, soviel du nur willst. Steigst du mit ein, Towers? Du hast die Wahl, entweder mitmachen oder…«
Es gibt kein Oder, Towers kennt seine Chance. Mansfield ist auf die ganz krumme Art zu seinem Saloon gekommen.
Er überlegt, der Slade Towers. Dies ist eine Minenstadt, rauh bis in den letzten Winkel. Hier gibt es kein Gesetz außer dem, das man sich selber macht.
»Und mir passiert nichts, du läßt mich…«
»Ja«, sagt der Mann, der ein Leben zuviel besitzt. »Nun, willst du, Towers?«
Er nickt. Lowman könnte ihn mitnehmen, vorher aber das Geld aus seinem Schreibtisch holen. Und einen Spaziergang mit ihm machen. Randolph würde glatt, wenn er genug Geld bekäme, gegen ihn aussagen. Danach würde es für jeden so aussehen, als wenn er, Towers, auf Lowman mit dem Revolver losgegangen wäre.
Towers nickt langsam. Er hat sein Leben gerettet, für den Augenblick.
Eines Tages wird er wissen, daß dies sein erster Fehler war. Aber dann wird es zu spät sein, denn er besitzt das nicht, was Lowman besitzt…
Ein Leben zuviel!
*
Er heißt Crawley und spielt seit seinem dreizehnten Lebensjahr. Spielen ist sein Beruf, etwas anderes hat er nie gelernt. Sein Vater war ein Spieler, der auf einem Mississippidampfer sein Geld verdiente. Von seinem Vater lernte er die ersten Tricks – nur einen nicht: Wie man eine Kugel auffängt, die aus drei Schritt Entfernung auf einen abgefeuert wird.
Manchmal, wenn Stewart Crawley sich an seine Jugend erinnert, hängt ihm dieses Land zum Hals heraus. Aber die schöne Zeit auf dem Mississippi ist mit dem Bürgerkriegsende auch langsam gestorben. Es gibt nur noch wenige große Spieler dort. Der ferne Westen hat die anderen gelockt wie auch Stewart Crawley.
Niemand konnte den Trick ahnen, mit dem Stewart Crawleys Vater seine Runden gewann. Er konnte mischen – und das auf eine besondere Art, die niemandem auffällt. Bereits beim Aufnehmen der Karten nach einer Runde konnte der alte Crawley die Karten so schieben, daß fünf gute beisammenlagen, fünf, die er sich gab. Damit gewann er und ernährte seine Frau und seinen Sohn. Aber eines Tages fühlte sich jemand betrogen und schoß.
Von dem Tag an übte Crawleys Sohn Stewart den Trick seines Vaters, bis auch er ihn beherrschte. Viele versuchten das gleiche, aber kaum einem konnte es gelingen.
An diesem Abend, den Crawley nie vergessen wird, setzt sich ein Fremder an den Tisch. Der Fremde hat dunkles Haar und schwarze Augen. Er spielt mit ihm, wie er mit den anderen spielte. Der Fremde verliert, wie all die anderen, die mit Crawley gespielt haben. Er geht weg. Und Crawley macht noch einige Runden, ehe auch er die Karten hinlegt.
Und dann verläßt er den Saloon von Towers.
Der Fremde sitzt an einem Tisch und lächelt, als Crawley geht. Er sieht ihm nach, steht dann auf und verläßt den Saloon durch den Hinterausgang. Kaum ist Lowman draußen, als er auch schon zu laufen beginnt. Er läuft schnell, er hat es eilig und erreicht Browns Hotel, in dem Crawley wohnt, eine halbe Minute vor diesem.
An der Hoftür des Zaunes steht ein Mann und deutet auf die Treppe, die außen an der Wand heraufführt und am ersten Geschoß des Hotels en-
det.
»Nun, Randolph?«
»Sie schlafen schon, nur der Hausdiener ist noch unten, Boß.«
Lowman geht leise die Treppe hoch. Randolph folgt ihm und drückt sich hinter Lowman durch die Tür in den Gang. Sie gehen leise bis auf die offene Tür zu, in der Sweney steht und lächelt.
Dann schließt sich die Tür hinter Randolph und Lowman. Es schnappt nur einmal, jemand schließt ein Schloß zu.
Über die Straße kommt Crawley, er hat wie immer die Hand in der Tasche. Einige Leute haben ihn beobachtet und wissen, daß er ständig seinen Revolver umklammert, solange er auf der Straße geht. Erst vor zwei Tagen hat man einen anderen Spieler aus Mansfields Saloon überfallen und ihn ausgeraubt.
»Guten Abend, Mr. Crawley«, sagt der Hausdiener unten und verbirgt mühsam sein Gähnen. »Einen guten Tag gehabt, Mr. Crawley?«
»Ja, ich hoffe schon.«
Crawley, ein großer blonder Mann, lächelt leicht. Er bekommt seinen Schlüssel, geht nach oben. Ganz hinten an der Gangbiegung ist Crawleys Zimmer.
Noch vierzehn Tage, sagt sich
Crawley, als er dicht vor der Tür ist. Länger kann man das in keiner Stadt machen, dann fällt es zu sehr auf. Niemand gewinnt dauernd. Die Leute werden schon nach einer Woche mißtrauisch. Vielleicht sollte ich doch besser nur noch ein paar Tage bleiben?
Er steckt den Schlüssel ins Schloß, schließt um und tritt in den Raum.
*
Der Mann neben der Tür steht bis zu dieser Sekunde still, die Hand erhoben.
Dann aber wendet sich Crawley in der Dunkelheit um, er zeichnet sich klar und deutlich gegen das Licht im Flur ab.
In diesem Augenblick macht der Mann hinter ihm einen einzigen, blitzschnellen Schritt.
Es klirrt einmal am Boden. Craw-ley hat den Schlüssel verloren.
Aus der Dunkelheit aber kommt eine Hand, erfaßt den Türdrücker und schließt ruhig die Tür.
»Licht, macht Licht!«
Ein Streichholz ratscht, dann brennt der Docht, es wird hell im Zimmer.
Randolph steht, Crawley haltend, vor der Tür. Sweney blinzelt leicht, sieht dann zu Lowman und fröstelt, als er in dessen kalte Augen blickt.
»Bringt ihn zum Tisch, setzt ihn hin und tastet ihn ab.«
Randolph trägt Crawley zum Stuhl, Sweney faßt mit an und tastet den Spieler dann ab. Er blickt einen Moment auf das Geld, das er aus
Crawleys Tasche holt, seine Hand zaudert.
»Sweney, laß das!«
Der Mann spricht ganz leise und warnend. Sweney zuckt zusammen, beißt sich auf die Lippen und legt das Geld auf den Tisch. Neben das Geld kommt der Revolver und dazu noch ein Derringer. Aus der Hosentasche ein Faltmesser.
»Er hat ja keine Karten bei sich«, sagt Randolph heiser, unterdrückt und staunend. »Boß, aber du hast doch gesagt, daß er…«
»Er spielt auch falsch, er mischt nicht ehrlich, der Bursche«, erwidert Lowman leise. »Geh zur Tür, Randolph, mach die Ohren auf und sage, wenn jemand kommen sollte. Tritt hinter ihn, Sweney!«
Er geht geräuschlos um den Tisch und setzt sich auf den anderen
Stuhl.
Dann wartet er, blickt den Spieler an und lächelt einen Moment. Einmal hat Lowman selber versucht, diesen Trick zu erlernen, aber er schaffte es nie ganz, sein Auge ist nie schnell genug gewesen, die zwischen den Fingern gleitenden Karten zu erfassen und immer ihre Lage bestimmen zu können. Man lernt viel, wenn man gesiebte Luft atmet, denkt Lowman einen Moment lang. Man trifft alle Arten von Strolchen dort.
»Fest packen, Sweney!«
Der Spieler stöhnt, hebt den Kopf, und dann erstarrt er.
In der Hand auf dem Tisch liegt ein Revolver.
»Hallo, Crawley«, sagt der Mann ganz leise. »Nur keinen Fehler machen, Falschspieler, nur nicht. Hinter dir… Merkst du es?«
Sweney drückt einmal. Danach weiß Crawley, daß er keinen lauten Schrei ausstoßen könnte, der Schrei würde erstickt werden.
»Was, zum Teufel, soll das bedeuten«, murmelt er verstört. »Ich habe nichts getan, ich…«
»Du spielst falsch, Crawley«, erwidert Harry Lowman eisig. »Ich mag Leute nicht, die andere betrügen, schon gar nicht im Saloon eines Mannes, der mein Freund ist, Crawley. Paß auf, mein Lieber!«
Seine linke Hand schleudert ein Paket Spielkarten vor Crawley auf die Platte. »Da, mischen.«
Crawley erstarrt, er weiß es nun. Dieser Mann, mit dem er einige Stunden am Tisch gesessen hat, kennt den Trick.
»Mischen, Crawley, genauso wie im Saloon. Oder soll ich es dir vormachen! Nun gut.«
Er nimmt das Paket, bricht es auf und teilt fünf Haufen zu je fünf Karten aus, aber sie liegen mit dem Blatt nach oben.
»Du kannst auf zwei Arten mischen«, sagt Lowman düster und drohend. »Ich kenne den Trick, ich bin nur nicht geschickt genug, Crawley. Soviel ich weiß, hat es bis heute nur etwa ein halbes Dutzend Spieler gegeben, die den Trick beherrschten. Du bist einer von ihnen, ich weiß es. Jetzt mische, mein Freund. Wenn du es nicht tust, wird man gezinkte Karten bei dir finden. Willst du nun mischen?«
»Verflixte Teufelei. Nimm dein Geld zurück und verschwinde!«
Er blickt in Lowmans Augen und zuckt zurück. Die Augen sind zwei brennende Punkte. Und Crawley ist nicht der Mann, der den Ausdruck dieser Augen nicht erkennen kann.
»Du spielst falsch!« sagt Lowman eiskalt und zischend. »Wie du falschspielst, das ist gleich. Was du machst, das ist Betrug. Ein Falschspieler kann von jedem, der ihn erwischt, erschossen werden, das weißt du doch, Craw-ley. Mischt du nun endlich?«
Crawley schluckt, er erkennt den fast hypnotischen Willen, den dieser Bursche ihm aufzwingt, er versucht sich gegen ihn zu sträuben, aber er ist nicht stark genug. Mit einem heiseren Laut greift er nach den Karten und beginnt zu mischen. Als er die Karten hinlegt, jeweils fünf Karten auf fünf Plätzen, liegen sämtliche Pik-Karten der Fünferreihe bei ihm. Sweney stößt einen japsenden Laut aus. Randolph stiert sprachlos auf die Karten.
»Verteufelte Sache, wie hat er das gemacht, Boß?« fragt Randolph verwundert. »Das ist Hexerei!«
»Nichts als ein besonderes scharfes Auge und schnelle Finger. Crawley, zeige ihnen, wie man eine gemischte Reihe aus Kreuz und Pik hinzaubert, schnell, tue es, sie sollen etwas zu sehen bekommen, um es auch zu machen!« Er kichert spöttisch, denn er weiß, daß weder Sweney noch Randolph es jemals schaffen werden.
Crawley gehorcht und fragt sich, was der Mann von ihm will. Hier sitzen und einige Tricks zeigen, wofür soll das gut sein? Die gemischte Reihe liegt gleich darauf auf dem Tisch.
»Es ist genug«, stellt Lowman danach trocken fest.
»Und nun, Crawley, wollen wir uns unterhalten. Kennst du alle Tricks, die jemand anwenden kann? Den Drei-Finger-Trick, alle Zinkzeichen, jeden Mischtrick?«
»Kann sein.«
»Ja oder nein?«
»Ja«, sagt Crawley und kann Lowman nicht in die schwarzen Augen blicken.
»Ich kenne sie. Und was soll das?«
»Ich kenne auch ein paar Tricks«, antwortet Lowman kalt.
»Man beschuldigt jemand des Falschspiels, schießt ihn nieder und praktiziert dann ein gezinktes Kartenspiel in seine Tasche. Das ist Beweis genug, wie du sicher längst erfahren hast. Crawley, wir haben uns nach dir erkundigt. Du hast in Gra-
nite City und in Bannock City drüben gespielt, genauso in Virginia City. Jedesmal nur eine kurze Zeit und jedesmal gefährlich. Jemand hätte dich erschießen können, stimmt es? Das kann dir jeden Tag passieren. Du verdienst an einem Abend manchmal bis zu hundert Dollar, manchmal aber nur dreißig oder sechzig. Wie wäre es, wenn du jeden Abend siebzig Dollar verdienen würdest, ohne zu spielen?« Crawly starrt ihn an und schluckt.
»Ich soll nicht spielen und doch...«
»Ja, genau das. Was willst du, als Falschspieler erwischt werden oder ohne zu spielen mit leichter Hand Geld verdienen?«
»Hast du mich dazu ›besucht‹?«
»Auch das, mein Freund. Du kennst eine ganze Menge Spieler. Ich brauche ein halbes Dutzend. Du suchst sie aus und teilst sie ein, du überwachst sie. Und andere passen auf, daß keinem Spieler etwas geschieht, auch wenn er nicht ganz ehrlich spielt.«
»Niemand verschenkt etwas«, murmelt der Spieler vorsichtig und lauernd. »Was muß ich dafür tun?«
»Nur eine Kleinigkeit«, erwidert Lowman und lächelt seltsam. »Du gehst morgen in Mansfields Saloon und machst ein Spiel.«
»Mit wem?«
Das ist der Haken, denkt Crawley, aber er hat schon angebissen. Geld, ohne zu arbeiten, im Monat zweitausend Dollar, das kann er nur unter den günstigsten Umständen verdienen, wenn er jede Nacht am Spieltisch sitzt und täglich sein Leben riskiert.
»Mit Mr. Mansfield selber, er hat seinen Spieltag morgen. Und er muß verlieren. Er kann schlecht verlieren, aber er ist ein verrückter Spieler, der nicht aufhören kann.«
»Zum Teufel, Mansfield hat einen rauhen Haufen, drei oder vier Mann in seinem Saloon«, erwidert Cwawley besorgt, der sich den Saloon längst angesehen hat und dort selten spielt. »Die Burschen schlagen mich in Stücke.«
»Sie werden nichts tun«, entgegnet Lowman und lächelt wieder seltsam. »Manchmal hat ein Mann einen Fehler, er ist zu geizig gegenüber seinen Leuten. Er wird auch keinen öffentlichen Krach provozieren, dazu ist er viel zu schlau, Crawley. Er wird dir jemanden nachschicken, einen Mann mit einem Revolver!«
Crawley schluckt schwer und wird blaß.
»Dann wird der Kerl schießen und…«
»Er wird nicht treffen.«
»Und woher willst du das wissen?«
»Ich weiß es. Dies hast du zu tun, um alles andere mach dir keine Sorgen. Du wirst zuerst an einem der Tische in seinem Saloon mit einigen Minern spielen. Du verlierst fünfhundert Dollar an sie, ein ehrliches Spiel für sie, ein falsches für dich. Gib ihnen Karten, daß sie gewinnen können und müssen. Danach gehst du an Mansfields Tisch, Crawley. Dort verlierst du zu Anfang auch. Dann aber gewinnst du. Zieh ihm das Hemd aus!«
»Und wenn doch einer auf mich losgeht?« fragt der Spieler nervös. »Hör mal, wer garantiert mir, daß mir nichts geschieht?«
»Ich, das muß dir reichen.«
»Und was hast du vor?«
»Das«, sagt Lowman, und seine schwarzen Augen sind wie zwei kalte, sengende Flammen, »geht dich nichts an. Ich würde auch an deiner Stelle keinen Versuch machen, die Stadt zu verlassen. Du kommst nicht heraus, Crawley. Jetzt spielst du einmal für mich, und dann gewinnst du das Paradies!«
Das Paradies gewinnen.
Er wird es gewinnen.
Er ahnt nur nicht, wie!
*
Der Mann schielt, er heißt Johnes oder John oder auch Johnny, genau weiß das niemand. Johnny lungert viel herum, er arbeitet selten, hat aber ab und zu einen Haufen Geld, wie heute.
Johnny ist ein feiner Mann, auch wenn er schielt und herumlungert. Johnny hat heute Geburtstag, sagt er. Er hat Spendierhosen an, das Geld in seinen Taschen will nicht alle werden. Der Saloon von Towers ist voller Miner. Es ist seltsam, aber sie kommen in Scharen, als sich herumspricht, daß Johnny Geburtstag hat und tiefe Taschen.
Sie singen schon, Johnny bezahlt alles.
Slade aber steht hinter dem Tresen und hat Magenschmerzen. Nicht vom vielen Essen, von dem, was noch kommen wird.
Er ist ein Teufel, denkt Slade Towers, ein verrückter, aber ein tödlich schlauer Teufel. Er schafft es, ich weiß es, er wird sein Spiel machen. Und ich mache mit!
Er schenkt aus und blickt auf die Uhr.
Ein anderer Mann blickt auch auf die Uhr.
Nach zwei Minuten legt Crawley seufzend die Karten hin und sagt spröde:
»Tut mir leid, Freunde, ich halte das Spiel nicht länger. Einmal hat jeder Glück oder Pech, heute ist mein Pechtag. Tut mir sehr leid.«
Der Mann, der ihm gegenübersitzt, ein rauhbeiniger Miner, grinst.
»Ho, Mann«, murmelt er dann beruhigend, »laß den Kopf nicht hängen. Geld hin, Geld her, die schönste Eigenschaft des Geldes ist, daß es rollt. Nimmst du einen Drink mit mir? Das Geld, das ich dir abgenommen habe, muß wieder unter die Leute.«
»Sicher, warum nicht?« erwidert Crawley.
Der Miner steht auf, sieht sich um, blickt Randolph an, der am Tresen lehnt.
Randolph kneift langsam ein Auge zu und nickt unmerklich. Dann macht er Platz am Tresen. Der Miner kommt, ein halbes Dutzend dieser rauhbeinigen Burschen folgen ihm, weitere kommen hinzu.
Die erste Runde steht auf dem Tresen, der Spieler hält sein Glas und hört den Miner sagen:
»He, Freunde, trinken wir auf das Wohl dieses prächtigen Burschen, der so anständig verlieren kann. Trinken wir darauf, daß er noch lange lebt und uns wieder ein Dutzend Runden verschaffen wird.«
Sie lachen, sie trinken und klopfen dem anständigen Verlierer derb auf die Schultern.
Der anständige Verlierer aber stellt bald sein Glas hin und geht zwischen den Tischen durch. Dann sieht er
Lowman, der die Karten hinlegt und bedauernd sagt:
»Pech für mich, Mr. Mansfield, ich muß aufhören. Meine Kasse ist für heute leer. Hallo, mein Freund, hier wird ein Platz frei. Mr. Mansfield gewinnt zu oft!«
»Wenn ich spiele«, sagt Mansfield und bleckt die Pferdezähne, »dann will ich auch etwas sehen. He, hast du nicht gerade verloren, Mister?«
»Ich habe meinen schlechten Tag«, murmelt Crawley düster. »Man soll aufhören, wenn man dauernd verliert.«
»Dafür hast du die anderen Tage gewonnen, hörte ich«, gibt Mansfield zurück. »Nun, man soll nie aufstecken, kein richtiger Spieler hört auf, wenn er einmal eine Pechsträhne hat. Komm her, Lowman macht Schluß, er hat die Bank gehalten. Löse ihn ab, du mußt nicht aufgeben, mein Freund.«
»Ich…«
Crawley geht zaudernd einen Schritt weiter, dreht sich dann aber um und seufzt tief.
»Nun gut«, sagt er dann mürrisch. »Vielleicht haben Sie recht, mein Freund. Ich halte also. Irgendwelche Bedingungen?«
»Kein Limit, das ist die einzige, Mister«, antwortet Mansfield und lächelt zu ihm hin. »Jeder kann kaufen, soviel er will, und jeder kann einsetzen solange die anderen noch Atem haben.«
»Atem habe ich bald keinen mehr, wenn es so weitergeht«, murmelt Crawley. »Also, die Karten, Gentlemen!«
»Passen Sie auf, Spieler!« warnt ihn Lowman mit einem schwachen Versuch zu grinsen. »Mr. Mansfield ist ein scharfer Bluffer und heute auf der Gewinnreise. Viel Glück!«
»Dazu sitze ich auf dem falschen Platz. Sie haben auch verloren, Fremder«, erwidert Crawley nur. Dann mischt er und teilt aus.
Beim Spiel blickt er sich um.
An der Stirnwand lehnt ein Mann, hat die Arme auf der Brust verschränkt und blickt über die Köpfe der Menge im Saal hinweg. Drüben neben der Tür sitzt einer einsam an einem Tisch. Der Bursche kann sofort den Ausgang sperren.
Der dritte Mann aus Mansfields Garde aber hilft hinter dem Tresen aus. Allerdings spült er nur Gläser, eine Arbeit, bei der er den ganzen Saal beobachten kann.
Mitten unter den Leuten am Tresen aber steht Sweney, kratzt sich in seinen roten Borstenhaaren und grinst dann eine Sekunde, um sich wieder abzuwenden.
Crawley spielt, er verliert die erste Runde. Er verliert auch die zweite und dritte.
»Mein Pech hält an«, sagt er.
»Noch drei Runden, dann muß ich aussteigen, Gentlemen. Eine kaufen, Mr. Mansfield?«
Er kauft, dieser Mansfield, und weiß es nicht. Aber der andere weiß es, Lowman ahnt es. Das Blatt wird sich nun wenden.
Und es wendete sich.
Als das Spiel zu Ende ist, schwitzt Mansfield und hat achtzig Dollar verloren. Nicht viel, aber der Verlust stachelt Mansfield zu neuen Taten und der nächsten Runde an.
Der Spieler streicht seinen ersten Gewinn an diesem Abend ein und lächelt unsicher. Er hat Angst, der Spieler, weil er nicht weiß, ob man auf ihn schießen wird, oder einer von Mansfields Aufpassern nicht den Trick versucht, von dem Lowman gesprochen hat – Karten in seinen Rock zu schmuggeln, wenn er schon tot ist. Das genügt als Beweis. Und Crawley wird tot sein.
Er mischt, teilt aus, setzt über hundert Dollar ein, weil ein Mann mitgeht, der auf sein Blatt vertraut, das ihm Crawley mit eiskalter Berechnung in die Hand gedrückt hat: Mansfield geht mit.
Hundertsechzig Dollar setzt Mansfield. Dann sagt er:
»Spieler, genug geblufft, drehen wir um.«
Er denkt, daß Crawley geblufft hat.
Der Spieler nickt und blinzelt zum Tresen. Lowman steht da – gleichgültig, seine schwarzen Augen sind wie von Schleiern bedeckt. Niemand kann sehen, was dieser Lowman denkt.
Mansfield trinkt hastig, Lowman sieht es und schürzt die schmalen Lippen.
Ich wußte es, denkt Lowman, er kann nicht verlieren, der Narr. Der Spieler macht es genau richtig, hat ihm die Karten gegeben, wie er es wollte. Geirrt, Mansfield, was? Kein gutes Blatt, der Spieler hat noch ein besseres. Und du grübelst nun dar-über nach, wie das möglich ist, du begreifst es nicht, wie?
Er lächelt einmal. Böse sein, sich freuen, wenn andere verlieren und es doch nicht können.
Mansfield blickt den Spieler an. Der zieht die linke Braue hoch und lächelt dünn.
»Pech genug heute«, sagt Crawley. »Ich glaube, ich bin heraus, aber man kann nie wissen. Vielleicht ändert es sich. Wollen Sie aufhören, Mr. Mansfield?«
»Nein!«
Es klingt gepreßt und scharf. Der Spieler nickt und gibt.
Er verliert dieses Spiel, wirft den Köder aus und läßt Mansfield dreißig Dollar gewinnen. Mansfield lächelt wieder. Also doch nur Zufall? Immer hat der Spieler kein Glück, wie?
Noch ein Spiel, Crawley teilt aus, kauft, legt ab, hat seine Karten längst und bietet. Der Einsatz steigt.
Der blufft, denkt Mansfield, nun bist du dran, Freundchen, die Hosen ausziehen werde ich dir!
Hundertsiebzig Dollar auf dem Tisch, zweihundert werden es, zweihundertzwanzig. Mansfield hält mit, der Spieler zaudert, wird vorsichtig.
Aha, denkt Mansfield, du kannst nicht mehr, was?
»Nun, noch zwanzig, Spieler?«
Crawley seufzt, schüttelt den Kopf und legt doch die zwanzig Dollar hin. Leute sind aufgestanden, stehen herum und schlucken, als Mansfield mitzieht. Zweihundertvierzig Dollar Einsatz. Und nun?
Durch den Spieler scheint ein Ruck zu gehen. Er legt fünfzig Dollar hin und blickt Mansfield an.
Er ist nicht sicher, er blufft, denkt Mansfield. Oder doch nicht? Was hat der vor?
Er zieht mit.
Der Spieler erhöht wieder, die Leute vergessen zu atmen. Geht Mansfield mit?
Er geht mit.
Lowman lächelt. Es läuft, denkt Lowman, es läuft. Der geldgierige, hakennasige Schurke Mansfield, jetzt ist er geliefert, das verdaut er nicht.
»Fünfzig, Mr. Mansfield.«
Die Stimme des Spielers klingt monoton.
»Fünfzig, Spieler!«
Wo soll das hinführen? Die beiden spielen, als wenn sie jeder eine Schlacht zu gewinnen haben.
»Wollen wir aufdecken, Mr. Mansfield?«
Mansfield überlegt einen Augenblick.
»Ja, Spieler!«
Er dreht die Hand um, da liegen sie, die ganze Kreuzreihe ist komplett.
Mansfield wird kreidebleich, er macht den Mund auf, stiert in das ruhige Gesicht des Spielers und knirscht mit den Zähnen. Verfluchter Kartenhai, irgendein Trick, welcher satanische Trick ist das? Die ganze Kreuzreihe! Das As, der König, die Dame, der Bube und die Zehn!
Ich springe ihm ins Gesicht, dem Betrüger, dem Lumpen, so was gibt es nicht, denkt Mansfield, Beherrschung, nur Beherrschung. Dem werde ich zeigen, wie man aus der Stadt getragen wird. Nicht weit, nein, nicht weit, das ist Betrug gewesen, ich weiß es, aber wie hat er es getan?
»Nun, Revanche, Mr. Mansfield?«
»Ich habe genug!«
Mansfield sagt es, steht hölzern auf und geht grußlos davon. Der Ärger frißt ihn auf. Er verschwindet durch die Hintertür. Und der Spieler, der sich umblickt, sieht weder Sweney noch Randolph. Nur der unheimliche Lowman ist noch immer da. Er sieht ihn an und lächelt leicht.
Ich soll noch weiterspielen, denkt Crawley, das hat er gesagt. Eine halbe Stunde, bis nach Mitternacht. Und dann soll ich aufstehen und den Sa-loon verlassen. Verschwindet einer der Burschen von Mansfield?
Er spielt weiter, gewinnt, verliert einmal. Am Tresen aber spendiert jener Miner noch zwei Runden und trinkt auf Crawleys Wohl, auf die Gesundheit des Verlierers Crawley, der ihm so viel Geld geschenkt hat. Lowman bekommt ein Glas in die Hand gedrückt. Es kostet ihn Überwindung, den Geruch unter der Nase zu haben, aber der Zweck heiligt die Mittel.
Und der Spieler?
Crawley sieht einen Mann kommen, er geht zu dem großen Burschen an der Stirnseite, spricht kurz mit ihm. Der große Bursche verschwindet, er verläßt den Saloon und bleibt zehn Minuten fort.
Crawley spürt, wie ihm die Hände feucht werden, als der Mann wiederkommt. Doch dann sieht er etwas, eine Kleinigkeit nur: Der große Bursche, der Smith heißt, nickt Lowman einmal zu – unmerklich für den, der nicht bis unter die Haare voller Mißtrauen steckt.
Mein Gott, denkt Crawley, das ist ein Teufel. Er hat Mansfield die Leute abgekauft, sie arbeiten für ihn.
Er atmet erleichtert auf. Der Mann Smith nimmt seinen Platz wieder ein.
Und Crawley spielt nocht einmal. Dann hört er auf, geht zum Tresen und sieht Lowman kommen. Ihre Wege kreuzen sich. Lowman senkt den Kopf und zischelt:
»Keine Angst, geh ruhig hinaus zum Hotel.«
Der Spieler trinkt wie jeden Abend seine zwei Gläser Whisky. Er bezahlt, dreht sich um und geht auf die Tür zu. Dabei blickt er zur Stirnwand.
Smith ist fort. Lowman ist fort, Sweney und Randolph sind verschwunden. Ein Miner torkelt auf ihn zu und klopft ihm auf die Schulter.
»Du bist unser Freund, unser Freund bist du – hupp.«
Er grinst. Der Miner taumelt weiter. Er geht hinaus, steht auf dem Vorbau und friert. Mein Gott, hat er eine Angst! Da links ist der Barbierladen. Vor dem soll er stehenbleiben. Danach bis hundert zählen und weitergehen, bis zu der Station soll er marschieren. Das sind sechzig Schritt. Und von der Station bis zu Towers Saloon noch vierzig. Die Station ist dunkel, kein Licht. Das Hoftor steht offen, ein dunkles Loch. Von diesem Loch aus soll er schräg über die Straße gehen, sein Rücken wird auf das dunkle Hofviereck zeigen. Und auf den Rücken wird jemand zielen.
Ihm ist schlecht, aber er geht. Seine Schritte hallen auf den Gehsteigbohlen wieder.
Lowman steht mit einem Mann zusammen zehn Schritt weiter. Die beiden Männer kommen auf ihn zu. Einer sagt leise:
»Geh weiter, keine Furcht!«
»Der hat gut reden, was?«
Lowman verschwindet erneut im Saloon von Mansfield, die Tür klappt hörbar.
Zur selben Zeit sagt der Mann, der Johnny heißt und angeblich Geburtstag hat, bei Towers im Saloon:
»Leute, ich muß mal raus, frische Luft – frische Luft!«
Johnny, das Geburtstagskind, dessen Taschen nicht leer werden wollen, torkelt auf die Tür zu. Vor der Tür steht Sweney.
»Nicht so schnell«, zischt Sweney. »Mach langsam, Johnny. Er steht erst vor dem Barbierladen. Laß ihn an der Station sein und losgehen, um die Straße zu überqueren, dann torkle davon.«
Johnny wankt auf den Haltebalken zu und rülpst laut. Dort sinkt er über den Balken, aber er blinzelt nun nach rechts.
Einer steht vor dem Bäckerladen, einer am Barbiergeschäft und zählt langsam.
»Siebenundneunzig – achtundneunzig – neunundneunzig – hundert!«
Der Spieler geht langsam los. Seine Knie zittern, er hat Angst. Wenn Lowman sein Wort nicht hält, wenn er ihn nun umbringen will? Das ist es, was Crawley die ganze Zeit schon fürchtet, davon zittert er.
Die Station kommt, das Hoftor ist offen. Zwei Männer treten drüben vom Gehsteig und wandern über die Straße. Sie müssen etwa sechs, sieben Schritte neben dem Hoftor auf den anderen Gehsteig kommen. Aber sie bleiben noch auf der Straße stehen, etwa zwölf Schritte bis zum Hoftor, vor dem Crawley nun ist.
Die Dunkelheit, wenn der Kerl jetzt schießt?
Nichts geschieht. Crawley biegt ab, will nach drüben, überquert die Straße und sieht von links einen Mann herantaumeln. Der Mann stolpert, läuft dann schwankend einige Schritte, ist sehr nahe, kommt auf ihn zu und sagt laut und mit trunkener Stimme:
»He – hallo, Bruder! Du bist doch mei... mein Bruder, was? Ich habe Geburtstag, alle sind meine Brüder heute. Komm her, wir müssen zusammen trin...«
Dann ist er bei ihm und streckt die Hände aus.
Im gleichen Moment tritt der Mann aus dem Hoftor, hebt den Arm, steht noch im Schatten des Zaunes.
Einer der beiden Männer, die auf der Straße stehen und reden, stößt jäh einen gellenden Schrei aus.
»Vorsicht – Spieler, Vorsicht!«
Und dann kracht es.
Es kracht einmal laut und peitschend.
Der Schuß fällt, als der Mann, der angeblich Geburtstag hat, sich schwer an Crawley lehnt.
Crawley hört den Knall, spürt einen Schlag, sieht seinen Hut fliegen. Und hört den zweiten Knall.
Johnny, das Geburtstagskind, stößt einen gellenden Schrei aus, reißt
sein rechtes Bein hoch, wirft sich gegen Crawley und reißt ihn zu Bo-
den.
»Hilfe, ich bin getroffen, er hat mich erschossen.«
Johnny schreit, er dürfte nicht schreien können, er ist ja erschossen worden. Aber Johnny ist betrunken, wer nimmt es da genau?
Die beiden Männer auf der Straße ducken sich, sehen noch einen Schatten hinter dem Tor verschwinden, laufen los, brüllen laut und stürzen auf das Tor zu. Hinter dem Tor kracht es noch zweimal. Einer der beiden Männer wirft sich flach hin, der andere schießt rasend schnell. Aus dem Hof antwortet noch ein Schuß. Dann ist der erste Verfolger im Tor, kommt in den Hof und drückt ab.
Klick. Verschossen.
»Halt, halt!« schreit er, holt aus, schleudert seinen Revolver weg und rast dem fliehenden Mann nach, der gerade über den Zaun hinten steigen will.
Der andere ist schon wieder hoch, er stürzt zum Tor und hört den anderen schreien:
»Ich habe ihn, ich habe ihn! Mein Revolver hat ihn getroffen. Ich habe ihm meinen Revolver an den Kopf geworfen. Komm schnell, schnell!«
Einer kreischt, als sie ihn packen. Und sagt leise:
»Macht es nicht zu rauh!«
»Wir haben ihn, wir haben ihn!«
Auf der Straße richtet sich Johnny auf. Aus den Saloons stürzen die Leute. Auch Mansfield will aus seinem Saloon auf den Vorbau, als die Schüsse fallen.
»Der hat auf mich geschossen, Freunde!« brüllt Johnny gellend. »Der wollte mich umbringen, der Kerl, an meinem Geburtstag will mich einer umbringen!«
»Wo ist der Kerl, wo steckt er?« brüllt einer von Towers’ Saloon. »Er hat meinen Freund Johnny totschießen wollen, der Lumpenkerl. Wo ist er, ich bringe ihn um, den Schurken! Rache für Johnny!«
Und schon rennt er los. Die Meute stürmt hinter dem schreienden Burschen her, auf das Hoftor zu, hinter dem einer gellend kreischt, als wenn er verprügelt wird.
»Mansfield hat es mir gesagt. Ich habe doch nur getan, was Mansfield wollte. Mansfield wollte, daß ich ihn umbringe. Nicht schlagen! Nicht schlagen! Mansfield hat es doch gewollt, ich schwöre, Mansfield...«
Als die anderen in den Hof stürzen, sehen sie ihn sich aufbäumen und die anderen beiden Männer abschütteln. Die beiden springen ihm nach, aber er ist über den Zaun fort.
Die Meute stürmt auf den Zaun zu, aber da brüllt einer:
»Was wollen wir denn von dem, greifen wir uns Mansfield, der hat ihn losgeschickt. Greift euch Mansfield, Leute, schlagt ihm die Ohren ab, Freunde! Rache für Johnny. Mansfield hat meinen Freund Johnny umbringen lassen wollen!«
»Ja, holen wir uns Mansfield, holen wir den Lumpen!«
Die Schreier brüllen immer weiter. Die Masse macht kehrt und strömt auf Mansfields Saloon zu.
Und vor dem Saloon brüllt irgendwer aus der Masse der herausdrängenden Leute:
»Habt ihr gehört, Freunde! Mansfield hat auf den Spieler schießen lassen, hört ihr es?«
»Mansfield ist ein Mörder. Fangt ihn, zahlt es ihm heim!«
»Der Spieler ist tot! Mansfield hat ihn erschießen lassen!«
Wer das schreit? Sie schreien alle. Und sie rennen alle.
Im Saloon aber ist Mansfield. Er hört sie schreien, wird leichen-
blaß, sieht den ersten in die Tür stürzen.
Da dreht er sich um und rennt weg, rennt nach hinten, bekommt einen Fausthieb in die Seite, torkelt und fliegt auf die Tür zu. Doch da stellt ihm einer ein Bein. Er stürzt der Länge nach hin.
Sie bringen mich um, denkt er, als er auf den Boden prallt, diese betrunkenen Kerle hängen mich auf. Oh, warum hat Smith geredet. Hilfe, sie kommen!
Und da packt ihn eine Hand, reißt ihn hoch und stößt ihn auf die Tür zu.
»Mensch, raus, schnell!«
Er reißt die Tür auf, sieht den Mann mit den dunklen Haaren und schwarzen Augen einen Stuhl nehmen und werfen. Dann macht Lowman einen Satz und packt ihn, dreht den Schlüssel der Tür um und zieht Mansfield mit sich durch den Gang.
»Raus hier, nach hinten, Mansfield!«
Er rennt, Lowman ist neben ihm, schmettert die Tür zu und springt in den Hof.
Das Krachen der Tür ist kaum verklungen, als Mansfield den Schrei hört:
»Er ist in dem Hof. Lauft herum, fangt ihn, holt ihn aus dem Hof!«
Er erstickt beinahe vor Angst, aber Lowman zieht ihn mit sich fort, durch die Pforte hinten in die Gasse hin-
ein.
»Du großer Geist, sie kommen, Mensch!« sagte Lowman zischelnd. »Mansfield, du Narr, die schlagen alles kurz und klein!«
Dort hinten kommen die Schreie. Mansfield keucht vor Furcht und rennt, von Lowman gezogen, auf die Gasse hinauf. Hinter ihnen sind die Stimmen schon im Hof.
»Die Pforte, die Pforte. Da ist er, in der Gasse! Schnell, in die Gasse!«
Er sieht sich um.
»Lauf!« faucht Lowman. »Wirst du wohl laufen! Weg hier, wenn sie dich fangen, dann...«
Zwei, drei Schritte hinten in der Gasse, ein Schrei.
»Dort läuft er – dort hinten. He, versperrt ihnen den Weg! Verlegt ihnen den Weg, da ist noch einer bei ihm, der Kerl, der geschossen hat. Wir haben sie beide! Versperrt die Gassen hinten!«
»Weiter, schnell um die Ecke, Mansfield!«
Sie laufen wie die Hasen, tauchen um die Ecke, hören Schreie auf der Straße, die schon auf ihrer Höhe sind.
»In die Gasse, in die Gasse – lauft! Mansfield ist dort!«
Ein Tor, ein Satz, Lowman reißt ihn hinein und schließt das Tor blitzschnell. Dann rennt er weiter, über einen Hof, schwingt sich über einen Zaun und hilft Mansfield hinüber.
*
Mansfield hört sie in der Gasse, sie kommen nun von zwei Seiten.
»Sie greifen mich, sie greifen mich!«
»Sei ruhig, bist du still! Weiter, hier entlang. Dort vorn werden sie noch nicht sein.«
»Wo sind sie?«
Jemand schreit es, von vorn.
Nun sitzen sie in der Falle, überall sucht man Mansfield.
Der blickt Lowman an, zittert vor Angst.
»Verflixt, Mensch, wohin?« fragt Lowman zischelnd. »Komm, ich weiß schon. Komm mit, vielleicht haben wir Glück.«
Und schon weiter, am Schuppen vorbei, im Hof von Towers’ Saloon.
»Sie fangen mich«, plärrt Mansfield voller Angst. »Hilf mir, ich gebe dir alles, was du willst, aber hilf mir!«
»Mensch, verlier nicht die Nerven, komm hinein.«
»Ich komme nicht mehr hinaus, ich stecke in der Falle.«
»Unsinn, warum werden sie dich ausgerechnet hier suchen?«
Er zerrt ihn mit, hinein in den Flur, schließt die Tür, deutet auf die Treppe und sagt:
»Leise, komm mit hoch in mein Zimmer, ich werde...«
Er preßt sich jäh an die Wand, umklammert Mansfields Handgelenk, als der den Revolver nimmt, und sagt warnend:
»Nicht. Keinen Schuß. Dann finden sie uns erst recht. Wer kommt da?«
Towers stürzt von oben die Treppe herab, sieht sie beide stehen und prallt zurück. Sein dickliches Gesicht erstarrt.
»Was ist los?«
»Nicht schreien, Slade, bitte, nicht schreien«, stammelt Mansfield.
»Slade, versteck mich!«
»Niemals, ich werde sie holen, ich will nicht auch noch hängen. Sie hängen mich gleich dazu, Mansfield.«
»Hilf ihm«, knurrt ihn Lowman an. »Los, geht hoch, in dein Zimmer, da suchen sie ihn niemals.«
»Bin ich wahnsinnig? Mein Hals ist mir lieber und näher als seiner.«
Sie schreien auf der Straße. Die Rufe kommen näher.
»Bitte, Slade, hilf mir doch.«
Towers starrt ihn an und dreht sich um.
»Nun gut, komm, aber wenn sie hier sind, liefere ich dich aus, ich sage es dir.«
Keuchend und nach Luft ringend torkelt er in das Zimmer. Er sinkt auf einen Stuhl und schnellt doch wieder auf die Beine, als sie unten schreien: »Hier muß er irgendwo sein! He, ist er auf der Straße gesehen worden, habt ihr ihn entdeckt?«
»Nein, hier ist er nicht. Er muß hinten zwischen den Häusern in der Gasse stecken. Sucht ihn, einen Strick für Mansfield!«
»Versteckt mich doch!«
»Ruhig!« zischt Lowman. »Geh ans Fenster, Slade. Was machen sie?«
»Sie stehen überall verteilt, ihre Schießeisen in den Händen«, berichtet Towers ächzend vom Fenster aus. »Das mach ich nicht mit. Wenn sie ihn hier finden, dann sprengen sie meinen Saloon in die Luft. Marsch, mach, daß du verschwindest, Mansfield!«
»Ich kann doch nicht. Wenn ich herauskomme, reißen sie mich in Stücke. Oh, mein Gott, versteck mich doch, Slade. Du kannst alles haben, was du willst, aber hilf mir, laß mich nicht in die Hände dieser Meute fallen.«
»Nicht für Geld und gute Worte, Mensch. Ich riskiere meinen Hals nicht für dich.«
»Slade!« bettelt Mansfield. »Fünftausend Dollar, Slade. Versteck mich bei dir!«
»Wo hast du das Geld?« fragt Towers höhnisch. »Wo denn? In der Tasche? Na?«
»Ich gebe es dir, ich schwöre...«
»Du wirst an einem Baum hängen, Mensch! Du hast kein Geld mehr, du hast keinen Saloon mehr, du hast nur noch dein bißchen Leben, mehr nicht, verstehst du? Raus mit dir, ich decke keinen Mörder!«
Er stiert ihn an und bewegt die Lippen.
»Sei doch vernünftig, Engel sind wir alle nicht, Slade«, murmelt Lowman heiser. »Hilf ihm doch!«
»Nein!«
Mansfield steht an der Wand, den Blick flackernd auf Towers gerichtet. Verzweiflung liegt in seinen Augen. Es ist aus, denkt Mansfield, ich habe vielleicht sechzig Dollar in der Tasche. Zum Saloon kann ich nicht zurück. Wer mich sieht, der macht Jagd auf mich. Aus! Wenn ich doch nur Geld hätte!
»Du!« sagt er plötzlich und sieht den dicken Towers an.
»Ich weiß was. Kaufe mir den Sa-loon ab.«
»Was?«
Towers’ Gesicht ist nichts als leer und voller Staunen.
»Kaufe mir den Saloon ab.«
»Bist du verrückt, Mensch? Was soll ich denn mit dem? Nichts da, hinaus mit dir, versuche dein Heil draußen!«
»Nein, nein, ich kann nicht raus, sie bringen mich um. Gib mir zwanzigtausend, er ist vierzigtausend wert, und verstecke mich.«
»Zwanzig, du bist ja wahnsinnig, du bist schon tot und willst feilschen? Raus hier!«
»Nein, fünfzehn!«
»Ich habe sie nicht hier. Und wenn schon, jeder wird wissen, daß ich dir geholfen habe, sie werden sagen, daß ich mit dir unter einer Decke gesteckt habe. Nichts zu machen, ich habe so viel Geld nicht im Haus.«
»Aber zehntausend, hast du die nicht, neun – acht...?«
»Ich habe gerade fünftausend Dollar hier. Das andere Geld liegt auf der Bank.«
»Nur fünftausend?« fragt Mansfield und hört die Leute schreien. »Nur fünftausend! Gut, ich verkaufe ihn dir. Gib mir das Geld.«
»Nein«, sagt Towers und schüttelt den Kopf. »Ich tue es nicht. Ich helfe doch keinem Mörder. Fünftausend ist eine Stange Geld!«
»Gib ihm das Geld, hilf ihm!« zischt Lowman. »Sie können jede Minute hier sein!«
»Und wer glaubt mir, daß ich ihm nicht geholfen habe, wenn ich plötzlich Besitzer seines Saloons bin? Ja, wenn ich ihn für dreißigtausend kaufen würde und schon vor einer Woche oder zwei... Es geht nicht, Lowman!«
»Es geht, es geht. Ich unterschreibe auch, daß ich ihn dir schon vor einem Monat verkauft habe«, sagt Mansfield in seiner Verzweiflung. »Bitte, vor einem Monat. Ich bescheinige dir, daß ich dreißigtausend dafür erhalten habe.«
»Nein, nicht von mir, von meinem Stiefbruder Mortimer!«
»Warum das? Warum nicht du?«
»Ich kann den Saloon für Mortimer führen«, sagt Towers nachdenklich. »Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Nun gut, ich mache es!«
Er setzt sich hin, schreibt, macht den Geldschrank auf und zählt ihm die Tausender hin.
»Da, unterschreibe!« sagt er mürrisch. »Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber ich tue es. Man sollte dich... Gut, fertig, wohin mit dir?«
Er sieht sich um, deutet auf die Tür zum Nebenraum und sperrt sie auf. In seinem Schlafzimmer ist eine Truhe, in die steigt Mansfield, das Geld in der Tasche.
»Ihr müßt mir ein Pferd besorgen, hört ihr? Wenn es ruhig geworden ist, muß ich weg.«
»Ja, ja, du bekommst es schon, Mansfield. Steig hinein, schnell!«
Die Truhe bleibt einen Spalt offen, sie gehen hinaus.
Lowman sieht einmal zum Fenster, tritt an den Vorhang und steht so, daß er auf die Straße blicken kann. Dann nimmt er den Hut ab und macht den Vorhang wieder zu. Unten haben sie ihn gesehen.
»Du Narr«, sagt er danach zischelnd zu Towers, »was sagte ich dir? Trotzdem ist es ein Fehler, wir hätten ihn zum Schweigen bringen sollen, jetzt oder später.«
»Ich mache das nicht mit, Lowman!«
»Du bist ein Narr, Freund Hipo«, erwidert Lowman eisig. »Aber ich halte mich an unsere Verabredung, ihm geschieht nichts. Hoffentlich mußt du es nicht eines Tages bedauern.«
Sie kommen ins Haus, sie rennen unten umher und stürmen dann die Treppe hoch. Es klopft an der Tür, jemand reißt sie auf.
Drei, vier Männer vor der Tür.
»He, habt ihr Mansfield gesehen? Er muß hier irgendwo sein.«
»Was zum Teufel, fällt euch ein?« fragt Towers wütend. »Runter mit euch, hier ist kein Mensch außer mir. Was soll der Unsinn? Schert euch raus!«
Lowman ist nicht mehr da. Lowman sitzt drüben auf der Truhe, den Revolver in der Hand. Er hört sie die Treppe herabpoltern und Mansfield keuchen.
Ein Fehler, denkt der Mann, der ein Leben zuviel besitzt. Es ist ein Fehler, aber ich habe etwas versprochen. Morgen werden wir in den Saloon ziehen. Und in ein paar Wochen räumen unsere Spieler anderen die Tische leer. Mein Saloon, ich habe es gewußt. Nur ein Trick, einige Leute und ein Spielchen. Und schon besitzt man einen Saloon. Ich werde leben wie jeder andere Mann. Niemand wird wissen, daß ich früher im Dreck gesteckt habe. Angesehen und reich werden, und dann weggehen, weit fort!
Weit fort, Lowman, sehr weit!
Er träumt nun, dieser Lowman.
Und er vergißt den einen Fehler.
Der Fehler kostet ihn alles.
Auch das, was er noch hat:
Ein Leben zuviel.
*
Er heißt Ernest P. Kellogg und trägt seinen Stern selten offen. Er sucht Harry Lowman. Ernest Kellog hat zwei Gehilfen bei sich. Er kennt den Mann und weiß, wie gefährlich er ist, daß er zuerst schießt und dann fragt.
Ernest P. Kollegg ist in Salem.
Da kommt eine Meldung, sie ist nur kurz, aber sie erzählt einem Mann wie Kellogg mehr als ein ganzes Buch:
Überfall auf den Store von Williams, Geld geraubt, auch zwei Pferde.
Er ist keine fünfzig Meilen weiter, als er die andere Nachricht bekommt und sein Blick sich verdüstert.
Sam Kellogg, Deputy-Sheriff – erschossen.
Der kleine Vetter, der den großen nachzueifern trachtete. Sam Kellogg hat die beiden Pferde und den Mann verfolgt, allein.
»Armer Bursche«, sagt Ernest Kellogg knirschend. »Das konntest du nicht wissen, ich habe es auch einmal nicht gewußt.«
Er faßt unwillkürlich an seine Seite und kann die Narbe noch fühlen. Kelloggs Mann schießt erst und fragt dann.
Daraufhin sucht der Marshal verbissener als sonst schon weiter. Der Draht summt, der Draht gibt Kelloggs Botschaft durch: Wo sind die beiden Pferde gesehen worden, wo ein Mann?
Ein paar Tage später findet ein gewisser Talbot, von Beruf Frachtwagenfahrer, zwei Pferde, Williams Pferde sind wieder da.
Seine beiden Deputies blicken ihn an, sie sehen nichts als ein düsteres, verkniffenes Gesicht. Und dann sagt der US-Marshal Kellogg:
»Du reitest nach Norden, Jim. Hier ist die Karte, jeder bekommt einen Sektor. Er muß Pferde gekauft haben. Unser Freund kauft nur ein Pferd, das mindestens zweihundert Dollar kostet, die hat nicht jeder Pferdehändler. Er wird jetzt nicht mehr stehlen. Wenn er Geld hat, dann will er kein Low-Man mehr sein, dann kauft er sich eins. Jeder sucht in seinem Sektor, jeder hat drei Tage. Fragt überall und gebt seine Beschreibung jedem Händler.«
Er teilt seine beiden Deputies ein. Dann trennen sie sich.
Er hat neue Pferde gekauft, denkt Kellogg, ich kenne ihn. Aber wann kommt der nächste Schlag, wann ist sein Geld verbraucht? Sobald er keins mehr hat, wird er einen Store oder einen Saloon überfallen. Wo ist der Platz, an dem er auf einen Schlag eine größere Summe erwischen kann?
Er grübelt. Und reitet nach Payetteville.
In der Pferdehandlung erfährt er es, sein Mann hat hier ein Pferd gekauft, zweihundertzwanzig Dollar für ein Pferd, viel Geld! Aber nun hat er sein eigenes Pferd, ein schnelles noch dazu. Sein Mann hat die beiden Pferde nach Oregon zurückgebracht. Ein anderer Kellogg würde nun vermuten, daß der Gesuchte wieder in Oregon steckt, aber nicht Kellogg.
Ein Trick, denkt Kellogg, das ist nichts als ein Trick. Wir werden sehen. Wohin kann er sein?
Nach drei Tagen ist er wieder mit den beiden Deputies unterwegs. Er sucht seinen Mann nun schon genau sechs Wochen, er findet ihn nicht, er muß überall fragen, aber eines Tages trifft er jemanden. Der Mann heißt Mansfield, sie haben ihn erwischt, als er beim Spiel zu betrügen versuchte. Dieser Mansfield erzählt eine seltsame Geschichte, er redet von einem Lowman. Und von einem Saloon, den er einmal besaß und davon, daß ihn jemand hereingelegt haben muß. Er redet, er hat Angst, sagt er, er hat in Lowmans Augen gesehen, als der ihn aus der Truhe steigen ließ und ihm sein eigenes Pferd gab. Lowman hat Mansfield sein in Payetteville gekauftes Pferd gegeben. Und ihn dabei nur angesehen, nichts als das, aber der eine Blick hat genügt.
»Verschwinde, Mansfield«, hat
Lowman beim Abschied gesagt. »Und komm niemals wieder her, sonst...«
Von diesem Tag an reiten drei Männer auf die Minenstadt zu.
Kellogg hört den Lärm aus dem Saloon schallen – Lärm, Geschrei und Musikfetzen.
Jim Doan, einer der Deputies, versteckt seinen Orden und geht in den Saloon. Nach einer Weile folgt ihm der zweite Deputy Amos W. Cullen. Es dauert jedoch nicht lange, dann kommen sie wieder heraus.
»Was ist?« fragt Kellogg, der sich draußen in der Dunkelheit ver-
steckt gehalten hat. »Nun, wo ist
er?«
»Nichts da! Er ist mit diesem Towers nach drüben. In Baker City ist eine Freundin von ihm, ein Tanzhallen-Girl. Sie soll mit einer ganzen Girl-Truppe dort sein, er will wohl versuchen, die Girls für den nächsten Monat herzuholen.«
»Er ist in Oregon!« sagt Kellogg zischend, und seine Lippen pressen sich jäh zusammen. »In Oregon. Es kann nur jenes Mädchen sein, mit der er schon lange befreundet ist. In Ordnung, reiten wir. Diesmal entwischt er mir nicht.«
Diesmal entwischt er ihm nicht, er weiß es.
Aber er wird vorsichtig sein müssen.
Vorsichtig, wie nie im Leben.
*
Morgen, denkt Slade Towers, reiten wir zurück. Und nächste Woche kommen die Girls zu uns.
Er schwitzt, es ist zuviel für ihn. Er hat niemals gedacht, daß jemand im Handumdrehen die Hölle in eine Stadt bringen und in wenigen Wochen soviel verdienen könnte. Lowman kann es.
Lowman ist fort, und Towers allein mit seinen Gedanken. Er lächelt kurz, als er an der Sängerin vorbei muß, die von zwei Ranchern aus der Umgebung an den Tisch gebeten worden ist. Eine kühle Frau, groß, schlank und blond, Lowman, denkt Towers, Lowman hat sie mit Blicken verschlungen. Und dann gesagt: »Eines Tages werde ich auch so eine Frau haben, Towers, du wirst sehen, die schönste Frau für Lowman...«
Er ist verrückt, denkt Towers. Wenn er wütend wird und redet, dann merkt man, daß er aus dem Dreck kommt. Die Herkunft verrät ihn, auch wenn er aussieht wie ein Gentleman.
Er tritt aus der Tür. Die Nacht ist kühl, der Wind weht nur schwach.
Towers geht auf die Straße, hört Schritte hinter sich, als er am Store ist. Hier bleibt er stehen, blickt in den erleuchteten Store und denkt an
Lowman und diesen Williams. Store ausgeraubt – Lowmans Arbeit. Die Schritte sind verstummt. Von rechts kommen zwei Männer langsam angeschlendert. Er blickt immer noch in den erleuchteten Store, als sich die Schritte von rechts und links nähern.
Dann sind die Schritte da, sie halten an.
Es ist dieser Moment, in dem Towers zusammenzuckt und begreift, daß einige Männer ihn in die Mitte genommen haben. Er wendet langsam den Kopf und sieht den ersten Mann, der halblinks steht und die Hand am Revolver hat. Ein großer, kühl blickender Mann mit bereits leicht ergrauten Haaren.
Was wollen sie, fragt sich Towers beklommen. Ich habe doch...
»Hallo, Towers!«
Das kommt von rechts. Die anderen beiden Männer stehen so, daß sie ihn gegen den Saloon verdecken. Und der eine hat nun seinen Revolver gezogen und drückt ihn Towers auf einen Schritt Entfernung in die Seite.
Er schluckt, blickt auf die Weste des Mannes an der ein Orden steckt.
»Was soll das?« fragt Towers heiser. »He, Leute, was wollt ihr?«
»Geh!« sagt der große Mann links von ihm. »Und versuche nicht auszureißen, Towers. Geh jetzt!«
Der Druck der Revolvermündung in seiner Seite wird stärker. Towers wendet den Kopf. Lowman, denkt Towers, und seine Kehle ist wie zugeschnürt, oh, du großer Gott, Lowman!
»Geh schon!«
Er geht, spürt das wilde, unregelmäßige Schlagen des Herzens und hat weiche Knie. Einer links, der andere rechts. Der dritte Mann geht hinter ihm und schiebt ihn vor dem Revolver her, während der Mann von rechts seinen Revolver quer vor dem Gurt und verdeckt durch den Westenflügel hält. Sie verschwinden in der Gasse. Der dritte Mann bleibt zurück und sagt, als die anderen beiden Towers an den Schuppen drücken und einer ihn abtastet:
»Es rührt sich nichts.«
»Leute, das ist ein Irrtum!« bringt Towers mühsam heraus. »Hört doch, Marshal, ich...«
»Schon gut, Towers«, erwidert Kellogg finster. »Wo ist er, wo ist Lowman?«
»Im Saloon«, sagt er keuchend. »Er ist oben, Zimmer elf. Ein Mädchen wohnt dort, Lowman kennt sie. Ich habe damit nichts zu tun, ich kenne ihn nicht gut genug.«
»Gut genug, um Mansfield gemeinsam mit Lowman hereingelegt zu haben, was? Wir kommen gerade aus der Stadt hierher, Freundchen. Nun?«
»Das war Lowmans Plan!«
»Und Du hast ihn mitgemacht. Woher kennst du Lowman, antworte!«
Er schluckt, der Mund ist ganz trocken.
»Aus diesem Staat. Marshal, ich schwöre, ich wollte ihm die Pferde nicht stehlen, aber er sah mich an...«
Er redet, er muß sprechen, wenn er nicht vor lauter Furcht schreien will.
»Also hast du ihm das Geld, das er beim Überfall auf den Store in Salem erbeutete, gestohlen, und seine Tiere gleich dazu, was? In Oregon, also hier. Amos, die Handschellen.«
»Aber, ich habe doch nur...«
»Wer weiß, was du uns da erzählst, Freundchen. Los, die Arme auf den Rücken!«
Einer drückt ihn herum. Das Metall ist kalt, er spürt die Schellen und würgt heftig.
»Marshal, ich sage alles, ich weiß alles von ihm!«
»Du weißt nichts, sonst würdest du ihn nicht am Feuer niedergeschlagen haben, wenn es so gewesen ist. Amos, schaffe ihn zum Jail, aber hinten herum. Komm, Jim, wir wollen sehen, daß wir ihn erwischen.«
Jail, denkt Towers, als Amos W. Cullen ihm den Revolver in den Rücken setzt und ihm einen derben Stoß gibt, mich bringen sie ins Jail, aber Lowman, der riecht es, sie bekommen ihn nicht, sie erleben etwas, aber nicht, daß sie ihn erwischen!
»Geh schon, Towers«, sagt Cullen hinter ihm finster. »Und wehe, wenn du schreist!«
Die anderen beiden sind schon vorn auf der Straße. Marshal Kellogg blickt zu den Fenstern hoch. Dann sind sie auf der anderen Straßenseite.
»Ernest«, murmelt Jim Doan heiser, »und wenn er nun etwas riecht? Sie sagen alle, er hat eine Nase für Gefahr. Hör zu, vielleicht sollten wir warten, bis er herauskommt und ihn dann stellen.«
»Niemals dort anrufen, wo er sich in Deckung bringen kann, Jim«, erwidert Kellogg grimmig. »Er wird sich selbst mit einer Kugel im Leib nicht geschlagen geben. Der ist wie ein Tier, zäh und flink, ein Tier, das flüchtet, selbst wenn es weidwund geschossen ist. Wir müssen in den Saloon und dann nach oben in das Zimmer. Gibt es eine Chance für ihn zu flüchten, dann erlebst du es, daß er mit einem Satz weg ist.
Ob er etwas riecht? Ich weiß es nicht, aber als ich ihm damals begegnete, da hatte ich wie alle anderen das Gefühl, einem Mann gegenüberzustehen, der mehr als nur fünf Sinne hatte. Denke nicht, daß unser Mann schnell ist, er ist es nicht.«
Sie halten an, sie sind nun kurz vor dem Saloon. Während Kellogg vorn geht und die rechte Hand am Revolver hat, hält Doan sich einen halben Schritt hinter dem Marshal. Doan ist Linkshänder, ein Mann, der sehr schnell ist und den Trick beherrscht, aus dem Herumwirbeln zu feuern und mit Sicherheit zu treffen.
»Warum sagt du mir heute erst, daß er nicht schnell ist?« erkundigt sich Doan mißtrauisch. »Meinst du, ich könnte Angst vor ihm haben?«
»Du verstehst mich falsch«, antwortet der Marshal düster. »Jeder anständige Mensch zaudert in der Tat einen Moment, ehe er auf einen anderen feuert. Das fällt kaum einem auf, es ist aber so. Du ziehst, du schießt, zauderst aber etwas, ob es nun die Zeitspanne einer Viertelsekunde oder eine ganze Sekunde ausmacht – du schießt niemals sofort. Das ist bei
Lowman anders. Er zieht und schießt, er kennt dieses Zaudern nicht. Das ist wie bei einem Tier, das ständig auf der Lauer liegt und angreifen will. In Lowman steckt, sobald er gestellt wird, Angriffslust. Die ist ihm wahrscheinlich nicht angeboren, sie ist ihm durch sein Leben anerzogen worden. Also komm, bemühe dich, wenn du schießen mußt, es sofort zu tun. Du bist schneller als er, aber zauderst du, dann erwischt er dich mit tödlicher Sicherheit.«
Er geht weiter. Sie nähern sich nun dem Hof des Saloons, dem Stall, aus dem Lichtschein fällt. Irgend jemand hantiert dort mit Heu. Etwa ein halbes Dutzend Schritte vor der Tür hält Kellogg an und sagt leise: »Das ist vielleicht eine Möglichkeit, an die ich noch nicht gedacht habe. Teufel, so könnte es gehen.«
Er verstummt nachdenklich, und Jim Doan fragt: »Was meinst du, welche Möglichkeit?«
»Nur eine Idee«, gibt Kellogg leise zurück. »Du kennst Lowman nicht, er liebt Tiere mehr als Menschen, und besonders liebt er Pferde. Du wirst es nicht erleben, daß er jemals ein Pferd brutal behandelt. Aber Menschen, mein lieber Mann, mit denen geht er um – nun, rechne es dir aus. Komm mit, schnell!«
Er geht weiter, ohne Jim Doan noch eine Erklärung zu geben, und betritt den Stall.
Der Mann, der in der hinteren Ecke gerade dabei ist, die Pferde mit Heu zu versorgen, dreht sich um. Er ist ein älterer, untersetzter Mann.
»Hallo, mein Freund!« sagt Kellogg freundlich. »Hast du einen Augenblick Zeit?«
Er tritt in den Lichtschein der im Stalleingang hängenden Laterne. Der Mann mustert ihn, zuckt dann leicht zusammen und blickt länger als einige Sekunden auf den Marshalstern an Kelloggs Weste.
»Hallo, Marshal!«
»Ich möchte mir nur die Pferde ansehen«, murmelt Kellogg. »Augenblick, mein Freund, dies hier, wem gehört es?«
Der Stall hat ungefähr ein Dutzend belegter Boxen, vor einer bleibt Kellogg stehen und betrachtet einen hochgebauten kräftigen Braunen.
»Das?«
Der Stallmann kommt näher.
»Das Pferd gehört Mr. Lowman, Marshal!«
»Ich dachte es«, murmelt Kellogg und blickt Jim Doan an. »Betrachte die anderen Pferde, dann wirst du wissen, was ich meinte, als ich vor Tagen über seine Pferdeleidenschaft sprach. Es gibt kein besseres Pferd im Stall. Ich wette, es hat seine fünfhundert Dollar gekostet!«
»Genau geschätzt, Marshal«, meldet sich der Stallhelp hinter ihm. »Mr. Lowman nannte den Preis. Ich soll den Braunen jeden Tag striegeln und ihm immer frisches Wasser geben. Marshal, stimmt etwas nicht mit Mr. Lowman?«
»Kann sein, Freund. Dein Name?«
»Blair – Charles Blair, Marshal.«
»Und du sollst den Braunen besonders pflegen? Nun gut, Blair, hat Lowman sich gestern abend noch das Pferd angesehen oder kümmert er sich nicht darum, ob es richtig versorgt wird?«
»Er kam am späten Abend herunter, Marshal, um es sich anzuse-
hen.«
»Und heute, war er schon hier?«
»Nein, Marshal.«
»Nun gut, Blair, dann hat der Gaul sich am Halfterknoten das Fell aufgescheuert.«
Blair blickt ihn verwirrt an und schüttelt den Kopf.
»Aber er hat sich doch nicht...«
»Er hat sich!« Gibt Kellogg knapp zurück. »Das ist nur eine kleine Stelle, du hast diese Stelle gerade entdeckt und weißt nicht, ob du ein Pflaster auflegen oder die Stelle salben sollst, verstanden?
Du wirst nach oben gehen und
Lowman Bescheid sagen. Ich bin sicher, er kommt in fünf Minuten nach unten.«
Der Mann blickt ihn starr an, leckt sich über die Lippen und sagt dann stockend:
»Marshal, wollen Sie Lowman haben? Und wenn er mich nun in das Zimmer bittet? Ist er oben oder im Saloon?«
»Oben in Zimmer elf! Bei der Merrill, dem Girl. Zu der ist er. Ich denke wenigstens, daß er dort ist. Er hat dir doch gesagt, daß du auf das Pferd besonders achten mußt, wie? Es ist nicht nötig, daß du in das Zimmer der Merrill gehst. Du suchst ihn oben, wohnt er auf dem gleichen Gang?«
Blair nickt, sieht aber unsicher zu Boden.
»Well, dann gehst du zuerst zu seinem Zimmer, du klopfst dort, und wenn keine Antwort kommt, rufst du nach ihm im Flur, in der Nähe des Zimmers, das die Merrill hat. Er wird sich melden. Dann sagst du ihm, daß das Pferd sich am Halfterknoten das Fell aufgescheuert hat und fragst ihn, ob er es sich selbst ansehen will oder ob du es verpflastern sollst. Sage ihm, du wärest nicht ganz sicher, ob es ihm recht sei, wenn du es selber tätest. Du sagst, du hast eine Salbe unten, die sehr gut ist, er möchte sich nicht stören lassen, du schaffst es schon zu seiner Zufriedenheit. Er wird danach keine Ruhe mehr haben. Das Pferd macht ihn unruhiger, als wenn er drei Menschen erschossen hat.«
»Drei Menschen erschossen?« fragt Blair stockheiser. »Marshal, soll das heißen, daß Lowman...«
»Genau das heißt es«, erwidert Kellogg finster. »Keine Angst, Blair, du wirst oben im Flur nicht allein sein, wir sind auch noch da. Öffnet er dir, dann macht er uns die Tür auf.«
Blair schluckt, sieht ihn bestürzt an und sagt leise:
»Mr. Lowman soll getötet haben? Aber er ist freundlich zu mir gewesen und hat mir drei Dollar gegeben, wenn ich auf sein Pferd achte. Drei Menschen soll er...«
»Neun bis heute«, antwortet Kellogg kühl. »Und du brauchst keine Sorge zu haben, daß du der zehnte bist, Blair. Wie kommt man ungesehen und ungehört nach oben?«
Blair runzelt die Stirn, denkt einen Moment nach und sagt dann gepreßt:
»Hinten rechts ist eine Außentreppe, du siehst sie, wenn du um den Küchenbau bist. Für die Gäste wird manchmal das Essen die Treppe hochgebracht. Man kommt am Ende des Ganges in das Geschoß.«
»Und wo ist sein Zimmer?«
»Links von dort aus, am Ende des Ganges zum Hof hin, dort oben, man kann von hier aus das Fenster sehen.«
»Und das der Merrill?«
»Das elfte Zimmer, es liegt rechts der Treppe, etwa zehn Schritte vor dem Aufgang vom Hof her. Marshal, ich habe Familie, das ist...«
»Für dich ungefährlich«, antwortet Kellogg kurz. »Ist die Außentür der Wandtreppe verschlossen?«
»Nein, nie, Marshal.«
»In Ordnung, Blair. Du gehst in fünf Minuten durch die Hintertür nach oben und machst genau das, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts geschehen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, sagt Blair nervös. »Neun Menschen, und er sieht aus wie ein Gentleman.«
Kellog gibt ihm keine Antwort, geht zur Stalltür und blickt hinaus.
»Das erste Fenster links, Marshal.«
Das Fenster ist dunkel, Kellogg blickt hoch und hat einen Moment das Gefühl, daß Lowman hinter dem Fenster in der Dunkelheit stehen und ihn sehen könnte. Er wartet, winkt dann Jim Doan und drückt sich aus dem Stall. Sie erreichen beide die Hintertreppe, gehen vorsichtig hoch und bleiben vor der Tür stehen.
»Zieh die Stiefel aus, Jim!«
Er bückt sich, entledigt sich der Stiefel und wartet, bis auch Doan auf Socken auf dem kleinen Viereck der Plattform bereit ist. Dann öffnet er vorsichtig die Tür. Aus dem Gang fällt matter Lichtschein auf seinen Revolver.
»Jim«, sagt Kellogg flüsternd. »Dielen und ein Läufer in der Mitte. Laß mich vorgehen und komm mir nach, bis ich an der Tür vorbei bin. Du bleibst auf dieser Seite stehen. Tritt aber so weit von der Wand fort, daß du mit einem Satz um die Tür sein kannst, und sie nicht erst umrunden mußt.«
»Ja!« murmelt Doan und schluckt, als er auf die Tür blickt. »Ernest, und wenn er gar nicht kommt?«
»Wir werden sehen, laß mich dann machen, sei nur schnell, wenn du es sein mußt.«
Sie stehen beide in der Nische des Ganges, haben einen großen dunklen Schrank vor sich und tasten sich behutsam über den Läufer und die Dielen in die Schrankecke vor. Nun hält auch Doan seinen Revolver in der Hand. Aus dem Zimmer, vor dessen Tür die beiden Männer nach einigen Sekunden sind, kommt das leise Trällern einer Frau.
Er hat den sechsten Sinn, denkt Kellogg, ich weiß es. Aber vielleicht mit etwas Glück haben wir ihn. Ich kenne ihn, er wird sich Sorgen um das Pferd machen. Dafür würde er jede Frau und jeden Haufen Geld im Stich lassen. Nur langsam. Teufel, die Die-le!
Die Diele knarrt. Und so leise das Knarren ist, Lowman könnte es hören. Kein anderer Mann würde auf ein so leises Geräusch etwas geben, aber Lowman ist kein gewöhnlicher Mann, Lowman ist ein halbes Tier, ausgestattet mit einem Instinkt.
Er schiebt sich weiter, steht dann unmittelbar vor der Tür und zuckt zusammen.
Lowman redet im Zimmer, er lacht nun. Es ist Kellogg, als wenn ihm etwas kalt über den Rücken rieselt, als er dieses Lachen hört. Die Erinnerung kommt wieder.
Damals, vor sieben Jahren, hatten sie ihn fast. Sie wußten, er würde kommen. Einer aus der Bande, die Lowman damals besaß, hatte ihnen einen Wink gegeben, der Bruder des Mädchens, das nun Lowmans Besuch hat.
Lowman hat nie erfahren, daß es Dave Merrill war, er weiß es nicht, daß die Falle bereit war und er in sie hineinlief.
Und dann?
Er sah sich um, als er gerade an Kellogg vorbei war und in die Falle ritt.
Ich werde es nie vergessen, denkt Ernest Kellogg und friert leicht, denn er ist ihm näher als damals. Er ritt vor mir, ich stand hinter den Brettern des Neubaus, einem Stapel, der mir Deckung gab. Plötzlich nimmt er sein Pferd herum, aus dem heiteren Himmel reißt er das Pferd zur Seite, biegt um und kommt auf mich zu. Ich ziehe meinen Revolver, springe vorwärts, will ihm den Weg abschneiden, und er sieht mich, schießt augenblicklich und treibt sein Pferd über die Bretter hinweg. Wie er es geschafft hat, ich weiß es heute noch nicht, aber weg war
er!
*
Kellogg hört die Stimme, die er nie vergessen hat. Die Stimme klingt tief und ruhig.
Eine Tür klappt unten.
Und dann kommt Blair herauf. Die Treppe knarrt, seine Stiefel dröhnen dumpf. Er blickt Kellogg an, Furcht in den Augen. Der Mann hat Angst.
Es schadet nichts, er kann ruhig gepreßt oder unruhig sprechen, denkt Kellogg. Wenn mit dem Pferd etwas ist, dann nimmt ihm Lowman die Unruhe ab.
Blair betritt den Gang und geht nach hinten. Doch er sieht sich zweimal um. Kellogg steht nun dicht neben der Tür an der Schloßseite und wartet.
In diesem Augenblick klopft Blair und sagt laut:
»Mr. Lowman? Mr. Lowman?«
Lowman spricht nicht mehr. Es knarrt einmal im Zimmer, dann schurrt ein Stuhl leise.
»Mr. Lowman!«
Blair klopft nicht mehr, Blair kommt zurück, langsam und ängstlich. Er hat Angst, darum geht er langsam. Es kann sich auch anhören, wenn man nur auf die Tritte achtet, als ob Blair zaudert und nicht weiß, was er tun soll, wo er Lowman zu finden hat.
Blair nähert sich nun der Tür, neben der Kellogg steht. Im Zimmer ist es völlig ruhig geworden. Kellogg hört kein Geräusch mehr.
Blair zögert, tritt dann auf die Tür zu und klopft einmal.
»Miss Merrill? Hallo, Miss Merrill, ich bin es, Blair!«
Eine Sekunde Stille, dann die Stimme der Merrill:
»Blair, der Stallhelp? Was ist, Blair?«
»Miss Merrill, ich suche Mr. Lowman. Sein Pferd hat sich am Halfterknoten das Fell aufgerieben. Ich wollte es nur sagen. Unten habe ich Salbe, ich kann das schon machen, es ist nicht weiter schlimm!«
Wieder still.
Nun überlegt er, denkt Kellogg. Was denkt er jetzt, kommt er?
»Blair, keine Salbe, ich komme selber herunter.«
Kellogg holt tief Atem, kein Argwohn in der Stimme, aber man weiß nie bei Lowman, ob er sich nicht verstellt. »Ist in Ordnung, Mr. Lowman!«
Kellogg winkt Blair zu gehen. Der Mann dreht sich um. Hoffentlich rennt er nicht. Lowman kommt schon.
Die Schritte nähern sich der Tür, schnelle, hastige Schritte. Und dann die Stimme der Merrill:
»Du hast doch gehört, es ist weiter nichts. Mußt du jetzt gehen?«
»Ja, ich will das selbst sehen. Das ist der beste Gaul, den ich jemals gehabt habe. Keine Sorge, ich komme gleich wieder!«
Blair ist die ersten Stufen der Treppe hinab. Er geht nicht zu schnell.
Der Schlüssel dreht sich im Schloß vor Kellogg, der sich umgewandt hat. Kellogg hält den Arm erhoben, in der Hand den Revolver.
Einen blitzschnellen Blick noch zu Doan. Doan ist von der Tür weggetreten.
Die Türklinke wandert nach unten. Lowman kommt. Die Tür wird aufgestoßen.
Lowman tritt auf die Schwelle und macht die Tür weit auf. Seine Hand ist noch am Türgriff, als er den Mann sieht.
Es ist unheimlich, es ist wie damals. Kaum sieht er den Mann, als er auch schon zurückschnellt wie jemand, der sich verbrannt hat.
Kellogg blickt mitten in sein Gesicht, als er sich abstößt. Es ist Kelloggs volle Absicht, Lowman niederzuschlagen, aber Lowman ist einfach zu schnell. Blitzschnell wirft sich der Bandit, der keine Schrecksekunde kennt, zurück und reißt die Tür mit. Und es ist die Tür, die Kellogg, der mit einem Satz auf Lowman zufliegt, behindert. Die Tür schlägt gegen Kelloggs rechte Schulter. Und so kurz der Augenblick auch ist, – er genügt, um den Hieb Kelloggs, der nach Lowman zielt, vorbeigehen zu lassen. Kellogg kommt nicht an Lowman heran, er blickt jedoch in sein Gesicht.
Dieses Gesicht drückt innerhalb einer Sekunde eine derartig mörderische Wildheit aus, daß selbst Kellogg erschrocken ist. Die Augen Lowmans scheinen förmlich zu glühen, der Atem steigt fauchend wie das Zischen einer gereizten Schlange aus Lowmans Nase. Und dann sagt Lowman nur ein Wort, aber in ihm liegt alle Wildheit eines gestellten Mannes:
»Verflucht!«
In derselben Sekunde jedoch handelt auch schon Jim Doan. Seine rechte Hand faßt blitzschnell nach dem Türgriff, dann reißt Doan, sich mit aller Macht nach hinten werfend, auch schon die Tür zu sich.
Durch diesen Ruck, dem Kellogg durch das Abstoßen seines Körpers nachhilft, wird Lowman die Tür aus der Hand gerissen. Lowman läßt die Tür fahren, er wirbelt unheimlich schnell herum und reißt seinen Revolver heraus.
»Doan, Vorsicht!«
Kellogg erkennt die Bewegung, die Lowman mit ungeheurer Schnelligkeit ausführt, bereits im Ansatz. In diesem Augenblick weiß Kellogg, daß er nie wieder so schnell sein muß wie jetzt. Als Lowman zieht, dabei zurückspringt und mit einem Satz nach hinten zwei Schritte Abstand gewinnt, übersieht er nur eins. Es ist sein Fehler, der Fehler eines Mannes, der an nichts anderes denkt als daran, seinen Gegner zu töten.
Lowman hat nicht an den Waschständer gedacht, den ihm Kellogg nun samt Schüssel in die Seite stößt. Die Schüssel prallt auf seine Hand, sie reißt seinen Arm nach hinten.
Und dann ist Kellogg bereits da. Er ist ungeheur schnell und weiß, daß Lowman selbst aus der schlechtesten Situation feuern wird. Auf die Entfernung von einem Schritt hebt Lowman noch den Revolver erneut hoch, will schießen.
Kellogg tritt aus wilder Verzweiflung mit dem linken Fuß zu. Dieser Tritt schleudert Lowmans Revolverhand hoch. Und als Lowman nach hinten ausweicht und gegen den Tisch prallt, schlägt Kellogg seinen Re-
volver auf den Unterarm des Banditen.
Lowman stößt einen schrillen, heiseren Laut aus. Er verliert den Revolver, aber er gibt nicht auf. Sein blitzschneller Sprung kommt. Er stößt sich am Tisch ab, dreht sich seitlich und prallt ehe Kellogg den Arm wegziehen kann, auf Kelloggs rechte Seite. Dabei umklammert er mit der linken Hand, fauchend wie eine Wildkatze, Kelloggs Handgelenk und drückt den Revolver nach unten.
Im nächsten Moment kommt Doan herein und rennt mitten in den Tritt hinein, den der keuchende Lowman an Kelloggs Seite vorbeiführt.
Doan knickt ein. Einen Moment bekommt er keine Luft mehr. Er hört das laute, rasselnde Keuchen von
Lowman, stürzt zu Boden und sieht Lowman den linken Ellbogen herumreißen.
Der Stoß zielt auf Kelloggs Seite, doch Kellogg muß es geahnt haben. Er läßt seinen Revolver fallen. Der Colt poltert zu Boden, Kellogg duckt sich, reißt den rechten Arm hoch und stößt ihn unter die Achsel Lowmans. Dieser Treffer drückt den angreifenden Lowman zurück, er schiebt ihn fort und gibt Kellogg Platz für seine Linke. Mit einem einzigen Hieb trifft Kelloggs Faust den Banditen. Verbissen krümmt sich Lowman zusammen, springt an und läuft genau in den zweiten Hieb des Marshals hinein.
Er sagt irgend etwas, es hört sich an, als wenn er flucht, aber es klingt halb erstickt. Kellogg sieht Lowmans gesenkten Kopf, weicht schnell zur Seite aus und schlägt zum dritten Mal zu. Dann packt er Lowman an der Weste. Er keucht scharf, dreht sich, reißt Lowman herum und schleu-
dert ihn dann aus der Drehung über das Bett. Schreiend weicht das Tanzhallengirl bis an das Fenster zu-
rück.
Kellogg springt auf den vom Bett herabrollenden Lowman zu. Und vielleicht weiß er nur, warum er selbst jetzt noch schnell sein muß. Obwohl Lowman mehrmals getroffen worden ist, obwohl keiner der beiden Männer, die hereingestürmt sind, schießen kann, ohne das Mädchen zu gefährden und obwohl Lowman angeschlagen ist, rollt er vom Bett. Es zeigt sich, daß er tatsächlich die Zähigkeit einer Wildkatze besitzt. Lowman versucht immer noch an eine Waffe zu kommen.
Kellogg springt zu, wirft sich mit seinem ganzen Gewicht auf Lowman und preßt ihn auf den Boden. Verzweifelt versucht Lowman sich hochzustemmen.
Das Mädchen schreit noch immer.
Kellogg kniet auf ihm und keucht laut. Sein Atem geht heftig, als Doan stöhnend und mit schmerzverzerrtem Gesicht die Handschellen aus dem Hosenbund zieht.
In der nächsten Sekunde schnappen die Schellen um die Arme Lowmans, die ihm Kellogg auf den Rücken gezogen hat.
Keuchend richtet sich Kellogg auf, packt nach der Vorhangschnur und reißt sie mit einem Ruck ab.
»Die Beine«, sagt er und das ist der erste Satz, den er außer der Warnung an Doan nach dem Eindringen in das Zimmer spricht. »Die Beine binden, fessel ihm die Beine, Jim, er wird sonst laufen. Binden, schnell! Halten Sie den Mund, Miss Merrill!«
»Ihr Strolche, ihr Menschenjäger...«
Sie legt los in jener Art, die nur Mädchen ihres Milieus beherrschen. Leute kommen angestürzt, blicken auf Kellogg, der die Beinfesseln Lowmans noch einmal nachsieht und bringen durch ihr Erscheinen die Merrill dazu, endlich den Mund zu halten.
Es ist unheimlich, aber kaum sind die Leute vor dem Zimmer, als sich Lowman zu regen beginnt. Er stöhnt nur einmal, dann zucken seine Arme, seine Beine fahren herum. Nun merkt er, daß er gebunden ist und Handschellen trägt.
Lowman liegt jäh still. Dann hebt er den Kopf und sieht Kellogg an. Sein Blick ist voller Haß und düsterer Drohungen, von so unheimlicher Wildheit, daß die Leute an der Tür zurückweichen.
Und dann sagt er – der Mann, der ein Leben zuviel und den sechsten Sinn haben soll, während in seinen schwarzen Augen ein gleißendes Licht auftaucht:
»Ich hätte dich damals doch niederschießen sollen, du Schurke! Hast du mich? Denkst du, daß du mich hast? Eines Tages werde ich frei sein. Eines Tages werde ich dich suchen und finden. Und dann wirst du sterben, Marshal!«
Er hat, obwohl damals nur Mondschein war, Kellogg nach Jahren wiedererkannt. Es ist nicht zu fassen, daß sein Verstand so scharf sein soll, aber er sagt es. Und dann schweigt er, er verfällt in dumpfes, gespenstisches Grübeln.
Eines Tages will er frei sein.
Er will Kellogg umbringen, das hat er gesagt.
Er will frei sein, aber das Jail in Salem ist zu sicher.
Der, denkt Jim Doan, der kommt nicht heraus, dort nie, das ist unmöglich. Sie werden ihn bewachen wie ein wildes Tier. Jetzt entwischt er nie mehr.
Etwas vergißt auch Jim Doan, der Deputy.
Lowman hat etwas – bis zuletzt – das ihm niemand nehmen kann.
Ein Leben zuviel!
*
Er friert wieder wie jeden Morgen, wenn sie zum Zählen draußen im inneren Zuchthaushof antreten müssen. Er friert in der Nacht, dann wacht er auf und glaubt keine Luft mehr zu bekommen. Das Frieren wechselt mit Schweißausbrüchen, bis er endlich nach Stunden der Beklemmung einschläft, nur nie lange genug schlafen kann, denn sie wecken ihn kurz nach fünf Uhr in der Frühe. Mauern, denkt Lowman, Ziegelmauern, eine innen, eine außen. Und vier Türme mit Posten. Ich habe es probiert, ich kann nicht ausbrechen, zu dicke Wände, zu stabile Stäbe und Wachen im Gang. Sie schießen.
»He, schläfst du, Lowman?«
Er trottet und weiß, daß er sterben wird, wenn er noch länger im Jail stecken muß. Es wird keine Krankheit sein, aber auch kein Unfall.
Eines Tages werden sie ihn finden, die Decke in Streifen gerissen und am Fenstergitter einen Knoten. Dort wird er sterben, weil er es nicht mehr ertragen kann. Keine Bäume zu sehen, kaum ein Vogel zu hören, die Sonne scheint nie in seine Nordzelle. Nur am Rand der Mauer, an der Fenstereinfassung, dort liegt im Sommer ein schmaler Streifen Sonne.
Sie gehen vorn. Farrell, ein untersetzter Wärter, den sie »Kneifauge« nennen, hat immer die Spitze und immer die Augen halb geschlossen, als wenn er blinzelt. Hinten ist Girard, ein manchmal Späße duldender Mann, nicht ohne Humor aber ein Wächter, wie die anderen auch. Die wenigen Schritte bis zur nächsten Zelle – sie halten an, die Tür wird aufgeschlossen. Und Towers kommt heraus. Sein Bauch ist nicht mehr da, seine Figur hat alles überflüssige Fett verloren. Sie blicken sich an wie jeden Morgen. Dann tritt Towers vor ihn. Und von hinten kommt das Kommando:
»Weitergehen – bewegt euch schon!«
Er trottet, er ist nicht mehr gefesselt, wie die erste Zeit. Mensch, hat Girard gesagt, du bist unser Kronjuwel, Lowman, verstehst du, Kronjuwel! Höhö, du entwischt uns nicht mehr!
Er hat versucht mitzulachen, aber dabei auf die Gitter gesehen. Und gedacht, daß er ein Vogel sein müßte, wegfliegen können, davonflattern, nie wiederkommen!
Girard ist hinten, vorn schließen die anderen aus der nächsten Zelle sich an. Fünfzehn Schritte bis Farrell, der an der Spitze der Gefangenen geht.
»Lowman, ich will hier raus, hörst du, ich will raus!«
»Meinst du, ich nicht, du Narr?« fragt Lowman zurück. »Ich habe alles angesehen, es geht nicht, nicht von hier aus. Wenn sie uns zur Arbeit schicken würden, aber sie tun es nicht. Man kann nur von draußen türmen, vom Hof aus oder zwischen Innen- und Außenmauer. Jeden Morgen dasselbe, hör endlich auf!«
»Du hast mich reingebracht«, greint Towers leise, »ich will raus hier, Lowman, raus!«
Das sagt er etwas zu laut. Der Mann vor ihm, Smith, der lebenslänglich sitzen muß und bei den Aufsehern kriecht, wo er nur kann, wendet den Kopf.
»Halt die Klappe, Fettkloß!« sagt er, obwohl Towers längst kein Fettkloß mehr ist. »Jeden Morgen jammerst du einem die Ohren voll, Mensch. Ich sag’s Farrell, dann erlebst du was, wenn du nicht endlich dein Maul hältst!«
»Du Radfahrer!« zischt Towers, den das Jail böse gemacht hat. »Ich trete dich gleich, du Kriecher. Die drei Tage Dunkelkammer verdaue ich dann auch noch. Halt du doch dein Maul!«
Ihre derben Schuhe klappern nun auf der Treppe. Es geht in den Hof hinunter – Zählappell. Dort liegt die Werkstatt, in der auch die Waffen der Wachen manchmal repariert werden.
»Du Jammerlappen!« zischt Smith. »Hast du was ausgefressen, dann mußt du auch dafür bezahlen! Hier sitzt keiner, der nichts ausgefressen hat. Du kommst schon mal raus, mit den Füßen voran, hähä. Mit den Füßen voran und liegend.«
»Mensch«, sagt Towers böse. »Dir werd ich – laß uns mal allein sein, dann schlage ich dir die Zähne ein, du Totschläger, du schmutziger!«
»Halt endlich die Klappe«, erwidert Smith grimmig. »Wegen euch sind wir schon dreimal aufgefallen, nur weil ihr dauernd reden müßt. He, Lowman, warum sagst du nichts?«
Lowman sagt nichts, Lowman steht nun wie die anderen still. Der ganze Block ist draußen. Sie stehen vor der Mauer und etwa acht Schritte von der Tür zur Werkstatt entfernt. Lowman hat den Kopf gesenkt, niemand sieht sein Gesicht, und es ist vielleicht gut oder schlecht, daß es niemand sehen kann.
Er hebt den Blick ganz langsam. Weit, sehr weit von ihm nennt einer seinen Namen. Er hört nicht hin.
Lowman denkt und blickt den beiden anderen Wachmännern nach, die aus der Werkstatt gekommen sind. Sie gehen davon, aber der Mechaniker steht noch in der Tür der Werkstatt. Und die Kiste an der Wand.
Im Vorbeigehen hat Lowman die Kiste und die Schrift auf der Kiste gelesen.
Und den Mechaniker reden hören.
»Die Waffen sind wieder in Ordnung, Mr. Crowles. Die Schrotflinte wirft wieder aus, es lag nur am Haken. Ich hab’s probiert, genau wie das Gewehr. Die Schubfeder war gebrochen. Nun ist sie in Ordnung. Alle Patronen werden befördert. Soll ich sie zum Magazin bringen?«
»Stevens kann sie selber holen.«
Das ist die Antwort, und Stevens, einer der Wächter, der eine Leidenschaft für die Jagd hat. Also Stevens’ Gewehre. Patronen werden befördert. Waffen in Ordnung.
Die Kiste, denkt Lowman und schließt die Augen.
In ihr sind ein Gewehr und eine Schrotflinte.
Er atmet, der Mann, der ein Leben zuviel besitzt, holt tief Luft, schrickt zusammen, als ihn Pharland, sein linker Nebenmann, anstößt und sieht hoch.
»Wenden, Mensch, schläfst du?«
Ich hab’ nicht gehört, denkt Lowman, weiß der Teufel, haben sie was gesagt? Was ist, ach so, zählen, an die Mauer stellen, Gesicht zum Hof. Da kommt Girard mit der Liste und dem Bleistift. Da ist Farrell.
Von hinten fangen sie an. Farrell ruft die Namen auf, Girard hakt sie auf der Liste ab.
Er sieht wieder auf die Kiste. Dort steht sie. Keiner beachtet sie. Hat denn niemand außer ihm Augen im Kopf, hat denn keiner die beiden Aufseher sprechen hören, niemand die Antwort des Mechanikers verstanden?
Ein Blick nach links, zwischen Farrell und Girard durch auf die Kiste.
»Towers!«
Er bewegt kaum die Lippen, als er redet.
Wie viele Tage, denkt Lowman, wie oft nach einer Gelegenheit gesucht und doch keine gefunden? Und nun, da steht die Kiste, in ihr sind Waffen. Wer ist so verrückt und läßt so eine Kiste stehen? Leichtsinn muß bestraft werden, was?
»Was ist?«
»Towers, Mensch, die Kiste. Waffen sind da drin.«
Einen Moment ruckt der Kopf von Towers, dann schluckt er so laut, daß es drei Schritte weit zu hören sein muß. »Was??«
»Waffen, ich weiß es. Paß auf, wenn ich losspringe. Siehst du die Kiste?«
»Ja. Mann, bist du sicher?«
»Ganz sicher. Willst du mit? Wir kommen raus, ich sage es dir. Willst du?«
»Teufel, sicher! Wann willst du...«
»Wenn sie am anderen Ende sind. Losrennen, die Kiste hat kein Schloß, siehst du? Dreh den Kopf herum, an der Ecke der Gießerei, siehst du das?«
»Mensch, eine Leiter!«
»Genau das, wir brauchen sie. Nimm du sie, wenn wir die Wachen los sind, verstanden? Stell sie an die Mauer, ich decke dich schon.«
»Mensch, das klappt nicht, die Außenmauer, das Tor!«
»Die Leiter nehmen wir mit. Ruhig jetzt, achte nur auf mich, und tue, was ich sage. Sie kommen, still!«
Er preßt die Lippen zusammen, seine Augen funkeln, sein Atem geht schneller. Es ist nicht wahr, denkt er, zwei Zufälle auf einmal. Ich habe gegrübelt und meinen Kopf zermartert. Und nun dies. Die anderen, was werden sie tun, was werden sie machen?
Jetzt steht Farrell vor ihn.
Er blickt hoch, sieht den Aufseher.
»Was fehlt dir, Lowman? Hast du Fieber, deine Augen glänzen so!«
Er schluckt einmal. Verflixte Sache, ruhiger werden. Der sieht es an den Augen, der Kerl, der sie Auswurf und Parasiten nennt.
»Mir ist was ins Auge geflogen, Mr. Farrell.«
»So? Hast du eben gegrinst, he?«
»Ich habe nicht gegrinst, Mr. Farrell.«
»Das möchte ich dir auch nicht geraten haben, du Dreckskerl.«
Er geht weiter, blickt Towers an. Von Towers wandert sein Blick auf Lowman, der sich endlich in der Gewalt hat und ein unschuldiges Gesicht macht.
»Fehlt dir auch was, Towers?«
»Mir fehlt nichts, Mr. Farrell.«
»Nichts? Ha, habt ihr beide wieder geredet, he?«
»Nein, Mr. Farrell.«
»Man sollte euch auseinanderlegen.«
Damit geht er weiter. Und Lowman blickt ihm kurz nach. Dich werde ich, denkt Lowman, dich werde ich! Nichts als fluchen mit einem, die ganze Zeit hast du uns schikaniert. Du sollst uns nie mehr auseinanderlegen, du nicht mehr!
Sechs Mann weiter sind sie nun.
»Towers, paß auf, wenn sie am drittletzten Mann sind.«
»Verdammt, der Kerl hätte bald was gemerkt, he? Lowman, das schaffen wir nicht!«
»Ich sage dir, wir schaffen es. Laß mich nur machen. Du willst doch raus hier – oder?«
»Natürlich will ich raus, aber die Außenmauer, die Posten, das Tor?«
»Das laß meine Sorge sein. Mit einem Gewehr komme ich auch durch die Hölle.«
»Und wenn sie uns erwischen?«
»Hast du schon wieder Angst? Paß auf, wenn sie den drittletzten Mann aufrufen.«
»Ja.«
Lowman schielt hin. Noch sieben Mann. Noch sechs...
Er blickt nach links. Da steht die Kiste. Acht Schritte – vier Sprünge, fünf? Dann ist er bei ihr. Und dann? Sie hat nur einen Haken, kein Schloß.
»Towers, schnell, paß auf! Greif dir Smith, schleudere ihn von der Mauer weg, so daß er uns deckt, verstanden?«
»Ja, in Ordnung.«
Vier Mann, der dritte von vorn kommt an die Reihe.
Towers dreht sich leicht, spreizt die Finger, sein Herz klopft ihm ganz oben im Hals. Smith an der Jacke packen und herumschleudern!
»Richards!«
Das ist der Name.
Und Lowman sagt zischelnd:
»Los, Towers!«
Towers dreht sich mit einem Ruck das letzte Ende. Er packt zu, fühlt den Stoff von Smiths Jacke unter den Fingern und zieht ihn mit einem wilden Ruck von der Mauer fort. Dann holt er aus, schlägt mit der linken Hand zu und stellt ihm ein Bein. Smith stolpert und fällt hin. Und Towers rennt, sieht vor sich Lowman einen einzigen Satz machen, dann ist Lowman schon an der Kiste und reißt den Deckel auf.
Es geht ungeheuer schnell, so schnell, daß Girard, der die Kiste hält, nicht begreift, was eigentlich geschieht.«
Girard dreht sich um, als der schwache, erschrockene Ruf von Smith kommt.
Was ist los, denkt Girard, was haben die denn, was ist?
Farrell neben ihm macht einen Schritt.
Und dann sieht er Lowman.
Und Lowman hat ein Gewehr.
Girard blickt auf das Gewehr, auf die Hände Lowmans, die blitzschnell den Unterbügel nach vorn reißen und wieder nach hinten klappen.
Farrell greift zur Hüfte. Zur Hölle, der nichtsnutzige Kerl, was will er denn mit dem Gewehr, das ist doch gar nicht geladen?
Er hat den Revolver in der Hand, will die Waffe aus dem Lederfutteral ziehen und blickt auf das Gewehr.
Lowman reißt das Gewehr hoch und schießt.
Feuer, denkt Farrell noch, Feuer. Es ist doch geladen.
Dann denkt er nichts mehr. Er taumelt fort. Girard aber steht, die Listen in der linken Hand, den Stift in der rechten.
Der Schuß brüllt zwischen den Mauern wie ein Kanonenschuß los. Er hört Farrell einen seltsamen Laut ausstoßen, dreht sich halb und sieht noch aus den Augenwinkeln, daß ein zweites Gewehr durch die Luft fliegt und Towers es auffängt. Es ist still nach diesem einen Schuß, totenstill. Doch plötzlich stürzt Smith los, rennt auf Towers zu und schreit mit übergeschnappter Stimme:
»Seid ihr verrückt, ihr kommt nicht lebendig hinaus, ihr kommt niemals...«
Towers sieht ihm entgegen, hält die Schrotflinte, deren Läufe halb abgesägt sind, in der Hand und wirbelt sie dann herum.
»Da«, sagt Towers und trifft Smith, der die Hände ausstreckt, um ihn die Waffe zu entreißen. »Da hast du was, du Kriecher! Da!«
Smith fällt zu Boden, Towers läuft, ist aber nicht so unheimlich schnell wie Lowman. Links an ihm vorbei rennt Lowman, blickt einen Moment in Girards verstörtes, kreidebleiches Gesicht und dreht das Gewehr herum. Girard torkelt zur Seite, seine Liste fällt auf den Boden, der Stift rollt davon.
»Die Leiter, Towers, schnell!«
Er dreht sich um, sieht den Mann, der aus der Werkstatt kommen will, über das Gewehr hinweg an und hört den Schrei der Angst, mit dem der Mann wieder verschwindet. Dann wendet er sich weiter, der Gewehrlauf streicht über den Block hinweg, richtet sich auf die Tür des Blockes. Kommt denn keiner, will sie niemand mehr aufhalten?
»Lowman, komm!«
Er hört das dumpfe Poltern, mit dem die Leiter gegen die Mauer prallt und wirbelt herum. Mit sechs, sieben langen Sätzen ist er an der Leiter, sieht die Gesichter der anderen – verstörte, törichte Gesichter, in denen kein Begreifen ist. Und er klettert schon die Leiter hoch. Er ist oben, als die anderen zu schreien beginnen. Die Sträflinge begrüßen den Ausbruchsversuch mit einem Geheul, mit Pfiffen und Gebrüll, das eine halbe Meile weit zu hören sein muß.
Lowman ist nun an der Mauerkrone. Hinter ihm steht Towers. Lowman hat ein Gewehr und blickt nach drüben.
Drüben steht einer der Wachen. Er ist vielleicht vierzig Yards entfernt und blickt zu Lowman hoch, der auf der Mauerkrone in der Hocke kauert. Der Mann rührt sich nicht, er starrt Lowman an, als wenn er einen Geist sieht.
»Komm nach, spring runter!«
Lowman springt. Und erst, als er sich am Boden wieder aufrafft, bewegt sich der Wachmann in der Nordwestecke. Er zieht seine Waffe, stößt einen Schrei aus und läuft mit gezogener Waffe auf Lowman zu.
Der schreit, denkt Lowman und hebt das Gewehr blitzschnell an, der schreit!
Das Gewehr brüllt, der Mann knickt ein, stürzt hin, sein Revolver bleibt vor ihm liegen. Lowman aber fährt herum, rennt dicht an der Mauer entlang und sieht oben auf der äußeren Mauer einen Posten auftauchen. Er sieht ihn kaum, als er stehenbleibt.
»Lowman, wir kommen nicht raus, wir kommen nicht raus«, schreit Towers heiser.
»Du Narr, weiter, auf das Tor zu! Komm schnell, weiter!«
Er läuft. Am Tor ist Bewegung, jemand rennt dort. Auf der Mauer aber, keine dreißig Yards vor ihm, taucht der nächste Posten auf.
Aus vollem Lauf schießt Lowman einmal, hört den Mann schreien und sieht ihn stürzen. Dann liegt der Wachposten unten an der Mauer, bewegt sich, sieht Lowmans eiskaltes Gesicht, seine brennenden Augen und stirbt fast vor Furcht, als Lowman auf ihn zukommt.
»Towers, bleib hinter mir!«
Er stürzt sich auf den Posten, packt ihn und zieht ihn hoch. Dann hält er ihn vor sich.
»Jetzt gehen wir«, sagt er zischelnd. »Und du kommst mit. Los, weiter!«
Er faßt ihn, kommt auf das Tor zu und sieht dort zwei andere Posten. Nun bleibt er stehen, als sie entsetzt auf den Mann sehen, den er als Schild vor sich herschiebt, den er zwar halten muß, der aber tot sein wird, wenn sie nicht das Tor räumen.
»Weg da!« sagt Lowman und der wilde, böse Ton seiner Stimme läßt die beiden Posten erstarren. »Weg mit euch, sonst stirbt er! Aus dem Weg, ihr Burschen!«
Der Teufel kommt, vielleicht denken sie das, als sie zur Seite weichen und die Hände hochnehmen. Er sieht sie nur einmal an, dann schickt er Towers hinter seinen Rücken an das Tor und läßt es von ihm aufschließen. Rückwärts gehend zieht er sich durch das offene Tor zurück.
Die Bäume kommen, im Tor erscheint vorsichtig ein Kopf.
Er aber hat seine Geisel. Sie werden es nicht wagen, ihm nachzukommen, solange er den Mann hat. Hinter ihm keucht Towers, rennt auf die Bäume zu und ist nun zwischen ihnen.
Lowman blickt auf die Mauern. Sie haben ihn dort eingesperrt gehalten wie ein wildes Tier. Und nun ist er aus dem Käfig ausgebrochen.
Sie werden ihn nie wieder fangen, nie mehr!
Er weiß es, als er an den Bäumen ist.
Das Unmögliche ist wahr geworden.
Lowman ist frei wie ein Vogel.
Er kann fliegen.
Auch ein Vogel hat nur ein Leben.
Und keins zuviel!
*
Ich habe keinen umgebracht, denkt Towers, ich nicht. Ich halte es nicht mehr aus, es ist zuviel für mich. Hunger, oh, mein Gott, ich habe nie gewußt, daß ein Mensch solchen Hunger haben kann, niemals!
Er hat nur Sauerampfer und etwas Gras gegessen. Und der Hunger läßt seinen Magen knurren, daß er es hören kann. Seine Kleidung ist schäbig, an einigen Stellen von den Dornenbüschen zerfetzt, und stinkt schon faulig, sie ist klamm, der Nachttau hängt zwischen den Farnen des Waldes.
Wie oft, denkt Towers und fühlt, wie ihm die Tränen kommen, habe ich gehungert, wie oft sind wir durchgekommen, und wie oft bin ich bis auf die Haut naß gewesen? Durch Bäche waten, durch Felder kriechen, das Korn von den Halmen abstreifen, kauen und denken, daß man Brot ißt, ein Stück Brot!
Brot muß schön sein, nur eine einzige Scheibe, eine kleine Scheibe nur.
Er stöhnt leise.
»Was ist, Towers?«
»Ich habe Hunger, Lowman!«
Er kann ihn kaum sehen, Lowman liegt am Baumstamm und hebt den Kopf ein wenig.
»Denkst du, ich habe keinen, Mann?«
»Laß uns doch aus dem Wald schleichen, in der Nähe soll eine Farm sein!«
»Nicht heute, morgen bei Tag erst die Gegend ansehen und aufpassen. Sie suchen uns überall, Towers. Schlaf jetzt, ich will meine Ruhe haben, verstehst du?«
»Ja, ja, ich sage ja nichts, Lowman!«
Da hinten, denkt Towers, schlafen Leute in einem Haus, in einem Bett. Sie haben zu Abend gegessen, vielleicht Bratkartoffeln und feingeschnittenen Schinken mit Ei.
Irgendwo im Wald knackt etwas. Ein Tier? Er lauscht und hält den Atem an.
»Das war nur ein Tannenzapfen, der heruntergefallen ist«, sagt da
Lowman. »Du sollst schlafen, Towers, du lernst es nie, nie Geräusche des Waldes zu unterscheiden. Schlaf jetzt, Mensch, morgen gehen wir auf eine Farm.«
»Ja, Lowman!«
Er liegt auf dem Arm und wischt sich mit der Hand über das Gesicht.
Übermorgen, denkt er, ist es einen Monat her, daß wir ausgebrochen sind. Wir haben zwei Deputies, die uns suchten und auf einem leichten Wagen die Wege patrouillierten, einfach angehalten und ihnen die Waffen und den Wagen weggenommen. Dann wünschten wir ihnen einen guten Tag und fuhren davon. Mit fünfzig Mann haben sie uns gejagt, aber nicht gefunden. Bei einem Farmer haben wir einige Tage darauf gegessen und Pferde gestohlen. Dann haben wir einen Flußfischer gezwungen, uns über den Columbia zu rudern. Ich weiß nicht mehr, was sie alles getan haben, um uns zu erwischen. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir überall gewesen sind. Nur eins werde ich nicht vergessen: Die Bluthunde, mit denen sie uns gejagt haben. Und wir im Sumpf bis an den Hals, die Mücken – greuliche Plage. Aber gegessen haben wir wenigstens ab und zu etwas.
Schon seit Tagen haben wir jetzt nichts gehabt.
Er schluckt wieder. Dort droben soll eine Farm sein, in der Nähe gibt es Fischräuchereien. Er schluckt dauernd; je mehr er an Essen denkt, desto schlimmer wird es. Sie werden nun im Bett liegen, es würde ganz leicht sein, in ein Farmhaus einzudringen und die Leute um Essen zu bitten, wie schon so oft. Doch nur etwas essen, mehr nicht, einen Bissen zwischen den Zähnen, eine warme Suppe und nicht leben wie ein Tier. Der da, der ist ein Tier, der ißt Wurzeln und rohe Fische, dem macht es nicht viel aus. Schläft er?
Ach, ich sollte mich stellen, im Jail gibt es eine Pritsche. Und warmes Essen, eine Decke und trockenes Lager. Ich sollte mich stellen!
Er denkt schon eine Woche daran, aber nur, wenn Lowman fest schläft. Sonst errät Lowman seine Gedanken, der kann Gedanken lesen!
Er, Towers, hat ja keinen umgebracht. Er hat nur Hunger, er will nicht leben wie ein Tier.
Lowman schläft. Towers denkt nach, dann streckt er sich, es raschelt leise unter ihm. Wacht er auf, wird Lowman munter?
Doch Lowman schnarcht weiter. Towers stemmt sich hoch, er kniet nun.
Er hat doch nur Hunger. Es wird im Jail besser sein, einmal müssen sie ihn herauslassen, aber bis dahin gibt es regelmäßig etwas zu essen!
Towers kriecht zwei Schritte, lauscht, kommt auf einen Baum zu. Schnarcht Lowman noch?
Er schnarcht, der schläft. Und er kriecht, duckt sich unter Farnen durch, ist am Baum, sieben, acht Schritte entfernt. Mondschein fällt durch die Bäume, eine Lichtung, neben der sie ihr Lager für die Nacht gemacht haben. Er erreicht die Lichtung.
»Towers!«
Die Stimme ist elf, zwölf Schritte hinter ihm.
»Towers, he?«
Nichts sagen, nur wegkriechen, über die Lichtung, fort von ihm. Der hält es monatelang aus, dieses Wald-ungeheuer, das von allem lebt, was Tiere auch essen können.
»Towers, wo steckst du? He, Towers, melde dich! Verdammter Kerl, wo bist du?«
Es knackt, es raschelt. Towers kriecht schneller, ist über die Lichtung und richtet sich drüben auf. Er huscht weiter und hört nichts mehr.
Ich will hier heraus, denkt er verzweifelt. Er schleppt mich immer weiter mit. Das halte ich nicht durch, ich sterbe, ich will aber nicht sterben, ich nicht!
Es knackt links von ihm. Er zieht sich zurück, geht rückwärts, greift an die Hüfte und zieht den Revolver heraus. Ich schieße ihn tot, denkt er, wenn er mich wieder mitschleppen will. Was hat in der Zeitung gestanden, die wir bei der Farm, auf der wir zuletzt waren, gelesen haben? Fünftausen Dollar für ihn, ganz gleich, wer ihn bringt? Straffreiheit für mich, wenn ich ihn erwische, ja, wenn... Aber sie wissen ganz genau, daß ich nichts gegen ihn machen kann. Aber Straffreiheit? Ich will hier weg, ich halte das nicht durch!
Er kauert hinter einem Baum, blickt starr nach links. Da bewegt sich etwas. Es knackt, dann ist der Schatten fort. Oder hat er sich geirrt? Das Knacken ist doch rechts!
Towers nimmt den Revolver hoch, wendet sich nach rechts und sieht den Mann zwischen den Bäumen. Er steht drüben, zwölf Schritt entfernt!
Der Revolver liegt am Baum, Towers zielt. Er will nicht sterben, er will frei sein, straffrei.
Jemand seufzt schwer, dann poltert es. Towers sieht den Schatten nicht, er ist fort. Getroffen. Oder nicht?
Wenn es hell wird, denkt Towers, sehe ich nach, nicht jetzt, nein.
Er schleicht zurück, ein Ast knackt unter seinen Stiefeln. Totenstille danach, er steht gedeckt hinter dem Baum. Nichts rührt sich, kein Laut ertönt. Und Towers schleicht weiter.
»Towers!«
Er stößt einen Schrei aus und wirft sich herum.
Zwischen den Bäumen brüllt es zweimal, das Echo rollt durch den Wald.
Er sitzt an einer Tafel voller Speisen, sein Teller ist noch leer. Dann nimmt er einen Löffel und will sich Kartoffeln auf den Teller füllen, aber jemand greift schneller als er zum Löffel. Er sieht hoch und in Lowmans Gesicht!
»Er hatte auch die Zeitung gelesen«, sagt Lowman heiser und wischt sich über das Kinn. »So hatte er sich das also gedacht, der Verräter. Nun gut, gedacht und mehr nicht.«
Es ist still im Wald. Schritte gehen fort.
Nun ist er allein, ein Wolf in einem tiefen Wald.
Sie werden ihn nie fangen – niemals!
Niemals?
*
Er kommt aus dem Tal, ein Mann, der heruntergekommen ist und dessen Wangen eingefallen sind.
Nahe beim Haus arbeiten zwei Männer an einem Stall und sehen ihm entgegen.
»Hallo«, sagt Lowman matt. »Leute, vielleicht habt ihr ein Essen für mich? Ich arbeite auch, ich helfe euch beim Stallbau.«
Sie blicken ihn an und erkennen ihn nicht. Die Zeit hat ihn verändert, er wirkt krank und müde. Er bekommt sein Essen und weiß nicht, daß man ihn einen Tag vorher gesehen hat, als er über ein Feld schlich und Ähren abriß.
Salem ist nicht weit genug. Und in Salem ist Ernest P. Kollegg. Als die Nachricht nach Salem kommt, holen sie Kellogg, obwohl er nicht mehr Marshal ist, schon seit einem halben Jahr nicht mehr.
»Ernest«, sagt Dave Lant, Marshal-Deputy, bitter zu ihm. »Du hast ihn einmal erwischt, komm mit. Er soll im Lincoln County gesehen worden sein. Vielleicht haben wir Glück.«
»Glück?« fragt Kellogg. »Ein ganzer Staat jagt einen Mann, man sieht ihn und bekommt ihn doch nie. Vier Mann hat er während dieser Jagd umgebracht. Und Gott allein mag wissen, wie viele er noch umbringen wird. Meine Ernte...«
»Sie warten alle auf dich, Ernest. Du hast zwar gesagt, du würdest nie wieder einen Stern nehmen. Aber komm wenigstens mit, du allein kannst es schaffen. Gut, du hast nun die Farm deines Vaters übernommen, du hast Clivia Morgan geheiratet, und deine Frau erwartet ein Baby, aber das Land braucht dich, Ernest!«
Er blickt seine Frau an und weiß, daß sie nun an Baker City denkt, an die Nacht, in der sie Lowman sagen hörte:
»Eines Tages bin ich frei. Eines Tages bringe ich dich um, du Schurke!«
»Ernest!«
»Ja«, sagt er spröde, »ich weiß, aber ich glaube nicht daran. Ich komme schon wieder, keine Sorge!«
Es fällt ihm nicht leicht, sein Pferd zu holen, aber er denkt an die anderen, die mit dem Stern an der Weste Lowman fangen wollten und nichts erhielten als eine Kugel.
Sie reiten zum Lincoln County – sechzig Meilen weit. Vielleicht hat sich der Mann, der Lowman gesehen haben will, geirrt, denkt Kellogg. Man will ihn schon so oft gesehen haben, und oft genug ist es nichts als blinder Alarm gewesen.
Gegen Mittag des nächsten Tages werden sie dort sein und suchen, aber ob sie ihn finden werden? Sicher ist er längst wieder fort.
*
Morgen, denkt Lowman, gehe ich weiter oder übermorgen. Ich bin zu schwach, ich kann nicht schnell genug laufen. Wenn ich ein Pferd hätte, käme ich schneller davon. Den Leuten hier eins nehmen? Dann habe ich sie wieder auf dem Hals, hier eine Posse und dort eine, sie werden mich jagen, aber sie bekommen mich nicht.
Lowman hustet.
»Hol noch zwei kürzere, Rowe«, sagt einer der Männer. »Da oben der Spitzwinkel muß verschalt werden.«
»Ja«, sagt er, dreht sich um und sieht zum Bach.
Und dann sagt er nichts mehr.
Reiter tauchen auf, als wenn die Büsche sie ausspucken. Drei, vier – in den Händen Gewehre.
Lowman wirbelt herum, greift jäh unter die Jacke und sieht die beiden Männer erstarren. Eine Posse, die genau aus der im Südwesten stehenden Sonne auf ihn zureitet, keine hundert Yards entfernt.
Der Mann, denkt Lowman, als er den großen Burschen auf dem zweiten Pferd erkennt, der nun einen heiseren Ruf ausstößt, er ist es, Kellogg. Verdammte Geschichte, weg!
Den Revolver in der Faust, dreht er sich um, springt auf das Loch in der Giebelwand des Stalles zu und hört den Krach hinter sich.
Im nächsten Moment trifft die Kugel sein linkes Bein. Der Schmerz ist kurz, aber das Bein knickt weg. Er stürzt auf Sägemehl und abgesägte Brettstücke. Das Bein hoch, er muß laufen, laufen, schnell weg, sonst haben sie ihn.
Lowman kommt hoch, torkelt gegen den Sägebock und humpelt auf die andere Giebelseite zu. Da ist die Türöffnung, hinaus und über den Hof. Zu spät denkt er, ich schaffe es nicht mehr, zum Corral zu kommen. Vorbei am Haus, nur schnell, sie haben den Stall vor sich, sie können mich nicht sehen.
Die Frau blickt aus dem Fenster, ihr erschrockenes Gesicht blickt ihn an.
»Mr. Rowe!«
Sie sieht den Revolver, das Blut an seiner Hose und sein starres, eiskaltes Gesicht. Nur sein unbändig harter Wille hält ihn aufrecht. Er läuft humpelnd weiter, am Haus vorbei, am Schuppen entlang. Hufschlag kommt näher. Er hört Kellogg schreien, daß sie nicht zu nahe heran sollen.
»Er steckt im Stall! Vorsicht, er schießt sofort, bleibt zurück, nicht näher heran! Lowman – he, Lowman, komm hraus! Leute, weg vom Stall,
er schießt auch auf euch, schnell
weg!«
Lowman läuft um sein Leben. Hundert Yards vor ihm das Weizenfeld. Und sie denken, daß er im Stall steckt. Sollen sie es denken, sie bekommen ihn nicht! Siebzig Schritte noch – fünfzig – dreißig. Hufschlag rechts und der scharfe, gellende Ruf eines Mannes:
»Da, er läuft auf das Feld zu, dort ist er!«
Lowman blickt sich um. Der Mann sitzt auf seinem Pferd, reißt das Gewehr hoch und schießt.
Zu weit, Lowman weiß es. Die Kugel geht vorbei, die zweite schlägt links vor ihm ein. Er stürzt humpelnd auf die goldgelben Halme zu und in sie hinein.
Das Korn rauscht, das Korn steht hoch auf dem Halm.
»Umstellt das Feld, aber nicht näher als sechzig Schritte heran. Vorsicht, geht nicht näher, er schießt!«
»Ich schieße!« sagt Lowman und kriecht durch das Korn. »Ja, ich werde schießen, wenn ihr kommt. Jetzt holt mich, versucht es nur!«
Das Bein schmerzt, Nesseln stechen durch seine dünne Hose. Er bemüht sich, langsam und vorsichtig zu kriechen, um sich nicht durch das Schwanken der Halme zu verraten.
Hufschlag nun überall, links und rechts, Rufe, Männerstimmen vor dem Feld, rechts von ihm. Er versucht sie zu zählen. Bei zwanzig Mann hört er auf, weil es zu viele sind. Sie werden das Feld umstellen. Rechts ist ein freier Acker, links nur Wiese, zu den anderen beiden Seiten auch.
Ich komme nicht heraus, ohne daß sie mich sehen, denkt er. Wenn sie zum Abend Feuer anzünden und ziehen sich weit genug zurück, dann sehen sie jede Maus, erst recht mich. Und wenn sie nun das Feld anstecken?
Er muß ungefähr die Mitte des Feldes erreicht haben. Hier bleibt er liegen, reißt sich einige Fetzen vom Hemd ab und verbindet sich notdürftig das Bein. Er wird nicht weit damit kommen, die Wunde ist schlimm, laufen kann er nicht. Und an Pferde kommt er nicht heran. Solange er laufen konnte, hatte er keine Furcht. Aber nun?
Es brennt und sticht. Jeder Pulsschlag läßt einen kleinen Stich durch das Bein laufen.
In zwei Stunden wird es dunkel sein. Bei Nacht versuchen herauszukriechen? Ja, warten, bis die Nacht kommt. Vielleicht gelingt es ihm, an eins der Pferde des Aufgebotes heranzuschleichen.
Warten auf die Nacht.
Und dann?
*
Sechsmal ist er gekrochen, sechsmal, wie ein Fuchs, der die Jäger um seinen Bau lauern wußte. Bis an den Rand des Feldes ist er gekommen. Feuer hier und da. Und überall Männer. Weit hinten am Stall hat er die Schatten der Pferde erkennen können und wieder Männer.
Sie kommen nicht, denkt er, sie warten, bis mich der Hunger und der Durst heraustreiben. Dann werden sie schießen, denn sie sehen mich früh genug.
Er richtet sich langsam auf, knickt ein und kann nur mit Mühe auf den Beinen bleiben. Die Feuer, sie haben es warm. An den Halmen hängt der Tau. Und die Wunde schmerzt schlimmer. Fieber, er wird Fieber bekommen.
Lowman kann nicht lange stehen, er setzt sich hin und weiß, daß die Nacht bald vorbei sein wird. Der Revolver liegt in seinem Schoß, ein mattes Stück Metall, glatt der Lauf. Er friert nun ein wenig, legt sich hin, rollt sich zusammen und ist müde. Das Bein sticht heftig, der Husten quält ihn. Er weiß, sie werden ihn vielleicht husten hören können, aber er weiß auch, daß sie niemals an ihn herankommen werden, weil ihre Angst zu groß ist – oder dieser Kellogg ist ein zu vorsichtiger Man.
Kellogg, denkt er, lange her. Baker City, die Girls, die Minenstadt, alles, was vorher war, wann hatte ich einmal eine schöne Zeit?
Er versucht sich zu erinnern, aber er findet die Zeit nicht, in der es ihm gutgegangen ist.
Er denkt nach, hustet wieder und ist so müde.
Er muß nachdenken, warum alles so gekommen ist, und macht die Augen zu.
Im Weizenfeld liegt ein Mann.
Andere warten vor dem Feld auf
ihn.
Ein Vogel weckt ihn, er singt sein Morgenlied. Der Tag kommt.
Er fährt hoch, sitzt und lauscht.
Der Vogel singt genau über ihm.
Ein zweiter meldet sich.
Rumms!
Die Vögel steigen erschreckt hoch bei dem Schuß auf Lowman.
Kellogg hat Lowman erwischt.
Die Sonne sieht sie, sie blickt auf jeden.
Und auf Ernest Kellogg, der nach Hause reitet.
Dort wartet jemand auf ihn.
Was aber wartet auf Lowman, den sie nach Salem bringen werden?
Niemand weiß es. Wie nie jemand genau gewußt hat, warum er das wurde, was er war und was man ihm andichtete: Ein Mann, der mehr besaß als andere...
Ein Leben zuviel!