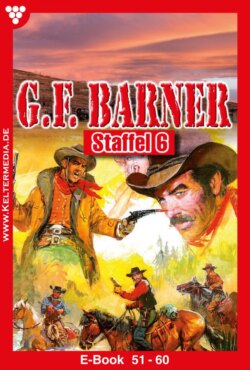Читать книгу G.F. Barner Staffel 6 – Western - G.F. Barner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеOld Nats Gesicht ist aschfahl geworden, seine Augen scheinen zu glühen. Dann richtet er sich langsam auf.
»Du – du weigerst dich, das zu tun, was dir dein Vater sagt?« fragt er mit vibrierender Stimme. »Du zerbrichst meine Peitsche und wirfst sie mir… Mensch, ich schlage dich zusammen, du Teufelsbraten.«
Als er die Fäuste hebt, sieht ihn sein Sohn Ray groß und furchtlos an.
»Ich würd’s nicht versuchen«, sagt er gepreßt. »Dad, ich warne dich: treibe es nicht zu weit! Schlägst du mich, werde ich mich wehren. Ich bin kein Hund, den du verprügeln kannst. Versuche es lieber nicht.«
»Was – was?«
Es sieht aus, als wolle der alte Thayer umfallen. Er taumelt tatsächlich zwei Schritte auf Ray zu, bleibt dann aber stehen und sieht seinen Sohn seltsam an.
»Du willst die Hand gegen deinen Vater heben?« fragt er lauernd und ganz leise. »So, du willst es tun? Weißt du, was du bist?«
»Kein Hund, den man treten kann, das weiß ich«, antwortet Ray gallig. »Ich bin kein Sklave, Dad.«
»Du bist nicht mehr mein Sohn«, sagt der Alte voller Enttäuschung. »Geh, Ray, geh von meinem Land! Und komme nie wieder, solange ich lebe. Geh fort und denke immer daran, wenn es dir schlechtgeht: du hast es gewagt, gegen deinen Vater die Hand zu heben. Geh, oder ich bringe dich eigenhändig um, du Schurke, der seinen Vater nicht ehrt. Nimm dein Pferd, nimm deine Sachen und verschwinde für immer!«
Rays Gesicht scheint sich zu versteinern.
»Ja, ist gut«, sagt er dumpf. »Ich hoffe, du bedauerst es nie, deine Söhne so schändlich behandelt zu haben. – Tut mir leid, Cliff, ich gehe jetzt.«
»Ray!« stößt der kleine Cliff voller Entsetzen hervor. »Geh nicht! Er überlegt es sich noch, er kann dich doch nicht wegjagen, nur weil er…«
»Schweig!« brüllt der Alte da und wirbelt herum. »Du kannst gleich mit ihm verschwinden, wenn du zu ihm halten willst. Ich brauche niemanden. Ich habe mein ganzes Leben nie andere gebraucht, am wenigsten meine Söhne. Verschwinde, Ray, und komme nie wieder! Sonst, das schwöre ich dir, werde ich dich umbringen. Ich – ich verachte dich.«
Ray dreht sich um, geht schwerfällig zu seinem Pferd. Wenn der Alte etwas sagt, dann nimmt er es nie zurück, das weiß er nur zu genau. Langsam zieht sich Ray in den Sattel, sieht Cliff an.
Der ist leichenblaß und macht einen völlig verstörten Eindruck.
»Cliff, ich schreibe dir«, verspricht Ray. »Mach dir keine Sorgen um mich, Bruder, ich komme überall zurecht. Zwei Hände habe ich ja. So long, Dad!«
Der Alte gibt ihm keine Antwort, wendet ihm den Rücken zu, als das Pferd schnaubt, angeht und davonprescht.
*
Hundertmal ist er den Weg geritten, aber jetzt reitet er ihn zum letztenmal, das weiß Ray Thayer genau. Vor ihm liegt die Senke am Nueces River. Dann kommt die Brücke. Sie liegt auf dem Land des alten Jim Vance. Man kann den Weg abschneiden, wenn man über die Brücke reitet. Old Nat Thayer hat sich nie darum geschert, ob er sich einige hundert Yards weit auf dem Gebiet des alten Jim Vance befand.
Die Feindschaft zwischen ihnen ist so alt wie die erste Ranch in diesem Land. Es ist längst keine Feindschaft mehr, die offen ausgetragen wird. Das hat Jim Vance einmal versucht, als er vor zwanzig Jähren das Wasserloch am Turkey Creek mit seinen Rindern besetzen wollte. Damals machte Old Nat Thayer erst gar nicht den Umweg über Jim Vances Herdentreiber. Nat ging den geraden Weg. Er fing Vance vor dessen Ranch ab, holte ihn mit dem Lasso vom Wagen und »unterhielt« sich eine Viertelstunde mit ihm. Danach, so erzählten sich manche Leute in Uvalde, hätte Jim Vance vierzehn Tage im Bett gelegen und sich weitere vierzehn Tage nicht in der Stadt sehen lassen. Seine Leute aber trieben die Vance-Rinder schleunigst vom Gebiet des alten Nat und kamen auch nie wieder.
Ray Thayer gewinnt zwischen zwei Buschgruppen und Bäumen hindurch den Blick auf den Nueces und furcht die Brauen.
Rechts steht eine Palomino-Stute, und nicht weit von ihr ein großer, schlanker Rapphengst am Buschrand. Die Stute gehört Missis Wyatt O’Henry, die früher einmal mit dem Bruder des alten Jim Vance verheiratet war. Dann fiel Torsten Vance bei einer Schießerei zwischen Mexikanern und Rauhreitern in seinem eigenen Saloon einer verirrten Kugel zum Opfer. Seine Witwe heiratete John O’Henry, der jedoch aus dem Bürgerkrieg nicht nach Hause kam.
Sie ist immer noch, trotz ihrer vierzig Jahre, eine bildschöne Frau. Und man sagt, Jim Vance, seit Jahren Witwer, machte sich gewisse Hoffnungen auf Mabel O’Henry.
Jetzt steht ihr Pferd da unten an der Biegung, die meist seichtes Wasser führt. Neben der Stute rupft der Rapphengst von Howard Vance die Blätter von den Büschen. Howard Vance, so alt wie Ray, ist der einzige Sohn des alten Jim. Ist der Alte schon groß, dann ist Howard, sein prächtiger Nachfolger, noch eine ganze Meile länger. Yeah, Howard reicht mit dem Kopf in die Wolken – bildet er sich ein.
Sieh mal einer an, denkt Ray. Schön warm heute. Und Mabel O’Henry reitet manchmal hierher, wenn sie Zeit hat, und badet, weil das Wasser hier flach ist. Howard, du Halunke, sitzt du etwa zwischen den Büschen und beobachtest die Lady?
Ray lenkt sein Pferd herum. Langsam und vorsichtig nähert er sich, durch die Büsche gedeckt, den Bäumen und jener Buschgruppe. Kaum ist er auf dreißig Yards heran und noch hinter den Bäumen, als er jemanden lachen hört. Danach dringt eine helle, empörte Stimme durch dieses Gelächter. Ein Mädchen sagt wütend: »Howard, bring sofort unsere Kleider wieder her und verschwinde dann! Oh, du Schuft.«
»Hähä!« macht Howard und schwenkt schadenfroh einen Halbrock, ein Oberhemdchen und die anderen Sachen um den Kopf. »Komm nur heraus, meine liebe Sheila, komm doch, Cousine, ich tue euch bestimmt nichts.«
»Dieser Schuft!« sagt nun eine andere helle Stimme. »Sheila, und so ein Kerl ist dein Vetter.«
»Immerhin heiße ich nicht Vance, wie?« gibt Sheila O’Henry bissig zurück. »Ich bin ganz froh, daß ich nicht so heiße. Hörst du, Howard? Du bist ein ausgemachter Strolch. Man nimmt Mädchen nicht die Kleider weg und sieht ihnen beim Baden zu. Warte, ich sag’s deinem Vater, wenn er wieder mal zu uns kommt.«
»Hähä, da lacht er nur drüber. Was bekomme ich, wenn ich euch die Kleider hinlege und weggehe? Sheila, Rosy, wie wär’s, wenn ihr euch freikauft? Sagen wir – jeder zwei Küsse?«
»Du kannst zwei Backpfeifen bekommen, du verdammter Tunichtgut«, gibt Rosy Byrd, Tochter vom Schmied Byrd, wütend zurück. »Hol dir deine Küsse bei Eileen oder Carlotta, diesem Mexikanergirl. Hau ab und lege die Kleider hin, sonst werde ich es meinem Vater sagen.«
Ray ist abgestiegen, schleicht geduckt los, kriecht das letzte Stück. Dann richtet er sich langsam im hohen Gras auf und kann die beiden Girls sehen. Sheila ist achtzehn und Rosy siebzehn Jahre alt. Beide stecken bis zum Hals im Wasser.
»Ich denke nicht daran«, ruft Howard stur zurück. »Stellt euch nicht so an, kommt doch heraus, wenn ihr mutig seid.«
Howard schrickt zusammen, als dicht hinter ihm Ray Thayer grollend sagt: »Und du hast dafür eine verdammte Menge Mut, wie? Leg die Sachen hin, du Strolch.«
Howard wirbelt herum, sieht Ray vor sich stehen und stößt einen Fluch aus.
»Sieh an, der Thayer-Lümmel«, brummt er und streicht sich hastig das strohgelbe Haar zurück. »Hau ab, Mensch, ich kann dich hier nicht gebrauchen! Außerdem bist du auf unserem Land. Das Ufer hier gehört uns.«
»Was dir gehört, das kannst du gleich bekommen. Die Sachen weg! Und dann klemm dich auf deinen Gaul und hau ab, sonst mache ich dir Beine!«
Howard sieht ihn tückisch an. Er ist groß, aber sicher um zwanzig Pfund leichter als Ray. Wie fast jeder Mann in diesem Land, trägt auch Howard Vance einen Revolver. Er soll mit dem Ding verdammt schnell sein – so schnell wie mit Worten, wenn er ein Mädchen becircen will.
»Thayer, wenn hier einer verschwindet, dann bist du das, klar? Spiel dich nicht auf, du Drei-Kühe-Rancher-Lümmel.«
»Die Sachen weg, zum letzten Mal!« fordert Ray ihn auf. »Eins, zwei – drei!«
Howard Vance schleudert die Sachen Ray ins Gesicht. Und dann springt er ihn mit einem wütenden Schrei an.
Einen Moment hat Ray einen gestärkten und nach Sage riechenden Halbrock vor dem Gesicht. Doch springt er, von einer Vorahnung gepackt, blitzschnell zur Seite. Der Treffer macht Ray nicht viel aus. Er knirscht mit den Zähnen, dann hat er den Rock weggeschleudert und holt auch schon mit der rechten Hand aus. Seine Faust trifft Howard genau am Kopf, eher der herumkommen kann.
Howard stolpert, tritt auch noch auf Sheilas hochhackige Stiefel und schlägt hin.
»Lump!« sagt Howard angewidert. »Du nimmst keinem Girl mehr die Sachen weg.«
Ray beugt sich vor und kommt auf Howard zu liegen, nimmt ihm den Revolver ab, schmeißt ihn weg, und dreht sich. Dabei reißt er den jungen Vance mit und zieht die Beine an.
»Ab mit dir!« sagt er zornig. »Geh baden, Hundesohnl«
Als er die Beine streckt, fliegt Vance rücklings in das hochspritzende Wasser.
Howard Vance wird von Ray an den Haaren hochgezogen, er gurgelt, spuckt und schreit: »Dafür bringt mein Vater euch alle um, ich… Urrr!«
»Droht er auch noch mit seinem ziegenbärtigen Vater«, sagt Ray verächtlich. »Probiere mal, wie lange du es ohne Luft aushalten kannst, verdammter Schürzenjäger.«
Mit der linken Hand packt Ray Howards Rechte, mit der rechten Hand stößt er ihn wieder ins Wasser. Zwar strampelt er, aber seine Bewegungen werden immer schwächer. Dann erlahmen sie ganz.
»Um Gottes willen, Ray, du bringst ihn um!« kreischt Sheila O’Henry. »Zieh ihn raus, er erstickt sonst.«
»Könnte ihm nichts schaden«, antwortet Ray grimmig. »Der Kerl ist keinen Pfifferling wert. Wenn das alles stimmt, was man sich über ihn erzählt, dann sollte man ihn rechtzeitig zurechtstutzen. Raus mit dir, Hundesohn!«
Er packt ihn, stößt ihn an Land und watet ihm nach. Howard Vance bleibt sekundenlang auf dem Bauch liegen. Dann äugt er zu Ray hoch und wälzt sich herum, stemmt sich hoch.
»Du – du dreimal gehörnter Satan!« bringt Howard bissig heraus. »Daran denkst du noch, ich schwöre es dir.«
»Schwöre nie was, was du nicht halten kannst«, gibt Ray grimmig zurück. »Und jetzt ab! Keine Angst, ich gehe vor, du hast ein Gewehr im Sattel. Das werde ich vorsichtshalber behalten.«
Howard starrt ihn wütend an, preßt die Zähne zusammen und geht mit Ray durch die Büsche bis zu seinem Pferd. Dort nimmt Ray Howards Gewehr, deutet auf den Sattel und sagt kühl: »Hau ab, Mensch! Und vergiß nichts von dem, was ich dir gesagt habe!«
Vance steigt auf, reitet drei Längen und sieht sich dann um.
»Thayer, eines Tages bezahlst du es!« knirscht er wild. »Das vergesse ich dir nie.«
»In Ordnung«, sagt Ray gelassen. »Ich warte, du Strolch.«
Howard treibt sein Pferd an. Und Ray, der ihm folgt, sieht ihn in Nordrichtung verschwinden. Anscheinend reitet er direkt zur Ranch seines Vaters.
Ray kehrt um und sieht die beiden Girls mit nassen Haaren, aber angezogen an den Büschen stehen.
»Hallo, alles beisammen?« erkundigt er sich. »Keine Angst, daß sich der Bursche noch mal blicken läßt. Ich denke, er ist nach Hause geritten, um sich beim alten Jim auszuheulen.«
»Weshalb willst du schon fort?« fragt Sheila und sieht Ray mit offensichtlichem Wohlgefallen an. »Bleib doch ein wenig. Warum kommst du nie in die Stadt und hältst dich zum Wochenende mal im Saloon auf, wenn getanzt wird? Du bist nur einmal im Jahr da, am Unabhängigkeitstag. Ist es wahr, läßt euch euer Vater nicht zum Tanz in die Stadt reiten?«
Das ist ein prächtiges Girl, denkt Ray und sieht es forschend an. Die hellen Augen, der Mund… Nun ja, Sheila ist wirklich prächtig, wenn auch ein wenig ernst für ihr Alter.
»Irgendwann komme ich«, sagt Ray. »Kann nur einige Zeit dauern, bis ihr mich wiederseht. Nun, dann reite ich. Nehmt Howards Gewehr und Revolver mit, vergeßt es nicht!«
»Und du vergißt nicht, uns zu besuchen, Ray.«
*
Big Jim sagt kein Wort. Er geht zu seinem Schreibtisch, läßt sich in den Sessel fallen und greift nach einer Zigarre. Erst als sie brennt, sieht er seinen Sohn durchdringend an.
»Du kennst Raffaelo Flores?«
Was soll das denn? denkt Howard verstört.
»Antworte schon, überlege nicht lange! Also, du kennst ihn. Und den alten Juan Flores auch, ja?«
»Sicher, Dad.«
Ich werde verrückt, denkt Howard, was braut sich da zusammen?
»Und wie ist es mit Carlotta Flores, Sohn?«
»Ich kenne sie eben. Wieso, ist was?«
»Juan Flores war vorhin hier. Er wollte mich sprechen. Ich dachte erst, es sei wegen seiner Mühle, weil wir dort Getreide mahlen lassen. Du hast wohl, als du Mehl abholtest, auch gleich seine Tochter kennengelernt, oder?«
»Na und? Was ist schon dabei? Sie ist Mexikanerin.«
Der Alte steht langsam auf, kommt auf ihn zu und ist feuerrot.
»Was schon dabei ist? Du verdammter Taugenichts! Du hast nie was dabei, die Girls sind ja verrückt nach dir. Wonach sind sie es wirklich? Nach dir oder dem Geld, das noch immer mir gehört? Daß dich doch der Teufel holen soll, Mensch. Weißt du, was du angestellt hast? Dieses Mexikanergirl sitzt zu Hause und heult sich die Augen aus, ebenso ihre Mutter. Sie sind fromm, diese Leute. Ihre Tochter will dich heiraten.«
»Wa… was?« stottert Howard verstört. »Ist sie verrückt? Ich habe ihr nie etwas versprochen, das kannst du mir glauben.«
»Dafür bekommt sie jetzt ein Kind, du verdammter Tölpel«, brüllt der Alte, und es hört sich an wie ein Donnergrollen. »Von wem das ist, das darfst du dreimal raten. Heiraten will sie dich, damit das Kind auch den richtigen Vater bekommt. Der Spaß hat mich fünftausend Dollar gekostet.«
Er preßt die linke Hand auf die Herzgegend und knirscht mit den Zähnen.
Verdammt, denkt Howard verwirrt, das kann doch nicht wahr sein. Das hat gerade noch gefehlt. Ich und eine Mexikanerin?
»Fünftausend?« stammelt er. »Aber es ist doch nicht erwiesen, ob ich der Vater bin.«
»Noch einen Ton, dann knalle ich dir eins.«
Der Alte stampft auf und ab, während sich der Junge erschlagen in den nächsten Sessel fallen läßt. Das also ist es: Carlotta! Wäre ihr Sohn, der ja auch der Howards ist, im schlimmsten Fall der Erbe?
»So weit bringst du mich und dich«, knirscht der Alte. »Dieser Greaserhaufen hat genauso lange gewartet, bis nichts mehr an der Geschichte zu ändern war. Du weißt, wie gerissen die Flores sind, du kennst die Brüder von Carlotta. Sie sind berechnend und bilden sich schon ein, daß aus ihrer Sippe einmal der Nachfolger von Howard Vance kommen wird. Ich muß also einen Vorerben einsetzen. Und das werde ich tun, ganz gleich, was du dazu sagst. Das ist dein Preis für deinen Leichtsinn.«
»Und – nun?«
»Sie wird einen Mexikaner heiraten, deshalb die Geldforderung. Flores wußte genau, was er wollte. Kommt es noch mal vor, vererbe ich meinen Besitz sonstwem, aber dir keinen blanken Cent. Begriffen? Du läßt die Finger von den Girls! Und jetzt raus damit! Wie bist du zu der aufgeplatzten Lippe gekommen?«
Ich erzähl’s ihm, denkt Howard, er erfährt es ja doch.
Er redet. Der Alte stiert ihn an, tritt schließlich ans Fenster und blickt zum Hof hinaus.
»Er hätte dich noch schlimmer verdreschen müssen«, brummt Big Jim Vance von dort aus. »Wenn es nur nicht ausgerechnet wieder ein Thayer wäre, der es dir besorgt hat. Solange die da sind, werde ich nachts nicht ruhig schlafen können. Es ist ein Fehler, wenn man nie etwas vergessen kann. Ich dachte, ich käme mit den Jahren darüber hinweg, aber ich schaffe es nicht. Immer die Thayers.«
*
Der alte Nat sitzt ganz still, und er kommt sich wie ein Dieb vor, der irgendwo eingebrochen ist. Es ist Nacht, der Wind fegt heulend um die Ranch. Regen klatscht gegen die Scheiben.
Briefe liegen vor ihm, die Cliff in seinem Kasten unter dem Schrank hatte. Old Nat hat sie herausgenommen und gelesen.
Man kann etwas ein Leben lang ertragen, etwas vergessen. Vielleicht eine Niederlage, aber nie einen Sohn. So ist das, irgendwann, wenn man allein mit sich selbst ist, kommen die Gedanken.
Der Alte sieht hoch, hält das Bild in der Hand. Das ist er, sein Sohn Ray. Er steht vor einer Lokomotive, von Rindern umgeben. Auf der Rückseite des Fotos hat Ray hingekritzelt: Beim Auftrieb von zweitausend Rindern für viertausend hungrige Bahnarbeiter, Chinks und alle anderen Sorten von Menschen. Manitoba, 18. Juli 18…
Drei Jahre ist das schon her. Als der Junge wegging, da wurde er dreiundzwanzig. Jetzt würde er im kommenden Herbst neunundzwanzig. Im hohen Norden ist er gewesen, für die Armee ist er als Scout und Proviantboß geritten. Arm ist er nicht, das schreibt er in dem Brief, der vor einem halben Jahr ankam. Jetzt soll er irgendwo in Oregon sein. Da bauen sie eine neue Bahnlinie. Und wer verschafft den Chinesenarbeitern das Fleisch?
Ray Thayer.
Der Alte nimmt das letzte Bild hoch. Ray trägt darauf einen Schnurrbart, so ein dünnes Ding auf der Oberlippe. Sieht nicht einmal schlecht aus damit, der Lümmel.
Ich nehm’s weg, denkt der Alte, ich behalte es. Wird Cliff schon nicht auffallen. Ich packe alles wieder so in den Kasten, wie es gelegen hat. Hatte recht damals, der Ray, wirklich. Aber mir zu drohen – das hätte er nicht machen dürfen, das war zuviel.
Der Alte sieht sich verstohlen um, als er das Bild einsteckt und die Briefe und die anderen Bilder wieder an seinen Platz legt. Alles bringt er wieder in Ordnung. Dann geht er leise nach unten, setzt sich hin.
Ich schreibe ihm, denkt er, kramt im Schreibtisch, holt Tinte und Feder heraus. Dann schreibt er, wie schon zehnmal bisher. Nat Thayer schreibt seinem Sohn Ray einen richtigen Brief. Und als er damit fertig ist, packt er ihn säuberlich zu den anderen in den Holzkasten. Dort liegen sie nun alle. Er kann, wenn er nach Hause kommt und sein Vater schon längst tot ist, nachlesen, was der alte Mann gedacht und niedergeschrieben hat. Daß er seinen Jungen noch mal wiedersehen will, ehe er sterben muß. Und daß es ihm Kummer macht, wenn er den kleinen Cliff jeden Tag vor Augen hat – die Schulter schief, den Arm verkrüppelt, das linke Bein nachschleppend. Und so was muß ein Vater nun jeden Tag mitansehen.
Kann verdammt hart für einen alten Mann werden, der nach und nach feststellen mußte, daß er eine Menge Fehler gemacht hat. Aber ändern kann er nichts, das ist noch bitterer.
Da draußen… Er steht hastig auf, schließt das Fach ab und hängt sich den Schlüssel wieder um den Hals. An das Fach kann keiner heran, da liegt das Gewissen des Alten begraben – in einer Holzkiste.
Hufschlag kommt draußen auf. Der Alte nimmt die Laterne, tritt vor die Haustür. Zwei Reiter parieren am Corral ihre Pferde, steigen ab.
»Cliff?«
»Ja, Dad.«
Sie kommen herein, als der Alte schon in der Küche ist und den Kaffee auf dem Feuer hat. Naß sind sie wie die Katzen, und Old Bill niest gewaltig, zupft an seinem verfilzten Vollbart. Dann gähnt er, daß man die drei letzten Zähne deutlich sehen kann.
»Öh, sieht nicht gut aus, Nat.«
»So, wie hoch steht das Wasser denn?«
»Zehn Zoll noch, dann fließt es über das Staubrett durch das Tal in Richtung zu den Dawes.«
Der Alte schlürft seinen Kaffee, bemerkt, wie Nat unruhig wird.
»Und wenn die Dawes nun das Vieh im Tal haben und vom Wasser aus unserem Staubecken ersäuft werden, Bill?«
»Kaum anzunehmen, daß sie bei dem Regen ihre Rinder mitten im Tal stehen lassen, wie?«
»Bill, sie bekommen den ganzen Sommer über Wasser von uns. Die Dawes-Leute sind in Ordnung. Warum habt ihr denn nicht nachgesehen, ob sie ihre Rinder unterhalb unserer Staumauer haben?«
»Bei dem aufgeweichten Boden?« wendet Cliff leise ein. »Unsere Pferde hatten Mühe durchzukommen, Dad.«
»Also wißt ihr nicht, ob nun Rinder da sind oder nicht? Cliff, du hättest hinreiten sollen.«
»Ja, sicher, aber wir dachten nicht daran, wirklich nicht, Dad.«
Der Alte brummt vor sich hin, tritt ans Fenster und starrt in die schwarze Nacht.
»Regen und kein Mond«, murmelt er. »Das richtige Wetter für Viehdiebe. Seltsam, daß sie uns nur einmal, Dawes zweimal und Jim Vance gleich dreimal Rinder gestohlen haben. Heute könnten sie hundert mitnehmen. Da sehen auch die rauhen Burschen von Jim Vance nichts.«
»Na und?« fragt Old Bill. »Sollen sie Vance doch Rinder stehlen, der hat ja genug davon, fast zu viele. Nat, manchmal denke ich, daß sich Howard Vance die rauhen Burschen zu ganz anderen Dingen geholt hat, als nur wegen der Viehdiebe.«
»So? Du meinst, weil der alte Jim einen Schlaganfall gehabt hat und nur noch am Stock gehen kann, macht Howard nun, was er will? Der macht gar nichts, ich sage es dir. Solange sein Vater noch lebt… Nun ja, wir werden alt und schwach. Meine Zeit wird auch bald kommen.«
»Deine?« fragt Bill kopfschüttelnd. »Dich wirft nichts… He, was willst du denn?«
»Es läßt mir keine Ruhe«, antwortet Old Nat grübelnd. »Die Dawes sind unsere besten Nachbarn, gute Leute. Ich muß nachsehen, was es am Staubecken gibt.«
»Dad, du kannst doch jetzt nicht los. Es regnet in Strömen, viel schlimmer als vorhin.«
»Na und, Junge? Bin schon hundert Meilen bei so einem Wetter geritten.«
Er geht los, holt seinen Ölumhang, nimmt sein Gewehr mit. Draußen zerrt der böige Wind an seiner Kleidung, aber er holt sein Pferd, sieht Cliff an der Haustür stehen.
»Dad, komm zurück, oder bleibst du bei den Dawes, wenn sie die Rinder im Tal haben?«
»Kann ich in einem fremden Bett schlafen, Sohn? Ich komme zurück, in drei Stunden bin ich spätestens wieder da.«
»Paß aber auf, überall ist Morast!«
»Bin ich blind?«
Damit reitet er an. Die Dunkelheit schluckt ihn.
*
Kaum erreicht der alte Nat den Damm und das breite Staubrett, als er auch schon den Wasserstand sieht. Das Wasser schwappt nur noch wenige Zoll unter dem Überlauf. So voll ist das Becken noch nie gewesen. Tritt es erst über den Damm, dann kann es die Dammkrone annagen und ein Riesenloch wühlen, durch das dann immer mehr Wasser strömen und durch das Tal in wilder Bahn auf die Weide der Dawes Ranch stürzen wird.
Großer Gott, höchste Zeit, den Schieber zu öffnen, denkt Nat Thayer besorgt. Er steigt ab, hastet über den Damm, gegen den das Wasser klatscht, zum Drehbalken und löst die Klinke. Dann wuchtet er den Balken herum. Der Schieber zwischen den beiden Sperrwänden hebt sich. Das Loch in der Sperrmauer wird freigegeben. Dann kommt das Wasser im armdicken Strahl durch das Loch geschossen.
Zu wenig, stellt Nat Thayer fest. Es steigt schneller, als es abfließen kann.
Er öffnet den Schieber noch um zwei Umdrehungen. Jetzt braust und tost das Wasser in einem breiten Schwall in das Bachbett und ergießt sich rauschend nach Südwesten.
Das reicht, geht es Old Nat durch den Kopf. Dennoch könnte es für die Dawes-Rinder gefährlich werden. Komm, Alter, wir reiten mal weiter und sehen nach, wo Dawes seine Rinder stehen hat.
Er sitzt auf, reitet an und hält sich ganz rechts im Tal. In der Mitte glitzert der nun immer breiter werdende Bach. Kein Zweifel, wenn es noch Stunden weitergießt, kann sich der Bach in einen reißenden Strom verwandeln.
Nat Thayer legt mehr als drei Meilen zurück. Er kann nur im Trab reiten, sieht aber, als er die Dawes-Weide erreicht, keine Rinder in der Talsohle.
Er hat es geahnt, Gott sei Dank, stellt Nat fest. Dann wird er sie im linken Nebental haben, denke ich. Vielleicht sind seine Söhne dort.
Es dauert nicht lange, dann hat der Alte den Eingang zum Seitental erreicht und kommt durch das auch hier träge abfließende Wasser. Irgendwo vor ihm ist das Muhen von Rindern in der Nacht. Danach stößt er auf einen neuen Sperrzaun und ein Gatter. Langsam reitet er am Zaun entlang. Rechter Hand liegt die Weidehütte der Dawes. Aber kein Licht schimmert durch die Regenschwaden. Anscheinend ist niemand hier.
Nat Thayers Laterne brennt schon lange nicht mehr. Gegen den Regen hat die durchlöcherte zweite Haube nicht den Docht abdecken können. In der Laterne steht fingerbreit das Wasser. Fluchend reitet Nat Thayer auf die Hütte zu, als er hinter sich das Wiehern eines Pferdes hört. Es ist nicht weit, muß am Sperrzaun sein.
»Joe! He, Joe, Abel! Seid ihr hier?« ruft Nat Thayer in den prasselnden Regen hinein.
»Ich bin es, Nat. He, wo seid ihr?«
Er kommt im Trab zurück an den Zaun. Und dann hält er jäh an. Vor ihm tauchen drei oder vier Reiter auf. Sie treiben Rinder zwischen sich. Es müssen die Dawes-Männer mit dem Alten sein. Vielleicht haben sie ein paar verlaufene Rinder eingefangen.
Großer Gott, denkt der Alte, als es vor ihm aufblitzt, das sind ja nicht die Dawes, das sind die Viehdiebe, die seit dem Winter…
Sie sind höchstens zwanzig Yards entfernt. Und da sie in der Tiefe des Tales stecken, sehen sie den Alten genau gegen den helleren Himmel.
Drei, vier Feuerlanzen erhellen für Sekunden die nächtliche Szene.
Verzweifelt versucht der alte Nat noch, sein Pferd herumzureißen, als aber schon seine linke Seite getroffen wird.
Auch sein Pferd zuckt zusammen, macht einen Satz, während vor Nat Thayer die nächsten Schüsse fallen. Grell fauchen die Kugeln durch das enge Tal.
Irgend etwas stößt Old Nat Thayer gegen die rechte Brustseite. Er spürt noch, daß ihn die Kugel nach hinten schleudert. Unter ihm springt sein Wallach mit einem Riesensatz los und läßt den alten Mann aus dem Sattel kippen. Und während er schwer zu Boden schlägt und das feuchte Gras ihn aufnimmt, begreift er, daß es ein Fehler war, nach Dawes zu rufen. Im zuckenden Licht der Mündungsfeuer hat er genau gesehen, wie die zwei Männer etwa ein halbes Dutzend Rinder zwischen sich abtrieben. Die anderen beiden haben kaltblütig geschossen.
»Viehdiebe«, murmelt er und spürt den brennenden Schmerz in seiner Brust und der linken Seite.
Er bewegt müde den Arm und schafft es, in die Tasche zu greifen. Sein Taschentuch holt er heraus, legt es auf die Brustwunde und preßt dann die Hand in die stechende Seite. Zweimal versucht er aufzustehen, aber er schafft es nicht.
O Gott, denkt der Alte, das ist nun mein Ende. Ich wollte nie im Bett sterben. Jetzt hat es mich erwischt, doch ich lebe vorläufig noch. Cliff wird sicher noch eine Stunde warten und dann nach mir sehen. Vor zwei Stunden kann er nicht hier sein.
*
Bill Cooley hebt den Kopf, sieht zur Tür. Die Schritte kommen durch den Gang, verharren.
»Bill«, fragt Cliff draußen, »schläfst du schon?«
»Nein. Wer soll bei dem verdammten Wetter schlafen können?«
Dann kommt Cliff herein, die Lampe in der linken Hand. Er kann mit dieser Hand alle Gegenstände halten, den Arm bewegen, aber viel Kraft hat er nicht darin.
»Bill, wenn ich daran denke, daß Dad so verdammt allein da draußen in dem Dreckwetter ist… Ich mache mir Sorgen.«
»Um Nat braucht sich kein Mensch Sorgen zu machen«, sagt Bill Cooley und setzt sich auf, stopft seine Pfeife, grinst und fährt dann fort: »Du kennst deinen Vater immer noch nicht gut genug, Junge. Er kommt überall durch. Sicher, jetzt ist er alt, aber seine Erfahrungen kann ihm niemand nehmen. Als wir herkamen, er und ich, da hatten wir zehn Rinder. Damals gehörte das Land hier Don Aurelio de Pietas Cordoba. Nat blieb hier und fing an, sein Haus zu bauen, als sie kamen und ihn verjagen wollten. Wäre er nicht so hart gewesen, hätten sie es geschafft. Er spuckte ihnen vor die Stiefel. Und als sie ihn nicht in Ruhe ließen, kaufte er sie sich – mit dem Colt in der einen und der Bibel in der anderen Hand. Mach dir keine Sorgen, Cliff.«
»Er war wieder bei mir oben.«
Bill zuckt zusammen, nickt dann.
»Und?«
»Das letzte Bild von Ray fehlt. Bill, ich denke, er wollte weniger nach dem Staubecken sehen, als vielmehr mit seinen Gedanken allein sein. Er zeigt nie, was er fühlt, er verkriecht sich in sich selbst.«
»Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Cliff. Nat ist kein Mann, der jemals über Gefühle redet. Du kannst wetten, daß ihm die Sache von damals leid tut, schon seit Jahren. Aber etwas sagen? Eher beißt er sich die Zunge ab.«
Cliff starrt vor sich hin, nimmt die Laterne wieder.
»Ich reite ihm nach, Bill.«
»Was? Junge, wir sind ja erst richtig trocken geworden. Nat lacht dich aus, wenn du ankommst. Bei dem Wetter jagt man keinen Hund raus. Bleib hier, Nat kommt schon!«
»Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, daß ich ihn jetzt nicht im Stich lassen sollte.«
Cliff verläßt den Raum und steigt die Treppe nach oben. Einige Sekunden liegt der alte Bill Cooley still. Dann setzt er sich auf die Bettkante und seufzt.
Ist doch seltsam, denkt er. Ein komisches Volk, diese Thayers. Sie zeigen immer erst, daß sie richtig zusammenhalten, wenn es gefährlich wird. Die reden manchmal tagelang nicht miteinander. Man könnte meinen, sie wären Fremde. Und dann merkt man plötzlich, daß sie einen verdammt ausgeprägten Familiensinn haben.
Old Bill steht auf, zieht sich an und tritt in den Flur, als Cliff herunterkommt.
»He, was willst du denn, Bill?«
Der Alte krault seinen Vollbart und grient.
»Soll ich dich vielleicht allein lassen? Wenn dir was passiert bei dem Wetter, reißt mich Nat in der Luft auseinander. Komm schon, Junge, reiten wir.«
»Bill, so jung bist du auch nicht mehr.«
»Hör bloß auf, dir über mein Alter Gedanken zu machen. Feines Wetter, genau richtig für einen kleinen Ritt, was?« Er kichert. Ihm macht es nichts aus, ein paar Meilen zu reiten. Im Stall nimmt er eine von den Sturmlaternen, deren Kappen weit über das Glas ragen. In die Dinger kann kein Regenwasser eindringen.
Fünf Minuten später sind sie unterwegs. Der tanzende Schein der Laterne fällt über Old Nat Thayers gerade noch erkennbare Spur. Je weiter sie kommen, desto mehr legen sich Cliff Thayers sorgenvolle Gedanken. Er sieht, daß sein Vater sich am Hang gehalten hat, um nicht im dicken Morast der Talmitte zu reiten.
»Na, was sagst du jetzt?«
Sie zucken beide zusammen.
Durch den Regen und den heulenden Sturm, der die Büsche mit seiner Gewalt zu Boden drückt, dringen schwache Schußgeräusche.
Einen Moment sitzen sie still auf ihren Pferden und lauschen. Dann räuspert sich Old Bill heiser.
»Er wird die Dawes-Rinder aus dem Tal jagen. Darum das Schießen, was, Junge?«
Cliff lauscht immer noch. Keine Schüsse mehr, alles bleibt ruhig.
»Bill, das war weiter rechts.«
»Bist du sicher, Junge? So genau habe ich das nicht gehört.«
»Es kam mehr von rechts. Das Tal aber verläuft nach links, Bill. Komm mit, es ist so verdammt ruhig jetzt.«
Zweimal verliert sich Old Nat Thayers Fährte im abwärtsströmenden Wasser. Dann führt sie in das Tal, aber hier ist kein einziges Rind zu sehen.
»Bill, die Dawes haben keine Rinder hier gehabt. Siehst du?«
»Ja«, erwidert der Alte grübelnd. Und nun verspürt er doch so etwas wie Sorge. »Dann, äh, könnten sie nur im rechten Seitental sein.«
Sie reiten weiter. Der Regen klatscht in ihre Gesichter. Das Wasser rinnt in den Hemdkragen und durchnäßt sie bis auf die Haut. Bald sind sie im Seitental, halten an, als Cliff die Laterne hochhebt. Ihre Pferde stehen am Talgrund, durch den das Regenwasser abläuft und einen vielleicht sechs Yards breiten Bach bildet.
»Bill, Rinderspuren und Pferdehufeindrücke, siehst du?«
»Ja«, sagt der Alte gepreßt. »Da hat jemand Rinder mitten im Wasser getrieben, statt sie auf dem trockenen Ufer zu halten. Verdammt seltsam, daß die Dawes das getan haben sollten. Sieh doch mal nach rechts, da drüben.«
Keine drei Yards weiter verläuft die Einzelfährte. Old Nat Thayer muß hier geritten sein. Die Spur führt auf den Sperrzaun zu und endet am Gatter. Hier hat der Alte gewendet, er ist dann rechts hochgeritten und hat sich am Zaun gehalten.
»Cliff, rechts oben liegt die Weidehütte der Dawes.«
»Ja, vielleicht hat er…«
Sie sind sechzig Yards weiter, als der Junge das sagt. In diesem Moment fällt der tanzende Lichtschein der Laterne über den großen, ungefügen Schatten im Gras.
»Bill!«
Cliff reißt die Laterne hoch.
Verdammt, denkt der alte Bill entsetzt, Old Nats Wallach. Er ist tot. Und Nat?
Cliff treibt sein Pferd mit wilden Zurufen an, hält den linken Arm hoch und pariert dann sein Tier.
Er sagt nichts, der Junge. Er denkt nur an das Gefühl, das ihn den ganzen Abend über bedrückte.
Allmächtiger, denkt Cliff, laß es nicht wahr sein.
Die Ölhaut unten im Gras glänzt wie die Stiefel, über die der Regen rinnt. Eine Hand lugt aus dem Schlitz der Ölhaut, aber vom Kopf des alten Mannes ist nichts zu erkennen. Da ist nur die Ölhaut, der Alte muß sie sich über den Kopf gezogen haben.
»Dad! Dad!« sagt der Junge wispernd und steigt langsam ab. »Dad, Dad!«
Dann kniet er. Der Boden ist feucht, und der Regen prasselt auf seine Ölhaut. Regen rinnt ihm in den Nacken, als er die Hand hebt und am Umhang seines Vaters zieht.
Neben ihm steht der alte Bill und scheint den Atem anzuhalten.
»Cliff«, sagt Bill und lächelt verkrampft. Durch nichts verrät er, daß er Schmerzen hat. »Hallo, Junge! Bist du da?«
Es kommt stockend über seine Lippen. Er blinzelt träge, als sei er nur ein wenig müde. Wie hat er doch damals gesagt?
Ein Thayer zeigt keinen Schmerz.
Für ihn gilt das.
»Dad, ich helfe dir hoch.«
»Laß sein… Keinen Sinn, Cliff. Dein Bruder… Hol Ray, hole mir meinen Jungen – und sage ihm, es täte mir leid, es hat mir – immer – leid getan! Hol Ray her! Jim wird kommen, Jim Vance. Paßt auf, er kommt, er nimmt alles weg!«
»Dad, rede nicht so viel, du schaffst es schon. Zeig her, wo hat es dich erwischt?«
»Keine Mühe, Junge, nicht tun, liegenlassen. Vier Mann – keinen erkannt. Sie haben Rinder genommen… Dawes Bescheid geben. Bill, hörst du?«
Der alte Bill sitzt da und würgt. Allmächtiger, denkt der alte Bill, er hat immer davon geredet, er wolle um alles in der Welt nicht in seinem Bett sterben. Eine schnelle Kugel, das hat er immer gesagt. Und jetzt? Was soll ich ohne ihn anfangen? Ich bin ein ganzes Leben mit ihm geritten. Er war der größte Mann, den ich kannte – eisenhart, aber auf seine Weise einfach groß und mutig, ein Mann, dem man folgen konnte.
»Ja, Nat.«
»Cliff…«
Er redet schon so leise, daß sie sich über ihn beugen müssen, um seine Worte zu verstehen. Es ist, als habe sein eiserner Wille ihm die Kraft erhalten, bis sie hier waren.
»Dad, laß mich doch nachsehen. Ich will dich verbinden, Dad.«
»Keinen Sinn mehr, Junge. Die haben – zu gut getroffen. Sei mutig… Ein Mann – kämpft – kämpft immer. Sag Ray, ich hätte so gern gesehen, daß er – nach Hause… Ich hätte – ihm schreiben müssen. Cliff, was ich getan habe, mußte sein, es mußte. Mein Testament… Hier, der Schlüssel.«
Seine Hand tastet hoch, fährt zitternd unter das Hemd. An der Schnur hängt der Schlüssel zum Fach seines Tisches.
»Lesen – verstehen, Cliff. Ist nicht böser Wille, mußte es tun, Junge. Du wirst verstehen… Ich weiß, du bist klug, du warst mein lieber Junge. Tut mir leid… War hart, aber – ein Mann – muß hart sein können. Ray – Ray ist… Ray!«
»Dad, Dad!«
Er liegt still, der alte Mann. Dunkelheit senkt sich hinab. Er ist wieder in seinem Haus. Es regnet heftig, der Wind heult um die Ranch. Draußen Hufschlag. Und der Alte steht auf.
»Dad, Dad!«
»Ja, mein Junge. Daß du nun zu Hause bist, Ray.«
Er ist nicht mehr auf dieser Weide, er ist zu Hause. Wovon er immer geträumt hat, das träumt er nun noch einmal – zum letztenmal.
Cliff hält die Laterne hoch, leuchtet seinem Vater ins Gesicht.
Licht, denkt der alte Mann, es wird hell. Ich muß gut leuchten, damit der Junge nicht in die verdammte Lache vor dem Haus tritt. Komm nur, Ray, ich leuchte! Bist du endlich zu Hause, mein Junge, hast du heimgefunden?
»Ray!« sagt er. Es sind die letzten Worte. »Ray, mein Junge…«
Dann schweigt er für immer.
Regen prasselt nieder, aber Old Nat hört nichts mehr.
Er hat immer gewollt, daß ich hart sein sollte, denkt Cliff. Aber ich habe ihn geliebt, auch wenn ich manchmal furchtbare Angst vor seinem Jähzorn gehabt hatte. Ich kann nicht so hart sein. Seine Lippen zittern. Regen rinnt ihm in Tropfen über das zuckende Gesicht. Zwischen den Regentropfen…
»Cliff, Junge!«
Der alte Bill bringt es nur mühsam heraus. Er faßt Cliff an der Schulter.
»Cliff, er wollte nie in seinem Bett sterben. Hörst du?«
»Ja, Bill, ist gut. Ich… Entschuldige, ich…«
»In Ordnung, Junge, schon gut. Nimmst du ihn auf den Gaul? Ich müßte zu den Dawes, Cliff.«
»Sicher, Bill, hilf mir, ihn auf mein Pferd zu heben. Sag den Dawes Bescheid. Sie sollen nach den Spuren sehen. Vielleicht finden sie die Banditen.«
»Ich sehe selbst nach, Junge. Wenn ich die Kerle erwische, dann bringe ich sie um.«
*
Joe und Abe Dawes sind da. Der alte Dawes ist mit der ganzen Familie gekommen. Dann sind die Nunns erschienen. Tom Nunn sieht vergrämt und verbittert aus.
»Das war ein Mann«, sagt er, als er Cliff und Bill die Hand reicht. »Tut mir verdammt leid, Cliff. Hat er noch einen Wunsch gehabt?«
»Ja, er wollte Ray noch mal sehen.«
»Das dachte ich mir«, sagt Tom Nunn bitter. »Wann kann er hier sein?«
»Ich weiß nicht. Ein paar Wochen dauert es sicher, ehe er aus Oregon hier eintreffen kann. Geschrieben habe ich ihm alles, aber vielleicht – vielleicht kommt er gar nicht mehr. Er schrieb mal, er hätte es nicht nötig, sich noch mit Rinderzucht abzugeben. Weiß nicht, wann er hier auftaucht, Tom.«
Wie Tom Nunn, so kommen auch die anderen: Die Charltons, die Huegeles, die Smythes und die Weymillers. Fast alle sind gekommen, um Old Nat die letzte Ehre zu erweisen. Nur einer fehlt. Er ist ja krank und gelähmt, weite Wege kann er angeblich kaum noch machen.
Big Jim Vance.
Auch Howard hat sich bis jetzt nicht blicken lassen. Angeblich soll er unterwegs zum Rio Grande gewesen sein und nicht früh genug zurückkommen können.
Zwei Stunden danach ist alles vorbei. Wagen und Reiter sind fort. Die Ranch liegt so still und ruhig in der Sonne wie das Grab unter den drei Bäumen auf dem Hügel. Dort oben liegt schon Cliffs Mutter, wiedervereint mit dem Vater.
»Junge, er hat nicht mal den alten Clay Jenkins geschickt. Das ist ein guter Mann, dem alten Jim treu verbunden. Wenn er gekommen wäre, hätte ich etwas gewußt. Nun weiß ich etwas anderes, Cliff. Wir müssen aufpassen. Was wie Krankheitsgründe und Abwesenheit ausgesehen hat, das kann auch ganz was anderes sein.«
»Bill, was denkst du?« fragt Cliff aufhorchend und starrt aus dem Fenster auf den Dunst des in der Sonne dampfenden Regens. »Du glaubst doch nicht, daß Jim Vance jetzt die ganze Südweide mit dem Wasserloch fordern könnte?«
»Ich will es nicht hoffen, aber es könnte sein. Big Jim Vance hat das nie vergessen – nie, sage ich dir. Ich kenne diesen alten, hinterhältigen Burschen genau. Besetzt er unsere Südweide, kann er seine ganze Herde quer über sein Land auf unsere saftige Weide treiben. Unser Besitz grenzt an sein Gebiet. Nimmt er den Südstreifen, gewinnt er für einige tausend Rinder Platz und Futter. Und vor allen Dingen: Wasser. Big Jim konnte die ganzen Jahre nicht viel tun, um seine Herde zu vergrößern. Jetzt hat er die einmalige Chance.«
»Das – das hieße Krieg, Bill.«
»So?« fragt der Alte und saugt heftig an seiner Pfeife. »Gegen wen willst du Krieg führen? Gegen fünf Revolverschießer und zwanzig gewöhnliche Reiter? Zwei gegen fünfundzwanzig – das ist eine prächtige Rechnung, was? Nimm an, er besetzt das Land, was willst du dann tun? Wenn er dann hingeht und es kauft?«
»Er kann doch nicht unser Land kaufen, Bill.«
»Doch, das kann er, es ist freie Weide, Junge. Es würde ihn eine Unsumme kosten. Und sicher würde es eine Menge Fragen der Bodenbehörde geben. Die weiß ja, daß uns der Streifen gehört. Es könnte ein paar Monate dauern, bis sie entscheiden, ob sie das Land zum Verkauf freigeben. Doch irgendwann müssen sie es tun, das ist das Gesetz, Junge. Sieht nicht gut aus, wirklich nicht, Cliff. Ich wollte…«
Als er schweigt, dreht sich Cliff um und räuspert sich.
»Daß Ray hier wäre?«
»Ja, Cliff.«
Der nickt nur. Es trifft ihn nicht, was Old Bill sagt. Es hat ihn auch nicht getroffen, als er im Testament lesen mußte, daß es nur einen Thayer gibt, der über die Zukunft dieser Ranch zu bestimmen hat: Ray.
Es ist alles richtig, denkt Cliff resigniert, Vater mußte es tun. Ray ist wie er, der läßt sich auch nicht einen einzigen Nagel der Ranch wegnehmen. Ich sicher auch nicht, aber kämpfen ist nicht meine Art. Ich würde mich verteidigen, Ray aber angreifen. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und Dad hat es genau erkannt. Sicher, mir gehört die Ranch zur Hälfte, aber ich kann nicht ohne Rays Zustimmung verkaufen. Es ist, als hätte Dad geahnt, was kommen würde.
»Cliff, es tut mir leid. Muß ein verdammtes Gefühl für dich sein, oder?«
»Nein, Bill, nein, ich – ich bin eher froh. Dad hat es richtig gemacht, bestimmt. Schade nur, daß die Halunken vor vier Tagen die Rinder einfach zurückließen und davonjagten. Ich wollte, wir hätten ihre Fährte gefunden und bis an ihr Ende verfolgen können.«
»Vielleicht kommen sie wieder«, sagt Bill nachdenklich. »Das fehlte jetzt noch. Auf der einen Seite Viehdiebe, auf der anderen Howard Vance mit seinem gerissenen Alten. Junge, wenn mich nicht alles täuscht, werden wir Howard Vance bald sehen. Dann können wir unsere Gewehre nehmen.«
Der Alte steht auf und geht hinaus.
Er ahnt nicht, wie recht er behalten soll.
*
Einen Augenblick bleibt Old Bill stehen, dann sieht er die drei Reiter im schlanken Trab den Weg heraufreiten.
»Cliff, Achtung, wir bekommen Besuch.«
Cliff ist gerade dabei, die neuen Siele zu fetten. Jetzt läßt er den Walkbalken fallen, blickt um den Schuppen und erkennt nun auch die drei Reiter.
An der Spitze Howard Vance auf seinem großen Rapphengst. Sie sind am ersten Corral. Rechts hinter ihm reitet Matt Kilburn, ein eiskalter, sehniger Mann mit zwei Revolvern. Linker Hand hält sich Dexter Lane, etwa zwei Yards hinter Howard Vance. Lane hat noch zwei Brüder, und alle sind auf ihre Art im ganzen Grenzstreifen berüchtigt. Die Lanes haben Waffen und Brandy aus und von Mexiko geschmuggelt, jedoch hat man sie nur einmal erwischt. Seitdem lungern sie irgendwo in der Gegend von Laredo herum und stehlen dem lieben Gott die Zeit. Sie übernehmen jeden rauhen Auftrag, und Big Jim Vance hat sie alle drei wegen der Viehdiebe eingestellt.
Mit langen Schritten überquert Cliff Thayer den Hof. Dann tritt er in den Hausflur, sieht, wie Bill wieder auftaucht und schüttelt kurz den Kopf.
»Bill, was soll das? Wir brauchen kein Gewehr.«
Old Bill Cooley hat gleich zwei in den Flur gebracht. Das eine reicht er Cliff und sagt grimmig: »Wenn du dich nur nicht irrst, Junge. Ich kenne Kilburn und die Lanes, ich kannte schon ihren Vater. Das war zu seiner Zeit ein ausgemachter Strolch, der ein Halbblutmädchen aus Agua Prieta nahm. Von ihr stammen die drei
Lanes ab. Sieh sie dir nur an mit ihren schwarzen öligen Haaren, dann erkennst du, wieviel Prozent Indianerblut sie in den Adern haben. Sei vorsichtig, Cliff. Traue keinem, damit kommst du weiter. Ich habe die Hintertür verriegelt. Wollen sie herein, müssen sie schon ein Fenster zerschlagen.«
Die drei Männer sind jetzt noch hundertfünfzig Yards entfernt und reiten im gleichen Tempo weiter. Nichts an ihnen verrät, daß sie es eilig haben. Sie kommen heran, als hätten sie hier etwas zu sagen.
»Bill, es kann ganz friedlich sein«, sagt Cliff. »Und es wird an ihnen liegen, ob es auch friedlich bleibt, was? He, wo willst du hin?«
»Nach oben«, antwortet Bill Cooley trocken. »Man kann sie von dort aus prächtig sehen. Geh nicht raus. Bleib an der Tür stehen und stell dich so hin, daß du mit einem Satz zurückspringen kannst. Klar?«
»Ich weiß schon, was ich tue, Bill. Fang nichts an, wenn sie ruhig bleiben.«
Cliff überprüft, während Old Bill nach oben hastet, das Gewehr. Dann lehnt er es im Flur an den Türbalken, tritt hinaus und postiert sich direkt neben der Tür. Wie immer steht Cliff Thayer etwas schief. Er wirkt auf den ersten Blick verwachsen mit der leicht schrägstehenden linken Schulter. Und doch weiß Old Bill, wie schnell Cliff mit seinem Revolver sein kann. Dieser mittelgroße Mann, den viele für einen Krüppel halten, hat mit unbeschreiblicher Zähigkeit an sich gearbeitet. Er hat nicht nur die Beweglichkeit seines Armes wiedergewonnen, sondern auch so schnell ziehen gelernt, daß es für manchen rauhen Burschen eine höllische Überraschung geben könnte.
Über ihm tritt jetzt Old Bill an eins der Fenster, die ihm die Sicht auf den Hof freigeben. Old Bill hat noch eine Viertelminute Zeit. Er hastet zurück in den Flur und reißt die Tür zu einem der hinteren Zimmer auf. Er kann gleich darauf in den Garten und auf die Buschreihe am Bach sehen und verzieht den Mund zu einem grimmigen Lächeln.
Das habe ich doch gewußt, geht es ihm durch den Kopf. Wo einer dieser Lanes ist, sind auch die anderen beiden Rattenabkömmlinge nicht mehr weit. Sieh an, da kommen sie hinter den Büschen heran und führen ihre Pferde am Zügel. Es wird besser sein, wenn Cliff das weiß.
Blitzschnell hakt der Alte das Fenster los. Er kann nun das Fenster jederzeit aufstoßen. Dann rast Old Bill in den oberen Flur zurück und sagt heiser: »Cliff, sieh dich nicht um, und tu so, als redete ich nicht mit dir! Hinter dem Haus kommen die anderen beiden Lanes heran und spielen Indianer, wie ihre mörderischen Vorfahren. Laß sie nur kommen, ich passe schon auf. Jetzt fehlte noch Clement Tyler, dann hätten wir das ganze rauhe Rudel hier, was? Cliff, ich war noch nie sicherer, daß der alte Jim dahintersteckt. Er geht nie ein Risiko ein, der alte Fuchs. Der Aufmarsch verrät seine Hand. Bleib nur ruhig, Junge!«
Der Hufschlag bricht sich an der Wand des Ranch-Hauses und hallt über den Hof.
Howard Vance kommt mit Kilburn und dem ältesten Lane um den Stall durch die Einfahrt. Er sieht Cliff Thayer neben der Haustür lehnen und kneift die Lider zusammen. Kilburn hat wieder sein undurchdringliches Pokergesicht aufgesetzt, während um Lanes leicht geworfenen Lippen ein Grinsen spielt.
Zehn Schritt vor Cliff und dem Vorbau zieht Vance sein Pferd zurück. Er hält, hebt leicht die Hand und starrt Cliff durchdringend an.
»Hallo!« sagt er dann näselnd. »Thayer, bin ich hier willkommen oder nicht?«
»Das liegt an dir und deinen Ansichten, Mister«, antwortet Cliff kühl. »Wenn du tun willst, was jeder anständige Mensch getan hätte: zum Begräbnis nachträglich etwas sagen, dann bitte. Aber ich denke, du hast was anderes im Sinn.«
Cliff ist immerhin fünf Jahre älter als Vance, redet ihn aber, als er ihn duzt, nicht anders an. Daraufhin verzieht Howard Vance das Gesicht zu einer Fratze und poltert: »Ziemlich unfreundliche Begrüßung, wie? Nun gut, Mann, absteigen will ich erst gar nicht. Was ich zu sagen habe, ist ziemlich kurz.«
»Dann laß mich nicht lange warten, ich habe nicht viel Zeit«, gibt Cliff zurück. »Was willst du, Vance?«
Der sieht sich um. Offensichtlich hält er nach Old Bill Ausschau, aber der ist nicht zu sehen.
»Suchst du jemand?« fragt Cliff spottend. »Ich habe hier eine Armee versteckt, Mister, also einige Leute mehr, als du mitgebracht hast, um deinen Nachbarn zu besuchen. Nun, was willst du?«
Vance wird erst rot und dann blaß. Er ist kein Mann, der sich beherrschen kann. Im Gegensatz zu seinem Vater sieht man ihm immer sofort an, in welcher Stimmung er ist.
»Laß die dummen Späße, Thayer«, entgegnet er scharf. »Ich weiß sehr genau, wie stark du bist. Paß gut auf, Mister. Ich will dir etwas abkaufen.«
»Aha. Braucht ihr Rinder?«
»Der Spaß fängt an, mich zu ärgern«, meldet sich jetzt Dexter Lane bissig. »Du redest mit einem Vance, Drei-Kühe-Rancher.«
»Und ich nicht mit einem hergelaufenen Grenzbanditen«, antwortet Cliff schroff und schneidend. »Halt’s Maul, Lane, du bist nicht gefragt!«
Lane wird bleich, bewegt die Hand, als wolle er zum Colt greifen, hört aber in derselben Sekunde Howard Vance sagen: »Laß das, Lane, halte dich heraus!«
Dexter Lane knirscht mit den Zähnen. Es juckt ihn in allen Fingern, es diesem verdammten Krüppel zu zeigen, doch er muß sich beherrschen.
»Keinen Streit«, fährt Vance fort. »Thayer, ich will keine Rinder. Ich biete dir dreitausend Dollar für eure Südweide und das Wasserloch. Das ist ein faires Angebot, mein Vater läßt es dir ausrichten. Du hast eine Woche Zeit, es dir zu überlegen.«
»Ah, mächtig großzügig«, entgegnet Cliff spottend. »Das Wasserloch ist in der Zwischenzeit ein Staubecken geworden, Mister, falls du das noch nicht wissen solltest. Allein die Arbeiten dort unten sind uns auf dreieinhalbtausend Dollar gekommen. Sagt dir das etwas?«
Howard preßt die Zähne zusammen. Er versteht den leisen Spott nur zu gut. Cliff Thayer weiß genau, wieviel mehr das Wasserloch jetzt wert ist.
»Ich weiß«, entgegnet er. »Darüber können wir reden, Thayer, ich kann auch einige Dollar zulegen. Nun gut, viertausend – mein letztes Angebot. Ist dir das jetzt recht?«
Cliff Thayer sieht die drei Männer an und lächelt.
Sie wissen mit seinem Lächeln nichts anzufangen.
»Ist mir recht«, erklärt er »Dein letztes Angebot, Vance, verstehst du? Ich meine, daß es dein letztes Angebot ist. Und jetzt nimm einen Rat an, Mister. Ich verkaufe nicht, weil ich nicht will. Du kannst mir eine Million bieten, selbst dann bekommt kein Vance auch nur einen Fußbreit Thayer-Gebiet. Das ist mein erstes und letztes Wort, Mister.«
Howard Vance kocht vor Zorn. Der große, breitschultrige Rancher-Sohn krampft die Fäuste um die Zügelleine und starrt den kleinen, mageren Cliff drohend an.
»Mensch, das überlegst du dir noch«, faucht er. »Was ich haben will, das bekomme ich auch, verstanden? Ich biete dir fünftausend Dollar und zahle zu jeder Zeit. Du kannst das Geld haben, wann immer du es brauchst. Also, Thayer, sei kein Narr. Ich mache dir ein wirklich faires Angebot.«
Er redet zuviel, denkt Cliff. Der verdammte Kerl war in der Schule so dumm, daß ihn Ray in den Sack steckte. Jetzt versucht er mich hereinzulegen, der Affe. Während er hier eine Volksrede hält, marschieren die anderen beiden Burschen hinten herum und wollen entweder ins Haus oder mich von der Seite packen. Ob Old Bill es bemerkt hat?
*
Der alte Ziegenbart Bill Cooley grinst breit. Er steht längst hinten am Fenster und hat sein Gewehr schußbereit. Die beiden anderen Lanes haben ihre Pferde hinter der Hecke gelassen. Jetzt schleichen sie am Gartenhaus entlang, das »Old Robb« einmal einrannte, weil ihm wohl sein eigener Schädel, der sich im Glas spiegelte, nicht gefiel. Danach aber müssen die beiden ausgekochten Lanes über einen sieben Yards freien Raum, wenn sie zur Hintertür des Hauses wollen.
Old Bill Cooley steht ganz still und wartet. Er sieht jetzt Lemmy Lanes Gesicht an der Ecke des Gewächshauses auftauchen. Lemmy hat wirklich ein feines Gesicht. Die eine Augenbraue fehlt zur Hälfte. Die Nase ist die prächtigste Sattelnase, die Old Bill jemals gesehen hat. Ein Faustschlag hat sie mal so verbogen, daß sie in der Mitte eingeknickt ist und die Nasenflügel so breit wie zwei Mantelknöpfe sind.
Dazu schielt Lemmy auch noch fürchterlich. Das hindert ihn jedoch nicht, unheimlich schnell seinen Colt zu ziehen. Einige Leute behaupten, Lemmy hätte sechs Männer dank seiner abscheulichen Schielerei erschossen. Während er sie ansah, glaubten diese sechs Burschen immer noch, er sähe auf seine eigenen Stiefelspitzen. Es ist wahr, auch das Schielen kann einem manchmal helfen.
Jetzt zeigt sich Lemmy ganz. Er gleicht einem struppigen Straßenköter, so schmierig wirkt er. Dagegen ist sein Bruder Cole eine wandelnde Schneiderpuppe. Cole ist der jüngste Lane und kleidet sich piekfein. Er hat einen grauen Zylinder auf dem eierförmigen Kopf und trägt nur weiße Hemden mit Rüschen. Angeblich soll Cole ein guter Spieler sein. Jetzt aber ist er ein Narr, denn er wartet nicht ab, bis sein Knicknasenbruder Lemmy über den freien Raum rennt und an der Hauswand sichert. Cole kommt mit Lemmy zugleich um die Ecke. Und dann springen sie nicht etwa, sie schleichen auf die Hauswand zu.
Old Bill drückt mit dem Gewehrlauf das Fenster ganz auf. Das geht verdammt schnell. In der nächsten Sekunde schwenkt Old Bills Gewehrlauf auch schon nach unten.
Es ist immer ein Nachteil, einem Mann nicht gut genug zu kennen und manchen alten Burschen für einen Trottel zu halten, weil er nur noch einen Zahn hat.
Bei Bill Cooley haben sie sich gewaltig verschätzt, denn kaum hört Lemmy Lane etwas, als es auch schon kracht. Im selben Augenblick bekommt Lemmy Lanes Gewehr einen Schlag, daß Lemmy einen gellenden Schrei ausstößt. Die Waffe wird ihm aus der Hand geschleudert, der Kolben prallt gegen das Schienbein.
Kaum ist der erste Schuß heraus, als Old Bill die zweite Kugel mitten durch Coles feinen Zylinderhut jagt. Cole fehlen einige Haare – und der Hut, ehe er sich von seinem Schreck erholen kann. Der Hut segelt davon, vor Cole krümmt sich Lemmy zusammen und umklammert sein schmerzendes Schienbein.
Doch das ist noch lange nicht alles. Der alte Ziegenbart Bill feuert noch einmal. Und sicher liegen zwischen den drei Schüssen keine zwei Sekunden. Die dritte Kugel bohrt sich vor Lemmys Stiefelspitzen in den Boden und schleudert Dreckklumpen hoch.
»Stillstehen!« ruft Old Bill knarrend. »Versucht besser nichts, ihr beiden Strauchdiebe, sonst drücke ich ab! Einen von euch erwische ich todsicher. Lemmy, ich würde nicht versuchen, mit der Hand zum Colt zu angeln. Dasselbe gilt für dich, Cole, du widerliche, geleckte Ratte. Du spielst doch gern, was, Cole? Dann fang mal an, mit Lemmy zu würfeln, wer dem anderen voran in die Hölle sausen will.«
Die wilde Krache noch in den Ohren, stehen die beiden Lanes stocksteif mitten auf dem freien Raum. Es gibt keine Deckung.
»Na, ihr beiden Strolche, zufrieden?« erkundigt er sich voller Spott, als sie sich umsehen und erkennen müssen, daß es keine Chance gibt. »Hüpft mal los, wenn ihr könnt. Ich mache euch Musik zum Hüpfen, darauf könnt ihr wetten.«
Im nächsten Augenblick hört er vorn den scharfen Schrei: »Lemmy Cole, was ist passiert?«
Der dritte Rattenbruder meldet sich, denkt Old Bill. Kerl, schade, daß ich dein Gesicht jetzt nicht sehen kann.
»Kann ich antworten?« fragt Cole mit verzerrtem Gesicht. »He, Cooley…«
»Antworte, du geleckter Pomadenhaaraffe!« knurrt Bill ihn an. »Aber kein Wort zuviel.«
Cole fährt sich über die Lippen. Bei den drei Lanes ist es so, daß zwei von ihnen nur großmäulig sind, solange Dexter bei ihnen ist. Fehlt er, fehlt ihnen auch manchmal die Spucke vor Schreck.
»Dexter, der alte Cooley hat uns vor dem Lauf.«
»Verfluchte Schweinerei!« knurrt Dexter vorn wütend. »Mit dem alten Tattergreis habe ich nicht gerechnet. He, Cole, keine Chance?«
»Sie haben eine!« brüllt Bill laut hinaus. »Die zu sterben, du Oberaffe. Seid friedlich, sonst könnt ihr die beiden liegend wieder mitnehmen! Und ich schätze, sie werden verdammt viel unterwegs singen, so fröhlich werden die vor Schmerzen sein. Cliff, alles in Ordnung?«
»Ich denke schon«, kommt es als Antwort. »Keine Sorge, Bill, hier sind sie friedlich.«
Im selben Augenblick sieht er Dexter Lanes verstohlene Handbewegung unter die Weste. Er hat in diesen Dingen keine Erfahrung, der schlanke, verkrüppelte Cliff Thayer, aber er sagt sich, daß Lane nicht nur einen Revolver im Halfter, sondern einen zweiten unter der Jacke haben könnte.
Blitzartig stößt Cliffs rechte Hand abwärts. Seine Finger erfassen den Kolben, sein Daumen reißt den Hammer noch im Ziehen des Revolvers zurück. Dann liegt die Waffe auch schon waagerecht in seiner Hand und zeigt haargenau auf Dexter Lanes Brust.
Lane wird kreidebleich und dann schmutziggrau. Seine Augen haben sich vor Schreck geweitet. Er und Howard neben ihm stieren auf den Revolver in Cliff Thayers Hand.
Kilburn aber hat nur einmal mit den Lidern gezuckt und sich sonst nicht gerührt. Der hagere Mann mit dem starren Gesieht sitzt ganz still.
»Nun?« fragt Cliff leise. »Wie ist es, Lane? Faß doch mal tiefer unter die Weste.«
»Verdammt, verdammt!« stößt Lane hervor und sieht Cliff wie ein Ungeheuer an. »Der Bursche zieht ja höllisch schnell.«
»Du kannst herausfinden, wie schnell wirklich, wenn du absteigst und die anderen sich heraushalten«, sagt Cliff. »Für dich reicht es bestimmt, Lane. Was ist, Vance, noch Lust, deine Leute in meinem Rücken herumschleichen zu lassen?«
Howard Vance schluckt verlegen. Dann schüttelt er langsam den Kopf.
»Schon gut, Cliff Thayer«, sagt er gepreßt. »Du hast es so haben wollen, jetzt wundere dich nicht über die Folgen. Kilburn, Lane, wir reiten.«
Lane flucht, als Howard sein Pferd herumbringt. Er stiert auf den Colt in Cliff Thayers Hand und weiß genau, daß sie jetzt nicht die geringste
Chance haben. Nur Kilburn hält noch, als die anderen beiden Männer sich absetzen. Kilburn blinzelt schläfrig. Dann aber sagt er leise: »Ich möchte wirklich wissen, wie schnell du sein kannst, Thayer. Wenn wir uns wiedersehen, kannst du es mir zeigen, oder du mußt weglaufen, Mister. Ich bin in Uvalde, dort warte ich.«
Jetzt erst lenkt er sein Pferd herum. Die drei Männer reiten außer Schußweite und halten dann mitten auf dem Weg. Der Hufschlag verklingt. Noch aber stehen Lemmy und Cole Lane hinter dem Haus und wagen sich nicht zu rühren.
»Heb deinen Schießprügel auf! Kannst dir einen neuen Schaft besorgen, Lemmy«, zischelt Old Bill aus dem Fenster. »Komm aber nur nicht auf faule Tricks. Du gehst zuerst! Dein prächtiger Bruder Cole kann eine Weile warten, bis du mit den Pferden weg bist. Na los, Mister, verschwinde! Oder soll ich dir Beine machen?«
Lemmy knurrt wütend. Er schielt nach oben, obwohl es wieder mal aussieht, als betrachte er nun die Milchkannen an der Mauer.
»Mach keine Dummheiten, Cole«, preßt er sich ab. »Komm dann nach, mit dem Alten reden wir noch mal.«
Das am Schaft gesplitterte Gewehr in der Faust, stakst Lemmy davon, verschwindet hinter der Hecke.
Gleich darauf taucht er im Sattel seines Pferdes auf und prescht los.
»Cole, du geleckter Pomadenvertilger, hau ab!«
Cole rennt mit großen Sprüngen davon, während hinter dem alten Bill Cliff Thayer die Treppe herauf in den Flur kommt.
»Da saust der letzte Strolch auf seinem Gaul ab«, stellt Old Bill kichernd fest. »Hatte lange nicht mehr so einen Spaß, Cliff. Doch freuen wir uns nicht zu früh. Es war ein Fehler von dir, Kilburn zu zeigen, wie schnell du wirklich bist. Ich will dich nicht loben oder dir was in den Kopf setzen, Junge, doch ich glaube, du könntest mit etwas Glück auch einen Mann wie Kilburn schlagen. Bist fast so schnell, wie Ray es damals war. Kilburn weiß jetzt, daß er ein Risiko eingeht, läßt er sich mit dir in eine Schießerei ein. Er wird verdammt vorsichtig sein müssen. Vielleicht aber gehört er zu jener verrückten Sorte, die absolut herausfinden muß, ob sie schnell genug ist. Meist erfahren die Burschen es nie, sie sterben zu schnell.«
»Bill, ich habe keine Angst. Weglaufen werde ich nie.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagt der Oldtimer. »Vielleicht wäre es aber besser. Allein fährst du nicht mehr in die Stadt. Wir müssen spätestens in einer Woche hin und die Küchenausrüstung ergänzen. Komm mir nur nicht damit, du wolltest das allein tun. Verstehst du, Cliff? Geh nie allein irgendwohin.«
*
Als Kilburn das Gewehr klickend durchlädt, schrickt Howard Vance zusammen.
»Zum Teufel!« sagt er barsch, »Kilburn, laß das endlich sein, Mann! Jetzt lädst du zum sechstenmal das verdammte Gewehr durch. Was soll der Unsinn?«
Kilburn sieht ihn schläfrig an, hat die Lider halb geschlossen. Der hagere Revolvermann zuckt die Achseln.
»Vielleicht bin ich nervös, was?« antwortet er dann leise. »Kann alles sein, Mister Vance. Es ist ein Fehler.«
Howard Vance verträgt es nicht, daß man ihn kritisiert. Das weiß auch Tyler, der dritte Mann an der Brücke. Der vierte Mister ist Cole Lane.
»So, ein Fehler? Du mit deiner verdammten Sucht, dich schießen zu müssen«, fährt er Kilburn an. »Das fehlt noch, ein Duell mit einem Krüppel, was? Du kannst nicht denken, Mister Kilburn.«
Der zieht die Augenbrauen hoch. Das allein deutet darauf hin, daß er sich ärgert.
»Wer tot ist, der macht keiner Fliege mehr ein Bein krumm«, erwidert er träge. »Mister Vance, ich hätte mich mit ihm schießen sollen. Tot ist tot.«
»Ja, mein Freund«, gibt Vance zurück. »Schieß dich mit einem gesunden Mann, dann ist das für die Leute in Ordnung. Aber knallst du einen halblahmen Krüppel über den Haufen, hast du das ganze Land gegen dich. So ist das. Ich hab’s nicht so gewollt, ich war mehr für deine Methode. Aber mein Vater ist dagegen. Der ist noch von früher, begreifst du? Da ließ man Narren und Krüppel ungeschoren.«
»Wird schon sehen, was er davon hat«, erwidert Kilburn. »Und wenn sie jetzt nicht die Brücke nehmen?«
»Sie fahren hier entlang«, beharrt Vance. »Den Weg haben sie immer genommen. Die denken gar nicht daran, über unser Gebiet zu fahren. Sind sie durch, stellen wir das Schild auf. Klar?«
Er grinst breit. Das Schild liegt zweihundert Yards weiter unter Büschen. Zwar haben sie das Loch für den Pfahl schon gegraben, aber doch noch nicht daran gedacht, den Pfahl einzusetzen. Es wird ganz leicht sein, denkt Howard Vance. Das ist unser Land. Und jetzt sperre ich den Weg. Die Erlaubnis Big Jims galt nur, solange der alte Nat Thayer lebte. Nun ist es vorbei damit. Wer jetzt über unser Land fährt und Thayer heißt, den soll der Teufel holen. Ich werde ihnen das geben, was sie…
Trommelnder Hufschlag wird laut. Ein Reiter prescht durch die linken Uferbüsche und rast auf seinem Gaul auf das Gestrüpp am Brückenaufgang zu.
Es ist Dexter Lane. Der dritte Lane-Bruder. Lemmy steckt in der Nähe der Thayer- Ranch und hat Zeichen zu geben, sobald dort niemand mehr ist.
»Dexter?«
»Ja, alles in Ordnung, sie kommen«, erwidert Dexter Lane heiser. »Boß, sie fahren diesen Weg, nicht die andere Straße.«
Sie sehen alle, wie ein breites Grinsen über Howards Gesicht huscht. Vance blickt wie zufällig nach rechts auf das Ufer und das Flußknie. Dort hinten ist die Sandbank, und dort hat er einmal von einem Thayer Prügel bezogen, ehe der für immer aus dem Land verschwand.
Jetzt kommt der zweite Thayer, sein kleiner Bruder, hier hoch…
Es ist gut, daß es fast dieselbe Stelle ist, denkt Howard Vance befriedigt. Der soll was erleben. Man fährt nicht ungestraft über unser Land, wenn man Thayer heißt.
»Weg mit euch!« zischelt er. »Tyler, auf deinen Posten! Wirfst du daneben, Mann, holt dich der Teufel!«
*
Er hört nur das grelle Pfeifen über sich, verrät ihm etwas, doch es ist zu spät für Cliff Thayer, irgend etwas zu tun. Als das Pfeifen des Lassoriemens über ihm ist und das ratternde Geräusch der Wagenräder auf dem holprigen Weg übertönt, saust ihm die Schlinge auch schon über die Oberarme.
Neben ihm wirbelt der alte Bill herum, sieht, wie sich die Zweige der rechts stehenden Büsche bewegen. In diesem Augenblick handelt der Alte wie hundertmal vorher in seiner besten Zeit.
Bill Cooley hat die Falle vor der Brücke erkannt. Er weiß jetzt, daß jemand hinter den Büschen gesteckt hat. Der Mann hat sie vorbeifahren lassen und dann erst seine Schlinge geworfen. Das Lasso strafft sich bereits. Hinter den Büschen springt ein Pferd heraus und jagt vorwärts. Links über dem nach hinten in den Kasten gestürzten Old Bill sirrt das Lasso. Dann stößt Cliff einen schrillen Schrei aus und erscheint wie ein Schatten über dem alten Bill.
Sie reißen ihn vom Wagen, denkt Bill Cooley entsetzt. Der Junge mit seiner verwachsenen Schulter, wenn er jetzt unglücklich fällt, bricht er sie sich wieder und…
Mehr denkt er nicht, er handelt schon. Mit einem Griff hat Old Bill sein Gewehr erwischt. Er sieht nur das Pferd, auf dem ein Mann sitzt und das Lasso am Sattel festgebunden hat.
Am Lasso hängt Cliff Thayer wie eine Puppe und fliegt im Bogen vom Wagen in die Büsche hinein.
Als der alte Bill sein Gewehr hochreißt, um zu feuern, taucht seitlich des ersten Reiters ein zweiter auf. Der Mann prescht auf den Wagen zu und ruft irgend etwas. Dann zuckt seine Hand mit dem Revolver hoch.
Die Sonne scheint, aber der Wind ist schneidend und kalt. Kälte erfaßt auch Old Bill, als er den Revolver herabzucken sieht. Der Bursche dort auf dem Gaul – er ist Cole Lane – nimmt Ziel.
»Du Ratte, du widerliche, pomadierte Ratte!« brummelt der Alte und drückt auch schon ab. »Da hast du was.«
Er muß schnell schießen, vielleicht eine Sekunde zu früh. Darum trifft er nicht Cole Lane, sondern sein Pferd. Das Tier stößt einen wiehernden, markerschütternden Schrei aus. Dann bricht es vornüber zusammen. Vor Schreck brüllt Cole los. Er schießt im Bogen über den Hals des zusammenbrechenden Pferdes hinweg. Ihm bleibt keine Zeit mehr, sich einen günstigen Landeplatz zu suchen.
Im gleichen Moment hört Old Bill den scharfen Ruf hinter sich. Er wirbelt geduckt auf dem immer noch rollenden Wagen herum. Dann sieht er Dexter Lane und liest den Haß in den Augen des bärtigen Mannes. Lane hat genau verfolgen können, wie es seinen Bruder Cole erwischt hat.
Jetzt feuert Lane seinen Revolver ab.
Der Alte spürt den Schmerz in der rechten Schulter. Sein Arm wird mit einemmal steif. Die Kugel lähmt die Muskeln. Aus Old Bills Faust fällt das Gewehr in den Kasten zurück. Old Bill torkelt nach hinten, gerät mit den Stiefelabsätzen an das Kastenbrett, stürzt hintenüber und landet auf den groben Steinen, die den Weg übersäen.
»Liegenbleiben!« brüllt jemand und taucht urplötzlich aus den Büschen auf. »Rühr dich nicht, Alter!« Es ist Kilburn, dessen Colt sich drohend auf den alten Mann richtet. Von links kommt jetzt Howard Vance springend über den Weg. Auch er hat seinen Colt in der Faust. Nun taucht auch Dexter Lane auf. Der bärtige Mann sieht über den am Boden liegenden Alten hinweg, wie sich dreißig Yards weiter Cole mühsam aufstemmt und dann wieder umfällt. Coles Hände und das Gesicht sind von den Steinen aufgeschrammt worden. Seine Gesichtshaut ist aufgerissen, seine groben Handflächen bluten, und aus seiner Nase rinnt ein dünner Faden auf seine graue Anzugjacke.
»Cole«, ruft Dexter Lane schrill. »Cole, was ist? Hundesohn, wenn du ihn angekratzt hast, dann hänge ich dich auf, du alter Ziegenbart.«
Er treibt sein Pferd an, während Kilburn nach einigen Sprüngen neben Old Bill steht und den Revolver nach unten richtet. Kaltäugig blickt Kilburn auf den Alten hinab. Er sieht das Blut aus dem Loch in Old Bills Schulter sickern und bückt sich. Dann entreißt er dem Alten den Colt, steckt ihn ein und sagt barsch: »Setz dich auf und halte dir dein Halstuch auf das Loch, Mann! Warum mußtest du auch schießen?«
»Und warum, du Totengesicht«, entgegnete Old Bill fuchsteufelswild, »fallt ihr über uns her? Ich sage dir… Aaah!«
Er sitzt kaum, als Kilburn ihm brutal den Fuß gegen die Schulter stößt und Old Bill wieder rücklings umkippt.
»Das war für das Totengesicht«, sagt Kilburn krächzend. »Rede noch mal so mit mir, dann unterhalte ich mich drei Minuten auf meine Art mit dir, Boß…«
Aber Howard Vance ist schon weg. Er rennt zu seinem Pferd, schwingt sich in den Sattel und sieht noch aus den Augenwinkeln, wie Cole Lane fluchend auf die Beine kommt. Cole taumelt, sagt aber wild: »Den schlage ich tot, den alten Schurken. Laß mich vorbei, Dexter! Laß mich.«
»Du hast einen Befehl bekommen«, unterbricht Dexter ihm »Los, zu meinem Gaul und dann hinter dem Boß her! Kilburn macht das schon.«
Als sie endlich fluchend im Sattel sitzen und anreiten, ist Howard Vance schon hundertzwanzig Yards weiter und sieht das straffgespannte Lasso hinter Tylers Pferd. Tyler prescht jetzt über den Sand. Cliff Thayer hängt wie ein lebloses Bündel am Lasso und fliegt mitten in das Wasser.
»Tiefer hinein!« ruft ihm Vance gellend zu. »Bring ihn bis auf die Sandbank, und dann halte erst!«
Tyler gehorcht und prescht durch das hochspritzende Wasser, bis er die Sandbank erreicht hat. Cliff Thayer wird klatschnaß. Er schluckt Wasser, glaubt ersticken zu müssen und schießt dann auf den feinen hellen Sand in der Mitte des Nueces River. Dort bleibt er, nachdem er hustend das Wasser ausgespuckt hat, liegen. Um Cliff dreht sich der Himmel. Die Uferbüsche tanzen auf und ab. Schleier wogen vor seinen Augen, bis sich das Pferd aus ihnen zu schälen beginnt. Dann zeichnet sich der Reiter klar ab.
»Sieh an, ein Narr, der nicht lesen kann«, stellt Howard Vance voller Hohn fest. »Thayer, ist dir was?«
»Nein«, antwortet Cliff mühsam. »Ganz lustig heute, was, du Halunke.«
Der Teufel mag wissen, warum Vance eine Treiberpeitsche mitgenommen hat. Vielleicht hat er an den alten Nat Thayer gedacht und an die Prügel, die sein Vater einmal mit einer Peitsche erhielt. Aber das kann Cliff nicht wissen. Er sieht jetzt nur die Peitsche. Die Schnur zischt los und klatscht ihm mitten über die Schulter, verursacht einen brennenden Schmerz. Ray muß ihn oft genug gespürt haben, wenn ihn der alte Nat schlug. Cliff hat die Peitsche nie geschmeckt. Jetzt spürt er sie zum erstenmal und zuckt zusammen.
»Nenn mich noch mal Halunke, dann trenne ich dir die Haut in Streifen«, droht Howard Vance voller Wut. »Du mußt das doch kennen, eh? Euer Vater hat euch und andere Leute ja immer mit seiner verdammten Peitsche geschlagen, was? Thayer, hast du das Schild nicht gesehen? Ich werde dir sagen, du hast es gesehen. Aber du verdammter, hochmütiger Bursche bist einfach weitergefahren, wie?«
Was ist das? denkt Cliff verstört. Soll das ein neuer Trick sein? Wo war das Schild?
»Ein Schild? Was für ein Schild?«
»Er hätte es sehen müssen«, meldet sich Tyler. Daß er genauso lügt wie Howard Vance, kann Cliff nicht ahnen. »Der verdammte Kerl ist einfach weitergefahren. Ich habe doch beobachtet, wie sie miteinander geredet haben, als sie vorbeifuhren.«
»Lüge – du lügst!« stößt Cliff hervor und spürt im nächsten Moment, wie der Ruck ihm die Arme an den Leib preßt. Tyler reißt ihn fluchend einige Schritt weiter über den Sand. Jetzt meldet sich auch der Schmerz in Cliffs Rücken wieder. Ein Ast ist ihm durch die Jacke in den Rücken gedrungen und hat eine heftig blutende Wunde hinterlassen. Es brennt dort wie Feuer.
»Sage nie wieder, daß ich lüge!« faucht ihn Tyler an. »Seit gestern steht dort vorn am Weg, wo er sich zur Furt und zur Brücke gabelt, das Schild, Mister. Die Buchstaben darauf sind groß genug, daß sie selbst ein Halbblinder lesen kann. Links vom Schild beginnt das Gebiet der Vance-Ranch. Hast du das vergessen, Mister?«
Das Gebiet der Vance-Ranch, denkt Cliff bestürzt. Er hat recht, der Hundesohn, er hat wirklich recht. Dort fängt Big Jims Land an. Großer Gott, das ist es also. Sie haben einen Grund gesucht, um über uns herzufallen. Und es war nicht schwer für sie, einen zu finden.
»Jetzt weiß ich es«, sagt Howard Vance grinsend und spuckt dicht neben Cliff in den Sand. »Schlau geworden, Thayer? Ja, mein Freund, wir haben gestern ein Schild aufgestellt und das Land gesperrt, auch die Brücke. Es ist verboten, über unser Land zu reiten, zu gehen oder zu fahren. Dieselben Schilder stehen überall an unserer Weidegrenze. Und weißt du weshalb, du Halunke? Weil uns dauernd einige Rinder verschwinden. Wir haben es satt, uns bestehlen zu lassen. Wer jetzt noch auf unser Land kommt, den erwischt eine Kugel ohne Anruf. Eigentlich hätten wir euch niederschießen können, und vielleicht wäre das auch das beste gewesen. Könnte sein, daß dann die verdammten Viehdiebstähle aufgehört hätten, oder?«
Einen Moment verschlägt es Cliff Thayer die Sprache. Dann aber kommt er mit dem Oberkörper hoch, starrt Howard Vance wild an und sagt wutschnaubend: »Du verkommener Strolch! Niemand nennt einen Thayer einen Viehdieb. Sieh dich bloß vor, Mann!«
»Eure Herde soll doch zugenommen haben im letzten Jahr, stimmt’s?« erkundigt sich Tyler höhnisch. »Boß, hat er dich einen verkommenen Strolch genannt?«
»Ich hörte so was«, gibt Vance zurück. »Kühle ihn ab, damit er sich überlegt, ob er mich noch mal beschimpft.«
Tyler reitet sofort an. Es geht denselben Weg zurück. Wieder ist Cliff dem Ersticken nahe. Er bleibt japsend am anderen Ufer liegen und spürt das immer stärker werdende Brennen. Als er sehen kann, blickt er an sich hinab und entdeckt, daß ihn Tyler durch ein Stachelgestrüpp geschleift hat. Daher das Brennen.
Jetzt hört er Hufschlag. Er sieht Kilburn kommen, den alten Bill schwankend vor Kilburns Revolver her taumeln und das Blut an Bills rechter Schulter.
»Weit genug, hier kannst du bleiben!« sagt Kilburn fauchend. »Setz dich hin, Alter, aber steh nicht ohne Befehl auf, sonst erlebst du was!«
Er wirft einen kurzen Blick zur Seite. Hinter einem Busch kommen Cole und Dexter Lane hervor. Cole preßt sein feuchtes Taschentuch auf die Nase. Er tränkt es erneut am Flußufer. Dann tritt er neben den alten Bill und wringt das Tuch über dessen Kopf aus.
»Sieh mich an!« sagt er schrill vor Wut. »Ich kann mich vier Wochen in keinem Saloon mehr blicken lassen, du alter Schurke. Mein Gesicht.«
»Endlich siehst du mal anständig aus, du pomadierter… Oaaah!«
Cole holt mit einem brüllenden Wutlaut aus und stößt den alten Mann brutal um. Dann stiert er ihn an und hebt langsam den Fuß.
»Sagst du noch was? Ich kenne ein paar Tricks, die du nicht überstehst, ohne alle Sünden zu beichten, du alter Teufel. Gleich bekommst du…«
»Laß ihn, Cole.«
»Verflucht, er regt mich auf«, sagt Lane aufgebracht. »Boß, er treibt mir die Galle ins Blut.«
»Du hast es gehört«, sagte Vance scharf. »Genug mit ihm aufgehalten. Ihm passiert nichts, er ist nur ein Handlanger der Thayers. Hast du das Schild auch nicht gelesen, Cooley?«
Innerhalb einer Minute erfährt auch der alte Bill die Sache mit dem Schild und sagt schnaufend: »Das hast du dir nicht ausgedacht, Junge, dazu bist du nicht schlau genug. Das war Big Jim, wette ich. Und wo hast du diese stinkende Ratte Lemmy Lane gelassen? Pflanzt er das Schild gerade ein? Ich kann schwören, dort hat keins gestanden, als wir kamen. Vielleicht ist jetzt aber eins da, he?«
Wütend macht Dexter Lane einen Satz auf den Alten zu. Kilburn aber hebt den Colt und sagt grollend: »Gehorche, wenn du einen Befehl bekommst, Mister!«
»Verflucht, du hast mir gar nichts...«
»Willst du Streit mit mir?« erkundigt sich Kilburn schläfrig. »Dexter, dazu seid ihr alle drei nicht groß genug, wie? Ruhig, mein Freund!«
Lane dreht sich fluchend um. Er sieht hinten seinen Bruder Lemmy erscheinen. Der kommt zu Pferd an. Er hat an den Händen noch die Spuren trockenen Sandes, bemerkt den warnenden Blick von Dexter und wischt sie an der Hose ab. Dann steigt er ab und grinst.
»Macht ihn los«, befiehlt Howard Vance. »Thayer, wir wollen freundlich zu dir sein und dich nicht erschießen, obwohl das auf allen Schildern steht. Wenn wir jedoch mit dir fertig sind, wirst du vielleicht wünschen, erschossen worden zu sein.«
Der alte Bill zuckt unmerklich zusammen.
Dieser Satan, denkt er voller Zorn, er läßt Cliff zusammenschlagen. Mein Gott, mit dem Revolver hätte Cliff eine Chance gegen sie gehabt, mit den Fäusten nie. Sie machen ihn fertig, er kann sich doch nicht richtig wehren.
*
»Verkaufst du jetzt?«
Die Stimme ist weit weg, sie dringt durch das immer stärker werdende Rauschen in seinen Ohren.
»Verkaufst du jetzt?«
Jemand rüttelt ihn. Für Sekunden starrt er in Dexter Lanes Gesicht und denkt wieder an Tyler. Der liegt irgendwo und kann immer noch nicht aufstehen. Haben sie gedacht, daß er den linken Arm nicht mehr bewegen könnte? Sicher, viel Kraft hat er nicht in diesem Arm. Aber steifhalten kann er ihn. Und sich dann blitzschnell drehen. Dann wirkt der Arm wie eine Keule. Das haben sie nicht gewußt, aber gesehen haben sie, wie der Krüppel plötzlich lossprang und sich drehte. Sie begriffen es erst, als Tyler einen gurgelnden Laut ausstieß und wie ein Klotz zu Boden kippte.
Dort drüben steht Lemmy Lane, das rechte Auge ist geschwollen, mit dem sieht er nicht mehr viel. Der hat auch nicht damit gerechnet, daß der Krüppel Cliff nicht nur halblahm, sondern in erster Linie ein Thayer ist.
Sekundenlang hat Cliff an seinen Vater gedacht und an dessen ständiges Gerede von Härte und Kampf, auch wenn man dabei sterben kann. Gewußt hat auch der Cliff Thayer nie, daß er so kämpfen könnte. Doch er hat es getan, und wie er es getan hat. Lemmy fehlen zwei Zähne, die klickern nun in seinem Magen herum.
»Wirf ihn hinein, Cole.«
Die Welt dreht sich, denkt Cliff Thayer. Ist verdammt lustig heute, würde Dad gesagt haben.
Es klatscht um ihn. Das Wasser ist noch kalt, und der Wind ist es auch. Als sie ihn herausfischen, schnattert er tüchtig. Schließlich steht er wieder. Jemand hält ihn von hinten. Von vorn wagt das keiner mehr, seitdem Dexter Bekanntschaft mit Cliff Thayers lahmen Bein gemacht hat.
»Thayer, verkaufst du jetzt endlich?«
Cliff spuckt aus.
»Dreckskerl, ich verkaufe nie.«
Rumms, da kommt was. Und gleich noch eine Ladung. Die verdaut er nicht mehr. Er liegt am Boden und hört wie durch Watte: »Hört auf, hört auf, ihr bringt ihn ja um, ihr Halunken! Er kann doch gar nicht verkaufen.«
»Halt den Mund, Alter!« faucht Cliff, »sei doch still!«
Ob Bill das hört?
»Was war das, er kann nicht verkaufen? Die Pest, packt den Kerl! Und jetzt sieh her, Cooley, sieh genau her! Ich binde ihn ans Lasso. Und redest du nicht, dann geht es weiter. Rechne dir aus, was am Ende davon übrig ist, Mann. Also, wie war das, er kann nicht verkaufen?«
»Macht Schluß, hört doch auf, dann rede ich!« stöhnt der alte Bill. »Das – das kann ich nicht mehr mit ansehen. Kilburn, du Schurke, wenn ich doch nicht deinen Colt im Nacken hätte.«
»Den kannst du gleich noch mal über den Schädel bekommen, wenn du wieder zu ihm hinrennen willst«, droht Kilburn eisig. »Spuck es schon aus! Weshalb kann er nicht verkaufen, he?«
»Weil – weil ihm die Ranch gar nicht gehört.«
»Waas?«
Howard Vance läßt das Lasso fallen. Der feige Strolch hat sich abseits gestellt, als seine rauhen Burschen mit Cliffs Behandlung anfingen, um bloß nichts abzubekommen. Er packt den Alten am Hemd.
»Mensch, mach’s Maul auf! Ihm gehört nichts? Bist du verrückt, du alter Trickser.«
»Ich sage die Wahrheit, Vance. Die Ranch gehört Ray Thayer, nicht ihm. Er kann ohne Ray gar nichts machen.«
Einen Moment steht Vance wie vom Schlag getroffen neben dem Alten. Dann aber packt er wieder zu und reißt ihn auf die Beine.
»Mann, heraus damit! Wo ist Ray? Wo ist der Kerl?«
»Das weiß keiner«, antwortet Old Bill wahrheitsgemäß. »Niemand hat es jemals erfahren. Als er damals wegging, warf ihn der Alte hinaus: Ray sagte, er würde nie wieder in dieses Land kommen. Gemeldet hat er sich auch nie.«
»Du lügst, Mensch. Der sollte sich nicht mehr gemeldet haben? Los, sage es! Wo steckt er?«
»Zuletzt soll er in Oregon gewesen sein, aber sicher ist das nicht. Kam mal einer hier vorbei, der sagte es. Wir haben nach Salem geschrieben, in der Gegend soll er gewesen sein. Der Sheriff in Salem soll nach ihm forschen, aber bis jetzt haben wir noch keine Nachricht von ihm oder Ray bekommen. Mehr wissen wir nicht. Vielleicht ist Ray längst tot.«
Ich werde diesem Strolch mitten ins Gesicht lügen, denkt der Alte voller Grimm.
»Ray war wie der alte Nat«, erzählt er weiter. »Stur wie ein Büffel. Wenn der mal was gesagt hat, dann bleibt er auch dabei. Er hatte es satt damals. Sie stritten sich, der alte Nat und Ray. Hätten sich bald geschlagen, so war das. Vielleicht kommt er gar nicht mehr, ich kenne die Thayers doch.«
»Mensch, das kann wahr sein«, sagt Vance fast überzeugt. »Also, ihr wißt genau, wo er ist. Das ist gut. Und verkaufen kann Cliff nicht? Na gut, ob ihr verkauft oder nicht, morgen besetzen wir die Südweide. Und versucht ihr dann was, kostet es euch allen den Hals. Laßt ihn liegen, den Narren.«
Sie blicken auf Cliff hinab, der sich nicht mehr rührt, als sie zu ihren Pferden gehen und aufsitzen. Einmal noch sieht sich Howard Vance nach dem alten Bill um.
»Die ganze Mannschaft treibt unsere Herde auf«, sagt Vance grimmig. »Wir stellen Wachen auf. Wer sich nähert, bekommt eine Kugel, Cooley. Verstanden?«
»Sicher«, antwortet Old Bill. »Versuch mal, ob ihr sie kaufen könnt. Die Bodenbehörde wird verdammt bohrende Fragen stellen.«
Vance lacht nur höhnisch.
»Du Narr«, stößt er verächtlich hervor. »Was weißt du davon, was man mit Geld alles anstellen kann, he? Man kann alles kaufen, Mister.«
Ja, denkt Bill Cooley bitter, Big Jims Geld macht krumme Wege gerade, ich weiß. Aber ihr werdet Wochen brauchen, um es zu schaffen. Bis dahin ist Ray da, ihr Banditen. Und der wird euch das Laufen beibringen. Er steht auf und schwankt los.
»Cliff«, sagt er stöhnend neben ihm und sieht auf dessen verschrammtes Gesicht. »Cliff, Junge, du hast gekämpft. Und wenn Old Nat dich gesehen hätte, dann wird er jetzt sagen, daß du mehr getan hast, als dich nur zu wehren. Jetzt wird er mächtig stolz auf dich sein, Junge. Großer Gott, das ist zuviel für einen alten Mann gewesen. Du hattest keine Chance, Junge, aber du hast um dich gebissen, so gut du konntest. Die hätten dich totschlagen können und doch kein Wort erfahren. Ich konnte nicht mehr hinsehen. Cliff, verstehst du? Tut mir leid, Junge, tut mir leid.«
Er krümmt sich neben ihm und beginnt am ganzen Leib zu zucken. So zerschlagen hat er noch keinen Mann gesehen. Und daß Cliff keine richtige Chance hatte, das machte alles noch viel schlimmer.
»Ich bringe dich weg«, sagt er nach einer Weile. »Wir haben ja ein paar Säcke auf dem Wagen, die mache ich voll Gras und lege dich darauf, Junge. Und dann decke ich dich zu. Ich schaff’s schon bis zur Ranch, Cliff.«
Der Alte torkelt davon, holt den Wagen. Mit einer Hand muß er Cliff hinaufstemmen, doch es gelingt. Schließlich hat er auch zwei Säcke voll Gras gestopft und wälzt Cliff darauf. Dann deckt er ihn zu. Nun wacht der Junge auf und stöhnt leise.
»Ich bin da«, sagt der alte Bill. »Keine Sorge, die sind weg, Cliff. Ich habe den Hundesohn angelogen, hörst du? Was hast du, frierst du, Junge?«
»Mir ist so kalt, Bill.«
»Ich decke dich zu, Cliff.«
Bill zieht die Jacke aus. Dann fährt er an.
Kalter Wind – und ein zerschlagener Mann, der im Wasser gelegen hat. Vielleicht bringt ihn das um, und nicht die Prügel.
*
Bill Cooley kauert nur noch auf dem Bock. Seine Schmerzen nehmen zu, aber geschafft hat er es längst. Er ist auf der Ranch gewesen, hat die Papiere alle eingepackt und das Federbett geholt. Jetzt liegt der Junge warm, er scheint sogar zu schwitzen.
Die Ranch, denkt Old Bill. Soll sie leerstehen, mir ist das gleich. Ich kann Cliff nicht auf der Ranch lassen. Vielleicht kommt der verdammte Vance auf die Idee, hier herumzuschnüffeln. Vielleicht will er Papiere suchen und Cliff noch mal fragen. Der soll nichts finden, nur mich. Ich reite bald zurück.
Der Alte sieht sich um, doch ihm folgt niemand. Vor ihm macht das Tal eine Biegung. Jetzt sieht er die Ranch vor sich, die Männer auf dem Hof. Jemand rennt los, als sie ihn so schief auf dem Bock liegen sehen. Dann sind sie alle da, und er erreicht mit dem Wagen das Ranch-Haus. Er blickt in das kreidebleiche Gesicht des alten Dawes, sieht, wie Joe und Abe Dawes einen entsetzten Blick wechseln.
»Bill, was ist passiert? Großer Gott, ist das Cliff oder ein Fremder?«
»Ich muß ihn zu euch bringen«, sagt Bill leise. »Sie könnten sich ihn noch mal kaufen. Dawes, kannst du ihn aufnehmen. Ich fahre zurück, oder ich reite wieder zur Ranch.«
Er erzählt all das, was sie wissen müssen.
»Verdammt, wenn sie die Südweide von euch besetzen, dann geben sie mir kein Wasser mehr«, sagt der alte Dawes. »Joe – Abe, holt die anderen Boys, es gibt Krieg! Sie sollen es haben, wie sie wollen, verdammt. Ich ducke mich nicht, ich nicht. Wenn Big Jim Streit anfängt, dann kann er ihn haben.«
»Warte, misch dich nicht ein, Dawes! Dreht er euch das Wasser ab, ist es immer noch Zeit, etwas zu tun. Big Jim ist schlau, er wird sich hüten, auch mit euch etwas zu versuchen. Ich wette, er gibt euch Wasser, damit Cliff nirgendwo Unterstützung bekommt. Das macht er vielleicht sogar schriftlich mit dir ab, Dawes, ich kenne den gerissenen Fuchs. Wollt ihr Cliff aufnehmen, obwohl es gefährlich werden kann für euch?«
»Was soll die blödsinnige Frage?« entgegnet der alte Dawes empört. »Wenn er Hilfe braucht, ob uns nun Big Jim Wasser gibt oder nicht, dann bekommt er sie von uns. Bis jetzt war ich nicht der Nachbar von Jim Vance. Ich weiß aber, was das bedeuten kann. Hol ihn der Teufel, den alten Knacker. Ich fürchte nur, daß Howard dahintersteckt, weniger der Alte. Los, faßt an, bringt ihn ins Haus.«
Das tun sie und kümmern sich auch gleich um Old Bill. Der sitzt ganz still und sieht zu, wie Missis Dawes mit ihrer Tochter Mona heißes Wasser in das Zimmer trägt, in dem Cliff nun liegt.
Bald danach kommt das Girl zu Bill, die Augen voller Tränen.
»Bill, wie konnten die ihm das antun? Er ist so ein guter Mensch. Und wie haben sie ihn zugerichtet. Bill, wie gemein sie gewesen sind, über ihn herzufallen, obwohl sie doch wußten, daß er nicht sehr viel Kraft hat.«
»Ja«, sagt er bitter. »Vergreifen sich an einem Krüppel, die Schurken.«
»Er ist kein Kruppel«, antwortet Mona Dawes heftig. »Warum nennt ihr Cliff immer einen Krüppel? Das ist gemein von euch allen. Er hat einen steifen Arm und ein gebrochenes und schlecht verheiltes Knie, aber er muß ja glauben, daß er kein vollwertiger Mann ist, wenn ihr alle so von ihm redet. Er ist ein viel zu guter und stiller Mensch. Und er ist viel klüger als ihr alle, und viel bescheidener. Die Tiere mag er, und Blumen, und jetzt haben sie ihn fertiggemacht, diese Teufel.«
Der alte Dawes hebt ganz langsam den Kopf. Seine Söhne sehen sich verstört an. Selbst Missis Dawes bleibt bestürzt im Gang zur Küche stehen.
Natürlich wissen sie, daß Mona oft von Cliff Thayer gesprochen hat. Manchmal, wenn sie drüben einen Besuch machten oder zusammen in der Stadt zur Kirche gingen, hat sie mit Cliff geredet. Und wenn er mal alle halbe Jahre hier auf die Dawes-Ranch kam, dann hat sie ihn so freundlich begrüßt wie keinen anderen Besucher.
So ist das, denkt Old Bill Cooley, das hätte ich nicht gedacht. War immer so still, der Junge, wenn er mit dem Girl redete. Manchmal sprach er dann zwei Tage kein Wort. Und wenn er dann was sagte, dann fragte er oft, ob es wohl schlimm sei, daß es mit seinem Bein und dem Arm nie besser würde. So ist das, jetzt verstehe ich. Der Junge hat Mona Dawes immer gemocht, aber er hat gedacht, er sei ein Krüppel und hätte kein Recht, sich irgendwelche Hoffnungen zu machen.
»Tochter«, sagt der alte Dawes, »Cliff ist sicher ein guter Mann, das wissen wir alle, aber…«
»Sagt nie wieder, daß er ein Krüppel ist. Ich will’s nie wieder von euch hören«, unterbricht sie ihn und preßt ihr Taschentuch vor die Augen. »Er ist ja zu still, um jemals etwas zu fragen oder ein Mädchen anzusehen. Cliff würde es nie wagen, den Mund aufzutun und einem Mädchen zu sagen, daß er es mag. Als wir Old Nat begruben, sah er mich an, und er war allein, ganz allein, das wußte ich. Ich wollte es ihm schon sagen, doch es war nicht der Platz und die Zeit dafür. Aber er soll es erfahren, wenn er wieder gesund ist. Er soll wissen, daß ich ihn mag und daß ich keinen anderen Mann haben will. Verstehst du jetzt?«
»Tochter!«
»Was denn?« fragt sie erregt und steht auf. »Er muß es gespürt haben, daß ich ihn mag. Und vielleicht hat er gedacht, ich hätte nur Mitleid mit ihm. Doch es war nie Mitleid und wird nie welches sein. Für mich ist er der beste Mann, den ich mir wünschen kann. Ich liebe ihn, damit ihr es wißt. Und jetzt laßt mich in Ruhe. Laßt mich, sage ich, sonst gehe ich hin, nehme mein Gewehr mit, Dad, und schieße Howard Vance, diesen Halunken, über den Haufen.«
Sie bleiben alle wie erstarrt sitzen und sehen, wie sie aufspringt und nach oben läuft.
»Mann, Mann«, stammelt Misses Dawes und kommt schluckend in die Küche. »Vater, hast du das geahnt?«
»Nein, nein, wahrhaftig nicht. Unsere Tochter, Mutter – wie sie mit uns redet? Das sitzt wohl mächtig tief, glaube ich. Habt ihr denn nichts gemerkt? Joe, du Esel – Abe, du Träumer?«
»Nun«, sagt Abe, der nur ein Jahr älter als Mona ist und mit ihr oft zusammensteckt, »ich hab’s gewußt, Dad. Sie hat es mir schon vor einem Jahr gesagt. Geheult hat sie, weil Joe über Cliff redete und ihn dabei einen verdammt armes Luder nannte.«
»Und du sagst mir nicht mal was?« fragt Joe Dawes vorwurfsvoll. »Du bist der richtige Bruder, Mensch. Hätte ich doch bloß mein Maul gehalten. He, ich gehe zu ihr. Was soll ich ihr sagen, Dad?«
»Mutter, was meinst du?«
Dawes sieht seine Frau an. Die lächelt plötzlich, tritt ans Fenster und wischt sich über die Augen.
»Ist ein feiner Bursche, der Cliff. Einen besseren Mann kann unsere Tochter nie bekommen, Vater.«
»Na ja, dann geht schon… Nein, ich gehe. So, und jetzt gebt Bill was zu trinken. Ihr bringt ihn nachher zur Thayer-Ranch hinüber und bleibt gleich da. Und wollen sie noch was, dann sagt ihnen, sie bekämen es mit uns und unseren Freunden zu tun. Laßt sie nur die Südweide besetzen, wir warten ab. Bill, bist du sicher, daß Ray bald kommen müßte?«
»Der kommt«, antwortet Bill. »Und wenn er da ist, werden sie es sehr bald merken. Es wird das letzte sein, was sie auf dieser Welt spüren, wette ich. Wir haben ausgerechnet, er könnte in vier Wochen hier sein, wenn er die Bahn nimmt und auf der restlichen Strecke reitet, ohne groß zu rasten. Es könnte zwei Tage früher oder später sein, aber so um die Zeit müßte er kommen. Es wäre gut, wenn sie nichts davon ahnten.«
»Ja«, stimmt der alte Dawes zu. »Wir reden nicht und wissen nichts. Verstanden, Jungs? Möchte wissen, was aus Ray geworden ist. Kommt er auf Nat heraus, dann haben sie einen wilden Tiger im Nacken.«
Was, denkt Old Bill Cooley, nur einen Tiger? Ich kenne doch Ray, ich kenne ihn besser als sie alle. Wenn er kommt und seinen kleinen Bruder so liegen sieht, dann gebe ich keinen Cent mehr für Howard Vance. Ray zerreißt ihn in der Luft und wirft die einzelnen Stücke unter die Geier. Mein lieber Mann, laß den Jungen sich nur den Jähzorn abgewöhnt haben, sonst bringt er sie alle um, ehe sie begreifen, daß das große Sterben angefangen hat. In einer Woche müßte er etwa hier sein. Es wäre gut, ich ritte ihm entgegen. So schlimm ist das mit dem Loch in meiner Schulter nicht. Die Kugel ist glatt durchgegangen. Bis dahin kann ich reiten, Ray müßte über Del Rio kommen. Bis Albuquerque geht die Bahn. Dann reitet er todsicher nach El Paso und von dort aus steil herunter, was? Ich reite nach Del Rio und fange ihn ab, damit ich ihn vorbereiten kann. Kommt der ahnungslos her und hört, was passiert ist, dann garantiere ich für nichts mehr.
*
Dean, der Schmied, hat tagsüber aufgepaßt und keinen gesehen, auf den die Beschreibung passen könnte. Zwar kennt er Ray, doch er kann sich verändert haben. Bill hat ihm ein Bild in die Hand gedrückt und gesagt, so sähe er aus. Sicher käme er mit der Stagecoach oder auf einem Pferd. Bis jetzt ist aber niemand nach Del Rio gekommen. Drei Tage sitzt der Alte nun hier. Er geht nur nachts aus dem Haus. Sonst hockt er oben in Deans Schuppen und kann den Weg fast zum Devils River einsehen. Vom Schuppen aus hat er auch den Blick frei auf die Main Street von Del Rio und die Postkutschen-Station.
Manchmal friert er, der alte Bill Cooley. Die Wunde brennt, und der Schmerz meldet sich oft. Aber er ist zäh und hat einen eisernen Willen. Für sein Alter ist er ungeheuer hart, er schont sich auch nicht.
Mitternacht ist längst vorbei. Bill Cooley befürchtet schon, Ray verpaßt zu haben. Wenn der Junge nun einen anderen Weg genommen hat? Dann wird er nach Hause kommen und die Ranch nur von den beiden Dawes besetzt finden. Er wird erfahren, was mit Cliff passiert ist und losziehen.
Sie schicken mir eine Nachricht, wenn er auftaucht, denkt Old Bill Cooley voller Verzweiflung, doch sie wird zu spät hier ankommen. Ein Tagesritt ist es von Del Rio nach Uvalde, ein ganzer Tag für einen schnellen Mann. Ich käme zwei Tage zu spät zu Ray. Wer weiß, was er in der Zwischenzeit alles anstellt, der Junge. In Del Rio ist alles ruhig, nur ein paar Wagen fahren noch die Straße hoch zur Grenze. Sonst rührt sich nichts. In einem der Saloons brennt noch Licht. Das ist alles.
Der Alte ist allein, gähnt verhalten. Bei jedem Hufschlag schrickt er zusammen, späht aus der Dachluke des Schuppens.
Ein Reiter kommt, treibt sein Pferd an den Laternen am Woodstone House vorbei, ist für Sekunden im hellen Lichtschein. Der Mann ist nur mittelgroß.
Bill Cooley sinkt zurück, stützt den Kopf auf, lehnt sich an die Wand.
Er ist schon in Uvalde, denkt er besorgt, sicher ist er schon dort. Einen anderen Weg genommen, wie? In der Mitternachtskutsche saß nur eine Frau. Und jetzt…
Er hebt den Kopf, hört den Hufschlag durch das Geklimpere eines Greasers, der auf einem Wagen mit zur Grenze fährt.
Der Alte steht still, hat den Mund etwas offen. Da drüben, der Mann auf dem Pferd. Wegen der Nachtkühle hat er einen Umhang umgeworfen.
Großer Gott, denkt der alte Bill; mein lieber Mann, drei Tage hast du gewartet und schon gedacht…
Der Mann drüben lenkt sein Pferd am Mietstall herum. Er macht es unter den beiden Laternen über dem Tor zum Mietstallhof und dem Vorbau des angrenzenden Saloons.
Drinnen klirren Gläser. Jemand singt irgendeine spanische Melodie.
Mein lieber Mann, denkt der Alte, da – da –
Er stolpert los, klettert die Leiter hinunter, ist schon im Hof. Als er auf die Straße kommt, steht nur noch das Pferd am Balken vor dem Saloon. Die Schwingtür pendelt gerade aus. Bill Cooley wird ganz weich in den Knien.
Der Junge, denkt er, jetzt ist der Junge da. Hol’s der Teufel, mir wackeln ordentlich die Knie. Man wird alt, was? Verrücktes Gefühl nach so vielen Jahren.
Innen sagt jemand, und Bill glaubt Old Nat mit seiner tiefen, harten Stimme reden zu hören: »Komm schon, ich hab’s eilig, Mister! Das beste Pferd aus deinem Stall, aber schnell!«
»Si, Señor, sofort. Warum so eilig, warum nicht ein Glas trinken?«
»Ja, schieb eins her.«
Aha, denkt Old Bill, wie Nat redet er. Macht nie viele Worte.
Er ist an der Tür, drückt sie langsam auf. Jetzt sieht er ihn, den riesenhaften Mann, der den Hut nach hinten geschoben hat und mit den Handknöcheln auf dem Tresen irgendeinen Takt trommelt. Der Mann am Tresen trägt ein dunkelrotes Hemd, eine schwarze Weste und schwarze staubige Hosen.
Als der Alte den ersten, schlurfenden und zögernden Schritt in den Saloon macht, wendet der Mann am Tisch langsam den Kopf. Er ist glattrasiert. Und seine hellen, unter starken Brauen liegenden Augen funkeln wie Feuer.
In der Tür steht einer – klein, krummbeinig, ein wenig schief und kümmerlich. Sein Bart ist zerzaust, und den Hut hält er in der Hand.
Hier bleibt er stehen, der kleine Bill Cooley. Die alten Knie schlottern ihm. Da habe ich nun beinahe sechs Jahre lang jeden Tag an diesen Jungen gedacht und mir vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich ihn wiedersehe. Dies ist nun das Wiedersehen. Und es kostet den alten Mann an der Tür eine ganze Menge Kraft, nicht loszubrüllen. Was sind das auch für Nachrichten, die er für den Jungen hat? Der Vater erschossen von Viehdieben. Der kleine Bruder halbtot bei den Dawes.
Bill, denkt Ray Thayer, aber hier? Mein Gott, ist er alt geworden, alt und… Warum steht er schief, warum ist die rechte Schulter dicker?
Ray denkt nicht mehr an das Glas, auch nicht mehr an sein frisches Pferd. Er geht los. Obwohl er ein Riese ist, geht er so leicht wie eine Katze, federt in den Knien durch.
»Bill!« stößt er freudig hervor. »Bill, Alter… Oh, verdammt!«
Das ist alles – nach sechs Jahren.
Bill nickt nur still vor sich hin, hat ein wenig Wasser in den Augen. Und das große, verdammte Schlucken im Hals. Die Hand Rays legt sich auf seine Schulter. Der Druck ist nicht zu hart, aber fest.
Eine halbe Minute stehen sie still und sehen sich nur an. Dann fragt Ray: »Was hast du da?«
»Ein Loch, Junge.«
»So, nun ja. Wo ist der Kleine?«
Der Kleine, er wird ihn wohl immer den »Kleinen« nennen, denkt der alte Bill. Für ihn ist Cliff nie etwas anderes.
»Bei den Dawes. Er ist ziemlich fertig, Junge.«
Der »Junge«, dieser Riesenbursche, ist längst ein richtiger Mann. Aber für Old Bill wird er eben auch nur »der Junge« bleiben.
Der Saloonkeeper, ein gebürtiger Greaser, tritt neugierig näher. »Der Brandy, Mister… eh, der Brandy!«
»Noch einen!« sagt Ray über die Schulter. Seine Augen strahlen Ruhe aus. Und doch ist der alte Bill überzeugt, daß jetzt tausend Gedanken durch Rays Kopf jagen. »Einen für Bill. Du trinkst doch einen mit?«
»Ja, Junge.«
Ray sieht sich nach dem Keeper um, zieht Bill mit an den Tresen.
»Mister, sieh dir meinen Gaul an. Das beste Pferd, das im Mietstall von Sanderson zu finden war. Ich will eins, das genausogut ist. Verstanden?«
»Si, Señor, ich sehe zu.«
»Taugt der Gaul nichts, bin ich in zehn Minuten wieder hier und werfe dich vor dessen Hufe. Begriffen? Versuche nicht, mir einen lahmen Gaul anzudrehen, Mister.«
Das klingt ganz ruhig, aber der Greaser erkennt, daß Ray genau das meint, was er sagt. Man gibt durchreitenden Burschen, die ihre Pferde in einem Mietstall wechseln, oft die schlechtesten Gäule.
Der Keeper schenkt ein, stellt die Flasche vor den beiden Männern hin. Dann geht er hinaus und pfeift durch die Zähne. Das Pferd am Balken ist wirklich gut. Gibt er dem riesengroßen Burschen im Saloon nicht ein gleichwertiges, könnte es mächtigen Ärger für ihn geben.
»Kannst du reiten, Bill?« fragt Ray am Tresen. »Weit genug?«
»Bin ja nicht zu Fuß hergekommen, oder? Da ging es mir noch schlechter, Junge. Sicher schaffe ich es. Ist nur ein kleines Loch, nicht der Rede wert.«
»Dann erzählst du unterwegs, wie?«
»Ja, Junge. Worauf trinken wir?«
»Darauf, daß ich bleibe.«
»Gehst nicht mehr weg?«
»Nein, ich bleibe.«
Der Alte nickt. Nun weiß er Bescheid.
In Uvalde sollte jemand seinen Gaul satteln und ihm Flügel anleimen. Vielleicht fliegt das Pferd dann wirklich mit Howard Vance weg. Er wird schon fliegen können müssen, denn sonst packt ihn bald jemand am Kragen.
*
Ein Bündel mehr auf Ray Thayers Pferd. Der Alte neben ihm stellt keine Fragen. Er hat Ray in Bracketville in den General Store gehen sehen. Dann kam Ray heraus und packte schweigend das Bündel auf. In Bracketville war es noch nicht Mittag.
Jetzt kommt die Abenddämmerung schon, die Nacht meldet sich an. Sie reiten immer noch, und sie reiten nicht schnell.
Er läßt sich Zeit, denkt der Alte, weil ich bei ihm bin. Warum hat er sich in Cline ein zweites Pferd geholt und nur gesagt, er brauche es noch? Er redet nicht viel. Genauso war es damals mit Nat, als er auf Jim Vance losging, da hielt Nat auch den Mund. Jetzt fehlt nur noch, daß der Junge dasselbe sagt wie damals Nat.
Drei Meilen noch bis Uvalde, und es ist Nacht. Klarer Himmel mit Milliarden Sternen über Südtexas. Irgendwo in der Nacht das klagende Heulen eines Kojoten.
Ray Thayer hat nur ein paar Fragen gestellt, als Bill ihm die ganze Geschichte erzählt.
Seit zwei Stunden sagt er nichts, er mustert nur ab und zu den alten Bill. Und er liest Sorge in Rays Augen, sagt jedesmal: »Ich kann noch, Junge, ich halte es aus.«
Ray hält jetzt an, die erkaltete Zigarre im Mundwinkel.
»Sagtest du, dieser Cole Lane hielte sich meist in der Stadt auf, um dort zu spielen?«
»Ja«, antwortet der Alte. »Er spielt fast jeden Abend in Mabel O’Henrys Saloon. Da gibt es eine ganze Clique, ein paar Burschen, Mexikaner von drüben, die jeden Abend die Karten austeilen. Junge, als ich wegritt, hatten sie schon die Weide besetzt, Kilburn, Tyler und Dexter Lane. Die anderen sind auf der Ranch, denke ich. Old Jim Vance läßt sie nicht von Howards Seite.«
»Bist du sicher?«
»Kann sein, daß es sich geändert hat, aber eins schaffen sie nie: Cole Lane aus einem Saloon und vom Spieltisch wegzubekommen.«
»Trägt er immer graue Anzüge?«
»Ja, habe ihn nie anders gesehen. Der Kerl hat schwarzes öliges Haar, er fällt gleich auf.«
»Gut, gut, Bill. Hier biegt der Weg zu den Nunns ab, nimm jetzt besser den.«
Der Alte sieht den Jungen erstaunt an.
»Was ist, ich soll dich allein lassen?«
»Ein Thayer braucht keine Hilfe, er kämpft allein.«
Cooley sitzt reglos im Sattel, glaubt sich um sechsundzwanzig Jahre zurückversetzt. Genau Nats Worte, genau dieselben. Gebraucht Ray sie nur, weil er sie so immer wieder von seinem Vater gehört hat?
»Ray, sie sind stark, sie sind viel stärker, als du glaubst. Kilburn ist eine Klapperschlange, rücksichtslos und verflucht schnell. Er klappert nur nicht, wenn er kommt. Ray, du kannst doch nicht allein auf sie losgehen.«
»Du reitest zur Ranch«, entgegnet Ray mit fester Stimme. »Nimm zwei Gewehre und schieß jeden nieder, der auf den Hof oder an die Gebäude will! Das ist ein Befehl! Es könnte sein, daß sie aus Wut die Ranch anstecken.«
»Großer Gott, Ray, du kannst doch nicht ganz allein auf sie losgehen. Was hast du vor? Sage es wenigstens, Junge.«
»Kein fester Plan. Ich richte mich nach dem, was sie tun werden«, erwidert er ernst. »Darum kann ich dir auch nicht genau sagen, was ich machen muß. Du sicherst die Ranch. Vielleicht helfen dir die Dawes-Jungen dabei. Sage ihnen, sie brauchten nichts zu riskieren, nur alles Gesindel von der Ranch wegzuhalten. Verschwinde jetzt, Bill, ich will es so!«
»Und – und wann kommst du zurück?«
»Morgen früh, wenn es glückt.«
»Junge…«
»Sei ruhig, Bill, ich weiß genau, was ich mache.«
Der Alte sieht ihn an, nickt kaum merklich. Diese Ruhe ist ihm unheimlich. Nat hätte den ganzen Weg über geflucht, aber sein ältester Sohn schweigt sich aus. Darin ist er nun doch anders.
»Sieh mehr nach hinten als nach vorn, Junge, hörst du?«
»Ja, sicher«, sagt Ray Thayer gleichmütig. »Hau jetzt ab, laß dich unterwegs nicht von den Kerlen schnappen.«
»Dann gib es ihnen, Junge.«
»Aha!«
Der Alte reitet zehn Yards, als er sich noch mal umblickt.
»Alter, ist Sheila auch im Saloon?«
»Warum? Sicher, sie ist oft unten.«
»Ist gut.«
Er lenkt das Pferd herum, reißt einmal kurz an der Longe des Ersatzpferdes. Dann reitet er an.
Mein Gott, denkt Old Bill Cooley, jetzt geht er auf sie los. Und ich kann nicht dabeisein. Genauso wollte es Nat damals, der brauchte auch keinen. Aber damals ist nicht heute. Damals hatte Jim Vance keine Revolverschwinger gemietet, nur ein paar harte Burschen wie Clay Jenkins, aber die waren ehrlich.
Warum hat Ray nach Cole Lane gefragt?
Ist das der erste Mann?
*
Jemand lacht, irgendein Girl aus der Front Street. Da wohnen lauter ehemalige Greaser. Und die Mädchen haben immer ein paar Freunde, von denen sie in den Saloons von Uvalde freigehalten wurden.
Laternen brennen in der Main Street, ein Hund kläfft. In O’Henrys Saloon klimpert das Walzenklavier die Melodie von Danny Smith herunter. Im Text heißt es, daß Danny ein Mädchen liebt und wegging, als es ihm untreu wurde. Seitdem reitet Danny und will vergessen, aber er schafft es nicht, er denkt immer noch an Eileen. Sie hieß Eileen, hatte rote Haare und einen lockenden Mund, und sie war nicht treu.
Das Lied schallt bis auf die Straße, über die ein Wagen fährt. Als der Wagen vor dem Drugstore von Knobb ist, kommt der Mann aus der dunklen Ecke am Mietstall. Er geht langsam, den Hut nach hinten geschoben, über die Straße.
Zwei Mädchen kichern, als sie aus dem Store kommen und den Mann mitten auf der Straße gehen sehen. Der Mann ist so groß, daß er ihnen auffällt. Sein Revolver ragt mit dem Kolben weit nach außen. Der Mann ist langbeinig und breitschultrig. Und er pfeift.
Das Pfeifen hört der Schmied Byrd. Der sieht den Mann drüben am Frachtkontor unter den Laternen auf den Gehsteig treten.
Licht fällt auf den Mann, der vor sich hin pfeift – die Melodie von Danny Smith und Eileen Roggers.
Mein Gott, denkt Byrd und macht ganz große Augen. Das ist doch – das ist doch… Früher hat er auch immer gepfiffen, wenn der Alte ihn mal in die Stadt ließ. Er hatte einen Spitznamen weg, sie nannten ihn schon in der Schule so: Whistling Ray Thayer, den pfeifenden Ray.
Der Mann kommt auf den Saloon und das Hotel von Mabel O’Henry zu.
Byrd steht ganz still und hält den Atem an. Gleich muß er den Mann von vorn sehen können. Noch drei Schritt, dann wird das Licht der Hotellaterne sein Gesicht zu erkennen geben.
Noch zwei, einen und…
Er ist es, denkt Byrd entsetzt. Großer Gott, der pfeifende Ray ist da. Er geht zu Mabels Saloon, jetzt steht er an der Tür. Das Walzenklavier hämmert…
Ray hebt die linke Hand, stößt leicht gegen den Türflügel und stellt das Pfeifen ein.
In diesem Augenblick tritt er in die rauchige Atmosphäre, in der es nach Brandy, Schweiß und Tabak riecht.
Das Walzenklavier hämmert. Der Mann kommt herein. Er blickt über den Tresen hinweg auf die Ecke hinten links. Dort war damals schon der Spieltisch unter einer mächtigen grünschimmrigen Petroleumlampe. Wenn der alte Nat über diese Ecke sprach, dann immer nur abfällig. Für ihn waren die Karten Teufelswerk. Und die Männer, die sie benutzen, Kartenhaie. Hätte sich jemals einer seiner Söhne in die Ecke gesetzt, wäre es zum Donnerwetter gekommen.
Am Tresen steht ein halbes Dutzend Männer. Zwei Mann von der Nunn-Ranch. Von den Weymillers und der kleine Charly Duty, den sie so nennen, weil er immer das Wort von der Pflicht im Mund hat, die ein Mann in seinem kurzen Leben zu erfüllen hat.
Zwei, drei unbekannte Gesichter. Die anderen reden gerade noch. Dann schweigen sie so abrupt, daß die Frau hinter dem Tresen den Kopf hebt. Sie ist noch immer eine faszinierende Erscheinung, diese Mabel O’Henry. Manche sagen, sie färbt sich ihr Haar mit Wasserstoff blond. Freundlich ist sie mit allen, darum ist der Saloon auch immer besetzt. An ihrer Seite steht – wie eh und je – der glatzköpfige Antony Laser. Er macht hier den Waiter, im Hotel den Diener und im Stall den Help. Antony ist für alles und jeden da.
Jetzt macht Antony Laser den Mund auf und vergißt ihn zu schließen. Der Mann blickt auf die Ecke und den Spieltisch. Das Walzenklavier hämmert immer noch dieselbe Melodie. Und der Mann pfeift nun wieder leise. So geht er weiter. Er sieht niemanden an, geht auf den Spieltisch zu. An dem sitzen drei Männer mit einem vierten. Die Lampe über dem Tisch wirft das Licht auf sein ölig glänzendes Haar.
Cliff, denkt der große Ray, Kleiner, ich bin jetzt hier und sehe eine Ratte. Scheint allein zu sein, dieses verdammte, pomadenbeschmierte Ungeziefer. Ratte hat Bill den Kerl genannt, und ich denke, der Name paßt. Sieht gut aus in seinem feinen Anzug, hat schlanke Finger, der Rattenabkomme. Mal sehen, ob die Ratte quieken kann, Kleiner.
Die Frau hinter dem Tresen wird kreidebleich. Ihr kommt der Mann plötzlich riesengroß vor. Viel breiter und größer, als sie ihn in Erinnerung hat. Der Mann pfeift immer noch und geht an einem Dutzend anderer Burschen vorbei, überragt den größten von ihnen noch um eine ganze Kopflänge.
Gleich ist die Hölle los, denkt der kleine Charly Duty. Allmächtiger, der große Ray ist da. Seinen kleinen Bruder sollen sie halbtot geschlagen und Old Bill angeschossen haben. Was wird das? Da sitzt doch Cole Lane, der gelackte Affe.
Ray Thayer pfeift noch immer, als er an den Tisch tritt und sich gegenüber von Cole Lane hinstellt. Rechts von ihm zwei Männer, links einen. Alles Greaser.
Einer sieht hoch, als der Mann am Tisch pfeift und furcht die Brauen. Der Spieler blickt in Ray Thayers Augen, ehe er etwas sagt. Dann erkennt er etwas in diesen Augen und schweigt lieber. Als er die Hand mit den Karten flach auf den Tisch sinken läßt, sehen sich die anderen beiden Männer an.
»Termino – esta noche!« sagt Ray Thayer und pfeift nicht mehr. Er sagt es ganz freundlich, als Cole Lane den Kopf anhebt und ihn verstört anblickt. »Schluß für heute, meine Freunde!«
Sie verstehen ihn alle, auch Cole Lane. Der hat spanisch von seiner Halbblutmutter gelernt.
Als die anderen drei feststellen, daß Ray sie kaum beachtet, sondern nur Cole Lane im Visier hat, steht der erste Spieler zaghaft auf. Die anderen blicken zu Cole Lane. Der ist nur einen Moment verwirrt.
»Verdammt, Mann, was soll das heißen? Niemand stört ein Spiel.«
»Ich kann das«, erwidert Ray freundlich. »Hallo, Lane.«
Die letzten beiden Worte schleppen sich träge dahin. Die drei Mann sind hoch.
»Vamos«, sagt der eine heiser und denkt, daß der verdammte Lane sie wieder mal ausgezogen hat. »Gehen wir.«
Ray lächelt vage, als Lanes Verwirrung wiederkommt. Der Bursche starrt ihn groß an. Sein Blick tastet zum Revolver. Aber Thayer hat die Hände locker herabhängen, stützt sich auf die Tischkante.
»Hast du gewonnen, Lane?«
»Ja«, sagt er wie selbstverständlich und doch mit einem bissigen Unterton. »Zum Teufel, was soll das? Ich kenne dich nicht, Mann.«
»Kann sich ändern«, klärt Thayer ihn freundlich auf. »Charly Duty, sage ihm doch mal meinen Namen. Ich bin zu faul zum Reden.«
Charly sträuben sich die Nackenhaare. Mabel O’Henry knetet das Poliertuch zwischen den Händen. Antony Laser steht der Schweiß auf der Glatze.
»Lane«, sagt Charly, und irgendwie hat er plötzlich das Gefühl grimmiger Freude in sich. »Mister, das ist ein Freund von dir. Er heißt Ray Thayer.«
Sie sehen alle auf Lane – alle. In diesem Moment setzt die Walze des Klaviers aus. Es klickert weit hinten am anderen Ende des Saloons. Dann ist es so still, daß man das Tropfen des Bierhahns hören kann.
Cole Lane mustert den großen Mann am Tisch. Der hört den Seufzer von Mabel O’Henry.
»Ray, mach nichts kaputt.«
»Aber Madam, ich werde doch nicht«, sagt Thayer sanft, und dann sieht er sich träge um, blinzelt ein wenig. »Ich will mich doch nur mit meinem Freund hier unterhal…«
Mehr sagt er nicht. Dafür handelt er im Bruchteil einer Sekunde. Aus den Augenwinkeln sieht er, wie Lanes Hand zuckt. Genau das hat er gewollt, aber der Narr Cole Lane fällt auf den Trick herein. Als sich Thayer umwandte, glaubte Lane zum Colt greifen zu können.
Seine Hand kommt auch wirklich bis an den Kolben und lüftet die Waffe leicht. Im gleichen Augenblick zucken Thayers Arme einmal, ohne daß Ray sich umblickt und sieht, was Lane vorhat.
Es sieht aus, als hätte Thayer eine kleine Fußbank und keinen schweren Tisch vor sich. Der Stoß befördert den Tisch gegen Lanes Brust und drückt den Mann samt Stuhl an die Wand. Lane prallt mit dem Hinterkopf hart auf. Seine Hand ist eingeklemmt und schmerzt wie verrückt.
»Mach sie lieber auf«, sagt Ray freundlich und drückt immer stärker. Lane läuft blaurot an. »Du solltest sie aufmachen, ehe dir die Rippen brechen, du Ratte.«
»Aaaah… Aah!« stöhnt Lane, der nicht die geringste Chance hat. »Ich – ich… Nein, aaah!«
Es poltert am Boden. Lanes Gesicht gleicht einer großen überreifen Tomate.
»Wie war das?« erkundigt sich Ray leise. »Fünf Mann gegen einen? Und der kann den einen Arm kaum bewegen. War das nicht so, Lane, du Ratte? Mein kleiner Bruder kann zudem nicht laufen, nicht schnell, mein Freund. Und jetzt liegt er und ist halbtot. Du warst doch dabei, Mister?«
Lanes Mund steht weit offen. Keuchend ringt er nach Luft, als Ray Thayer den Tisch zurückzieht. Sie sehen alle, wie er erleichtert aufatmen will und Ray Thayer im nächsten Augenblick den Tisch wieder ruckartig nach vorn stößt.
Cole Lanes gellender Schrei dringt durch den Saloon. Lane kippt jammernd nach vorn auf den Tisch. Da liegt er, die pamadigen, öligen Haare glänzen. Er hat das Gefühl, keine heilen Knochen mehr zu haben. Aber das ist erst der Anfang. Ray preßt seine Hüfte gegen den Tisch, läßt die Kante jetzt los und packt zu.
»Mein Bruder besaß keine
Chance«, sagt er. »Du hattest eine, du kleiner, schmutziger Dieb und Revolverschwinger. Jetzt lernst du den anderen Thayer kennen.«
Der Ruck kommt, und Lane brüllt, als stäke er am Spieß. Dann fliegt er auch schon über den Tisch hinweg, den Ray mit einem Hüftschwung zur Seite stößt. In der nächsten Sekunde steht Lane, droht aber einzuknicken.
»Hier bleibt alles heil«, sagt Ray Thayer und sieht kurz zu Mabel O’Henry hinter dem Tresen. »Keine Sorge, Madam.«
Im gleichen Augenblick zieht er Lane mit der linken Hand herum und schießt die Rechte ab. Durch die Gewalt des Schlages wird Cole Lane quer durch den ganzen Raum bis dicht vor die Tür befördert. In diesem Moment öffnet sich die schmale Tür neben dem Tresen. Jemand kommt herein und bleibt erschrocken stehen. Das Cepoltere, mit dem Lane zu Boden kracht, ist das einzige Geräusch im Saloon.
Lane will sich aufstemmen, er atmet abgehackt und sieht entsetzt, wie der Riese von Mann auf ihn zukommt. Japsend und nicht fähig, in der Hocke hocken zu bleiben, kippt Lane wieder um. Sein Mund steht schief, seine Nase sieht jetzt beinahe wie Lemmys Giebel aus. Er schmeckt Blut und versucht wegzukriechen. Etwas weiß Lane jetzt: der Mann dort braucht nicht zu schießen, der bringt ihn mit bloßen Händen um. Die wilde Furcht packt Lane so stark, daß er wie eine Spinne auf die Tür zukrabbelt und hinaus will, um jeden Preis.
Ray Thaver wendet kurz den Kopf zur Hintertür. Das Mädchen steht dort, die Hand halb erhoben, die Augen vor Staunen aufgerissen.
»Hallo, Miß O’Henry«, sagt Ray leise. »Hier ist eine Ratte im Saloon.«
Sie blickt ihn nur an. Und sie denkt plötzlich wieder an jenen Tag, als er sich mit Howard Vance unterhielt. Erst viel später erfuhr sie, daß er an diesem Tag gegangen war. Und sie verstand seine Worte. Seitdem hat sie oft an ihn gedacht. Wirkte er damals noch etwas verlegen und ungeschliffen, so ist jetzt davon nichts mehr zu merken. Der junge Bursche ist in der Zwischenzeit ein eisenharter Mann geworden. Er nickt jetzt kurz. Dann macht er drei lange Schritte und steht schon an Lanes Seite. Vor ihm die Tür, und draußen ein paar Leute. Das Geschrei Lanes hat sie angelockt. In der ersten Reihe der Schmied Byrd.
»Hinaus, Ratte!« sagt Ray Thayer zischelnd. »Raus mit dir, Mister, du verpestest die Luft hier drin! Komm, ich mache dir die Tür auf, so freundlich bin ich. Beinahe so anständig wie du. Du hast doch Bill Cooley getreten, oder? Er war verwundet und saß am Boden. Und du mußtest ihn treten, einen alten Mann? Kriech nur, Lane.«
Er kriecht tatsächlich. So will er hinaus, denn Thayer hält ihm tatsächlich die Pendeltür auf. Aber dann – Lane ist gerade mitten auf der Schwelle – fliegt die Tür zurück.
Cole Lane sieht nur eine dunkle Wand, als die Schwingtür auf ihn zukommt. Der eine Flügel rutscht schmerzhaft über seine Handrücken und prallt dumpf gegen seinen Kopf.
Er sagt nichts mehr, der Kartenhai und Revolverschwinger Cole Lane. Auf den Dielen bleibt er wie tot liegen.
»Ist mir doch die Tür aus der Hand gerutscht«, sagt dafür Thayer so ruhig, daß allen, die es gesehen haben, ein kalter Schauer über den Rücken kriecht. »Was hast du denn, du Totschläger, der sich an einem Mann mit gelähmten Gliedern vergreifen muß? Fehlt dir was?«
Er bringt ihn um, denkt Sheila entsetzt. Damals war er schon wild, aber heute… Sie haben seinen Bruder halbtot geschlagen. Seit Tagen spricht die ganze Stadt davon. Mein Gott, er bringt den Kerl um.
Vor ihr hebt Thayer den Kartenhai am Waffengurt mit einer Hand an. Dann sieht er sich um, blickt die Leute an, die zurückgewichen sind.
»Macht Platz, Freunde!« fordert er und trägt Lane wie eine Puppe an einer Hand über den Vorbau. »Er braucht eine Erfrischung, schätze ich. Wie konntest du auch nur die Frechheit besitzen, auf meinen Bruder loszugehen?«
An der Ecke steht die Regentonne. Und sie sehen alle, wie Lane in die Tonne fliegt und das Wasser nach allein Seiten wegspritzt. Dann saust Lane wieder auf den Vorbau. Er stöhnt und hebt matt den Kopf.
»Ich bin immer noch da, du Lump«, sagt Ray Thayer über ihm. »Paß auf, Ratte – lauf weg, so weit du kannst, am besten nach drüben zu deinen Verwandten! Und komm nie wieder in dieses Land, denn sonst bringe ich dich um!«
Ruckartig zieht er ihn hoch, hebt ihn mit beiden Händen an und stößt ihn im Bogen auf die Fahrbahn.
Lane rudert wie wild mit Armen und Beinen, landet mit dumpfen Aufprall im Staub. Als er sich aufstemmen will, ist Ray schon wieder neben ihm.
»Dort geht es nach Südwesten«, sagt er grimmig und reißt ihn erneut hoch. »Paß auf, wie schnell du aus der Stadt kommst, Strolch.«
Zweimal schlägt er zu. Lane fliegt rücklings auf die Straße und bleibt reglos liegen.
»Ray Thayer!«
Er wendet sich um, der Mann, dem es nichts auszumachen scheint, diesen Revolverschwinger aus der Stadt zu prügeln. Niemand weiß genau, was er denkt. Sie sehen ihn nur drei Yards vor Lane stehenbleiben. Und sie denken plötzlich alle an den mageren Cliff, den stillen, hinkenden Bruder dieses Riesen, den sie alle gemocht haben. Es gibt niemanden, der nicht Mitleid mit ihm gehabt hätte. Und es ist auch keiner da, der nicht weiß, daß Big Jim Vance die Südweide der Thayers besetzt hält. Solange der alte Nat lebte, hielten sich die Vances zurück. Mit Cliff Thayer konnten sie es tun, er war kein Gegner für Howard Vance und das Rudel rauher Burschen. Hier ist jetzt ein anderer Thayer, und er ist dabei, einen der Lanes aus der Stadt zu jagen.
Die Stadt sieht nur zu, sie mischt sich nicht ein. Die Leute haben Howard Vance nie gemocht, und noch weniger seine rauhen Burschen. Es gibt niemanden, der nicht heimlich auf der Seite der Thayers wäre. Und doch ist dieser Cole Lane nur der kleinste Mann aus jenem wilden Rudel um Howard Vance. Da ist Kilburn, in dessen Nähe niemand laut zu husten wagt. Und da sind die anderen.
»Lady?« fragt Ray und sieht sich um.
Sie steht auf dem Vorbau und blickt zu ihm. Ihr Vater war ein Vance, ein anderer als Big Jim, das weiß jeder hier. Sheila O’Henry hebt die Hand und deutet auf Lane.
»Ray Thayer, er hat doch keine Chance gegen dich.«
»Hatte Cliff eine?« fragt Ray grimmig zurück. »Ich sagte einmal, Sie wären zur Hälfte eine Vance, Lady. Bis heute gab es keinen, der ehrlich genug war, seine Fehler zuzugeben. Danke für die Belehrung, Miß O’Henry.«
Dann dreht er sich einfach um, seine Gesichtszüge verhärten sich. Zorn spiegelt sich in Ray Thayers Augen. Eine Vance, denkt er gallenbitter. So ist das, sie ist eine Vance, sie gehört zu diesem Clan. Vielleicht soll ich noch dulden, daß sie uns die Ranch anstecken und Cliff erschießen, wie? Ein Vance kann alles tun, die anderen haben zu gehorchen und auf dem Bauch vor ihm zu kriechen. Sie ist eine Vance. Und ich Narr dachte einmal…
Sein Blick wandert zu Byrd. Für Sekunden sieht er den Schmied durchdringend an.
»Byrd, wo ist sein Pferd?«
»Da vorn am Balken, Ray.«
Dort steht nur ein Brauner, ein Pferd mit schlanken Fesseln und breiter Brust. Schnell und ausdauernd, genau der richtige Gaul für einen Halunken.
Thayer macht drei Schritte, postiert sich neben Cole Lane. Der bewegt sich stöhnend, rollt auf die Seite und preßt die Hände vor sein Gesicht.
»Lane!«
Der stöhnt jetzt nicht mehr. Er läßt langsam die Hände sinken und sieht zu dem Mann hoch. Nackte Furcht spiegelt sich in Lanes Gesicht. Er zittert am ganzen Leib.
»Ich – reite weg«, sagt er mit vor Angst bebender Stimme und hebt die Hände abwehrend hoch. »Nicht wieder anfassen! Ich reite ja weg, ich komme nie wieder, Thayer. Hör doch, ich habe genug!«
»Steh auf!« sagt Thayer schneidend. »Hoch mit dir, du erbärmlicher Feigling! Und dann zu deinem Gaul, Mister! Steig auf und verschwinde! Du taugst nichts, du kannst nur im Verein mit anderen auf jemanden losgehen. Ich zähle, Lane. Bist du bei fünf nicht auf deinem Gaul, binde ich dich an mein Lasso und schleife dich aus der Stadt, wie ihr es mit Cliff gemacht habt. Eins – zwei…«
Cole Lane zieht die Beine an. Bei drei hockt er auf den Knien, bei vier ist er hoch und torkelt los. Er rennt stolpernd auf sein Pferd zu, als hätte er den Teufel im Nacken sitzen.
Ray Thayer zählt nicht bis fünf. Er sieht dem stöhnenden, davontaumelnden Revolverschwinger und Kartenhai nach. Der erreicht sein Pferd, greift nach dem Sattelhorn.
Im gleichen Augenblick sieht Sheila O’Henry vom Vorbau aus nach links und über die heranlaufenden Männer hinweg auf die andere Straßenseite.
Das Pferd steht drüben in der Gasse neben dem Mietstall. Im Sattel sitzt der Mann – ein Schatten nur, den kein Laternenschimmer erreicht. Der Mann sitzt im Dunkeln, das Pferd ist nur halb zu erkennen.
Und über den Kopf des Pferdes schiebt sich jetzt blinkend der Gewehrlauf.
Mein Gott, denkt Sheila O’Henry entsetzt, er schießt, er schießt auf Ray, der ihm den Rücken zuwendet.
»Ray, am Mietstall!«
Ihr heller, entsetzter Aufschrei schallt über die Straße.
*
Laut dringt der ballernde Gewehrschuß durch die Nacht. Eine Feuerlanze hinter Ray, die er noch während des Sprunges zur Seite erkennt.
Da landet Ray auch schon der Länge nach im Staub. Das Fauchen des über ihn hinwegzischenden Geschosses ist noch in seinen Ohren, als er bereits die Hand hoch hat.
Ray sieht nur das Pferd, den dunklen Schatten darauf, der zu klein für ein gutes Ziel ist. Blitzschnell drückt Ray ab, hört den Gaul drüben aufwiehern und steilen.
Fast gleichzeitig ist der Schrei des Mannes zu hören. Ray richtet sich auf, den Colt in beiden Händen. Der Gaul ist getroffen, geht jetzt durch.
Schieß, denkt Ray voller Grimm, schieß nur, du Narr. Auf dem Pferd kann kein Mensch mehr zielen. Bist du jetzt im Licht, Halunke?
»Tyler, es ist Tylerl« brüllt irgend jemand, der sich wie die anderen Leute flach auf die Straße oder den Gehsteig wirft. »Vorsicht, es ist Tyler!«
In diesem Augenblick ist das Pferd auch schon im Lichtkreis der Laterne drüben, springt hinein und will über die Straße. Im Sattel der Mann. Vom Licht getroffen, blinkt sein Gewehr. Deutlich ist er zu erkennen.
Du Narr, denkt Ray wütend und drückt ab. Der Colt in seiner Hand spuckt Feuer. Nicht von hinten, Mann.
Mitten im Galopp des wie verrückt durchgehenden Pferdes fliegt der Mann nach links. Einen Augenblick scheint er an der Flanke des Pferdes hängen bleiben zu wollen. Dann kracht er mit dem Oberkörper in den Staub. Der Gaul geht durch. Der Mann hängt im Steigbügel und brüllt vor Verzweiflung, als er den Fuß nicht aus dem Bügel bekommt. Das Pferd schleift ihn mit, bis Thayer zum zweitenmal feuert.
Aus vollem Sprung bricht das Pferd zusammen. Der Mann fliegt herum, saust flach über die Straße und bleibt in einer Staubwolke liegen, zehn Yards neben seinem Gewehr.
Tyler liegt auf dem Rücken, den Revolverarm schlaff nach hinten gedreht und ausgekugelt.
Ray Thayer stürmt auf ihn zu, den Colt in der Faust, bereit zu feuern, wenn Tyler nach dem Revolver greifen sollte. Doch Tyler wimmert nur in abgerissenen, krächzenden Lauten.
Als Ray neben ihm ist und ihm den Colt aus dem Halfter reißt, hebt Tyler matt den linken Arrn.
»Aufstehen!« befiehlt Ray. »Hoch mit dir, Tyler. Wo sind die anderen? Los, rede schon!«
Die Mündung des Colts bohrt sich in Tylers Magen. Ray hält den hinterhältigen Schützen mit einer Hand vor sich, sieht ihn aus funkelnden Augen bohrend an.
»Redest du bald? Wo sind die anderen?«
»Auf der Weide… Die Lanes… Südweide«, wimmert Thyler vor Schmerz los. »Ich – ich sollte Cole holen. Der Kerl ritt weg, ohne daß es ihm einer erlaubt hatte.«
»Und Kilburn?«
»Bei Vance – auf der Ranch. Oh, mein Arm, mein Bein…«
Die Kugel hat ihn im linken Oberschenkel erwischt. Er kann kaum stehen, droht einzuknicken.
Hinter Ray ruft in diesem Augenblick jemand: »He, Lane liegt an seinem Pferd!«
»Ich – ich kann nicht mehr stehen«, jammert Tyler. »Laß mich – doch – sitzen. Ich halt’s nicht aus, ich sterbe.«
Hinten am Vorbau laufen einige Männer jetzt zu dem Braunen von Cole Lane. Das Tier schnaubt unruhig, zerrt an den Zügeln und will los vom Balken.
Byrd ist einer der ersten, der sich nach Lane bückt. Der liegt auf dem Gesicht. Und auf seinem Rücken breitet sich langsam ein großer Fleck aus.
»Allmächtiger!« stammelt Byrd. »Sie standen in einer Richtung, Ray und dieser Kerl hier. Als Ray sich zur Seite warf, muß es passiert sein. Tyler, du Lump, du hast Cole Lane erschossen. Mitten in den Rücken, Mann.«
Ray Thayer blickt in das kreidebleiche, verzerrte Gesicht des Revolvermannes und läßt ihn los. Mit einem schiefen Stöhnen geht Tyler in die Knie. Er sinkt zu Boden und bleibt dort mit offenem Mund sitzen.
»Was – was ist?« fragt er lallend. »Das – das ist nicht wahr. Ich habe nicht auf Cole geschossen, ich wollte dich doch…«
»Rede nur weiter!« unterbricht Ray ihn. »Du wolltest mich von hinten erledigen, was? Aber dann hat deine Kugel den falschen Mann erwischt, Mister. Tyler, wieviel Mann sind auf meiner Weide außer den
Lanes? Antworte, Mensch, sonst...«
»Sechs aus Big Jims Weidemannschaft«, gibt Tyler verstört zurück. »Ich wollte ihn nicht treffen, doch nicht ihn. Er ist nicht tot – ihr lügt! Ich habe nicht auf ihn gezielt.«
»Er ist tot«, kommt Byrds tiefe, gepreßte Stimme vom Balken herüber. »Den macht niemand wieder lebendig.«
Tyler stammelt wirre Worte vor sich hin. Er scheint es nicht begreifen zu können, daß er Lane umgebracht hat.
»Jetzt braucht dein Partner sein Pferd nicht mehr«, sagt Ray Thayer über ihm. »Vielleicht nimmst du es und reitest zu seinen Brüdern, was, Tyler? Du kennst die Lanes doch, oder? Mann, ich möchte nicht mit dir tauschen. Was immer du auch machst, sie bringen dich dafür um, du Narr. Du bist jetzt schon ein toter Mann, Tyler.«
Er sagt es und wendet sich um. Dann geht er davon, und die Leute weichen ihm aus. Eine Gasse bildet sich bis zum Vorbau, auf dem Sheila O’Henry immer noch steht und dem Mann verwirrt entgegensieht.
»Danke«, sagt Ray unter ihr. »Lane hatte wirklich keine Chance, Sheila. Jetzt hat dein Onkel nur noch drei Mann, die einen Colt zu vermieten haben. Morgen früh hat er auch die nicht mehr, das schwöre ich dir bei Gott.«
Er tippt an seinen Hutrand und geht zurück über die Straße. Auf der Höhe von Tyler hört er dessen halbirres Gestammel: »Die bringen mich um, sie bringen mich um. Ich – ich muß weg, sonst machen sie mich kalt, diese Halbindianer, diese Lanes. Ich wollte doch nicht, wollte doch gar nicht…«
Tyler blickt sich gehetzt um. Die Leute sehen ihn an wie einen Aussätzigen. Niemand rührt sich, als er sich aufstemmt und loshumpelt.
Ich wollte ihn doch nur holen, denkt Tyler entsetzt, nur holen. Mein Geld, mein Lohn. Schnell zur Ranch, nur nicht auf die Weide. Komme ich ohne Cole zurück, denken Dexter und Lemmy sich ihr Teil. Ich bin zu fertig, um den beiden Burschen etwas vormachen zu können. Die merken es und legen mich auf die Nase. Mein Geld holen, und dann weg, nur weg.
Wie kam der verdammte Thayer so schnell zur Seite? Er begreift es immer noch nicht. Er hat doch auf Thayers Rücken gezielt, er war doch sicher, den Mann treffen zu müssen. Als Tyler sah, was auf der Straße passierte, verhielt er sich still, wartete auf seine Chance. Und die hatte er auch.
Cole Lane ist tot. Der erste Mann, der nichts mehr für einen Vance tun wird. Tyler ist der zweite.
Nur noch drei, die ihre Revolver vermietet haben. Nur noch drei…
*
Das Pferd kommt im Trott über den Kamm entlang des Tales. Der Mann im Sattel hat das Gewehr über den Knien, reitet durch das halbhohe Gras. Unter ihm ist die Herde, zweitausend Stiere mit dem V-Brand der Vance-Ranch. Sie grasen im Tal, durch das sich der Bach zieht. Hinter der Biegung beginnt das steilwandige Staubecken. Der Hang am Beginn des Beckens steigt sanft an. Auf der Kuppe liegt die Weidehütte der Thayers.
Jetzt stehen im Corral sechs Pferde. Und in der Hütte schlafen im Augenblick vier Mann. Die anderen vier reiten um die Herde. Sie patroullieren an beiden Hangseiten, bis sie jeweils am Nordzaun zusammentreffen. Die Gewehre schußbereit, die Männer selbst gespannte Aufmerksamkeit.
Der eine Reiter streift mit dem Pferd die Büsche, blickt auf die friedlich grasende Herde.
Unsinn, denkt der Mann im Sattel. Ich hab’s Jim gesagt, ich habe ihn gewarnt. Laß es, habe ich gesagt, laß es, Jim. Warum muß das jetzt noch sein, warum gibst du nach, wenn der Junge es verlangt? Wir sind beide alt, Jim, und wir haben doch genug. Oder du nicht?
Schon seit Tagen gehen ihm tausend Gedanken durch den Kopf, dem alten Clay Jenkins. Dies hier ist keine Arbeit für einen alten Mann, der sein Leben lang nur für die Vances da war. Treu sein und seine Pflicht tun, Befehle ausführen wie immer. Damals war es so, vor sechsundzwanzig Jahren ungefähr. Da war er schon einmal mit seiner Herde hier und mußte doch wieder abziehen. Damals war er noch stark genug, keiner Sache auszuweichen. Er hätte auch gekämpft, aber Big Jim schickte jemanden mit einem schriftlichen Befehl heraus. Ich habe immer gehorcht, auch jetzt.
Clay, hat er gesagt, der alte Jim, diesmal packen wir es. Aber ich muß mich auf deinen Rinderverstand verlassen können, wenn wirklich etwas kommt. Diese Revolverschwinger können schießen, doch von Rindern verstehen sie nicht genug. Du hast das Kommando auf der Weide, Clay. Bring die Herde hin und paß auf. Verstanden?
Verstanden, denkt der alte Jenkins düster, habe ich schon, aber den Sinn nicht begriffen. Vielleicht, weil ich damals nicht von Nat Thayer verprügelt und zerbrochen worden bin, wie? Kann sein, daß es der Haß in Big Jim gewesen ist, kann schon sein. Aber ich glaube nicht, daß es Big Jims Idee war, Howard hat ihn bequatscht, der verdammte Lümmel. Ich weiß nicht, mit dem Burschen stimmt etwas nicht. Der haßt die Thayers noch mehr als Big Jim. Bestimmt aber seit dem Tag, als er von Ray die Prügel bezogen hat.
Clay Jenkins hält unterhalb der Hütte an, schüttelt den Kopf. Er möchte die beiden Lanes etwas fragen, doch er befürchtet, danach vielleicht umgebracht zu werden. Dort oben schlafen die beiden Halunken, die der alte Jenkins nicht riechen kann. Sie stinken ihm, das wissen sie auch genau. Ein Mann kämpft offen, nicht wie diese Kerle von der Grenze, die Howard sich geholt hat.
»So ist das«, murmelt er vor sich hin. »Da schlafen sie, diese widerlichen Kerle. Big Jim mag sie so wenig wie ich, aber er braucht sie, sagt er. Auf mich hört er nicht mehr. Und stirbt er eines Tages, bin ich die längste Zeit auf der Ranch gewesen, das ist mir klar. Howard will allein regieren, der braucht keinen Vormann mehr, keinen wie mich. Geht mit den Burschen auf Cliff Thayer los, der Idiot. Und keiner sagte mir vorher etwas, nicht mal Big Jim. Was wäre auch gewesen, wenn ich meine Meinung gesagt hätte? Sie hätten doch nicht auf mich gehört. Seitdem der alte Nat tot ist…«
Ferguson, einer seiner Männer taucht auf, kommt heran.
»Clay, alles ruhig, was?«
»Ja«, sagt der alte Jenkins. »Paß aber auf, Ferguson, nicht träumen, Mann. Irgend etwas macht mich heute verrückt. Cooley ist weg.«
»Na und?«
»Keiner weiß, wohin er ist. Erfahren haben wir nichts, Ferguson. Bill Cooley hat eine Wunde in der Schulter. Aber ich kenne ihn, der ist zäh wie eine Katze. Wohin ist er, warum taucht er nicht wieder auf?«
»Clay, vielleicht ist er zum Sheriff nach San Antonio? Kann doch sein, oder?«
»Zum Sheriff? Der nicht, nie«, gibt der alte Jenkins zurück. »Das hier geht keinen Sheriff etwas an, sage ich dir. Die brauchen keinen. Irgendwas stimmt hier nicht, Mann, ich sage es dir. Paß scharf auf, sage es auch den anderen! Ich sehe mich mal um.«
»Clay, du siehst Gespenster.«
Der Alte antwortet nicht. Er reitet den Hang hoch, kommt an den Corral, umrundet ihn. Unten glitzert hinter der Biegung das Wasser im Staubecken. Links von ihm sind die Bäume an der Hütte.
Gespenster? denkt der alte Clay Jenkins. Ich sehe Gespenster, was? Das verdammte Gefühl will nicht weichen, daß etwas im Anzug ist. Vielleicht haben sie mehr Geld, als Big Jim glaubt. Dann kommt Bill Cooley mit einem halben Dutzend rauher Burschen wieder, he? Oder sollte er doch wissen, wo Ray Thayer steckt? Ich hab’s Big Jim gesagt, daß er einen Fehler gemacht hat, als er die Sache anfing. Jetzt ist sie längst zu groß geworden, ein Zurück gibt es nicht mehr. Und wenn Cooley nun Ray geholt hat oder ihn sucht und herbringt, was dann? Hier oben kann schnell die Hölle losbrechen, verdammt schnell.
Clay Jenkins sieht sich um.
Nur die Rinder muhen.
Nirgendwo ein Schatten zu sehen, kein Reiter.
Der alte Vormann reitet zurück an die Herde. Als er fort ist, raschelt es im Gras. Der Schatten schiebt sich auf den Corral zu, kommt ganz langsam hoch, steht geduckt am Doppelpfosten des Gatters. Dann hebt er es aus, setzt es ab und lehnt es gegen die Pfosten.
Jetzt wird das erste Pferd, das gegen das Gatter rennt, die Stangen umwerfen. Und dann kann es hinaus.
Der Schatten schmilzt zusammen, dann ist er verschwunden.
Nur das Gras raschelt noch. Ray Thayer ist schon da.
*
Die Rinder muhen, als Ferguson hinten am Wendepunkt auf seinen Partner Londsdale stößt.
»Na?« fragt Londsdale. »Clay gesehen?«
»Ja, er reitet herum und ist verdammt unruhig«, antwortet Ferguson achselzuckend. »Möchte wissen, was hier passieren soll. War er etwa auch bei dir?«
»Ja, gerade«, erwidert Londsdale. »Er hat Adam gesagt, er solle die ganze Südflanke allein abreiten. Clay will sich gründlich umsehen Allmählich wird er alt und nervös, was?«
»Er war nicht dafür«, sagt Ferguson. »Na ja, was geht es uns an? Wir führen Befehle aus, das ist alles. Dann paß auf, daß du nicht aus Versehen auf Clay feuerst.«
Sie schwenken, kehren um. Hinter ihnen ist alles ruhig, auch am letzten Zaun zur Nordflanke hin, der das Tal sperrt. Dort drüben kommt jetzt Adam, der vierte Mann, von seinem Streifritt an den Wendepunkt. Er reitet weiter, als er Clay Jenkins in etwa sechzig Yards Entfernung an der anderen Hangseite im Zickzack reiten sieht.
»So alt er ist, er zeigt keine Müdigkeit«, murmelt Adam leise vor sich hin. »Clay reitet jede Nacht über sechs Stunden, der gönnt sich keine Ruhe.«
Clay Jenkins entfernt sich immer mehr. Er stößt jetzt in das Buschgelände vor und hält auf dem Weg. Von hier aus kann er das ganze Tal überblicken. Er sieht, wie Adam hinten mit Londsdale zusammentrifft und schwenkt. Dann nimmt der alte Clay die Zügel hoch.
Der Bach, denkt der Alte, daß ich daran nicht gedacht habe. Wenn jemand an die Herde will, dann braucht er nur durch den Bach zu waten, ohne gesehen zu werden. Dort stehen Büsche genug, die ein halbes Hundert verbergen können.
Der Alte lenkt sein Pferd herum, steigt am Bach ab und geht ans Ufer. Er ist etwa sechzig, Yards von den Rindern entfernt und sucht nach Spuren. Doch er findet keine. Träge und plätschernd sucht sich das Wasser seinen Weg in das Staubecken.
»Komm«, sagt Jenkins und nimmt sein Pferd an die Zügel. »Gehen wir mal weiter, was? Vielleicht ist doch in der Nähe des Zaunes etwas? Verdammte Unruhe, ich werde sie nicht los.«
Langsam nähert er sich dem Sperrzaun, der wie eine Barriere mitten durch den Bach verläuft. Einzelne Büsche stehen rechts und links. Der Alte versucht die Schatten zwischen ihnen zu durchdringen. Er zieht sein Pferd nach, ist auf zwanzig Yards an den Zaun heran und lauscht.
Nur die Rinder muhen vor ihm. Er kann ihre dunkle Masse sehen und geht langsam weiter.
Nichts, denkt er, nichts, was…
Direkt hinter seinem Pferd wächst der Schatten blitzschnell hoch. Der Mann hat im Gras und unter Buschzweigen flach am Boden gelegen und den Gaul vorbei gelassen. Jetzt macht der Mann zwei lange, wilde Sätze.
Im nächsten Moment steht er genau hinter dem alten Clay. Der hört irgend etwas, vielleicht einen raschelnden Zweig oder knisterndes Gras. Aber das können auch die Hufe des Pferdes verursachen.
Das denkt er noch, der Alte. Aus dem Gefühl seiner Unruhe heraus wendet er den Kopf und sieht den Mann groß und breit hinter sich stehen.
»Tut mir leid, Clay«, sagt der Mann zischelnd. »Warum kommt ihr her?«
Und dann schießt seine Faust heran.
Ray, denkt der alte Clay Jenkins, Ray Thayer.
Der Schlag trifft ihn mit der Gewalt eines Schmiedehammers haargenau am Kinn. Einmal prustet das Pferd, als der alte Vormann von Big Jim
Vance umkippt und in einen Busch stürzt. Doch es bleibt mit hängenden Zügeln stehen.
Blitzschnell greift Ray Thayer nach den Zügeln. Er wirft nur einen kurzen Blick auf den alten Jenkins, dann bindet er das Pferd an einen Buschzweig und reißt den Alten hoch. Er trägt ihn zwischen einige Büsche, kniet neben ihm und zerrt ihm das Halstuch herab. Als er es ihm in den Mund gestopft und den Alten gebunden hat, macht Clay Jenkins wieder die Augen auf.
Er sieht mitten in Ray Thayers Gesicht.
»Aus für euch«, sagt Ray grimmig. »Clay, tut mir leid, ich schlage nicht gern einen alten Mann. Ich werde jetzt eure Herde aus meinem Tal jagen. Und ich werde es so rauh machen, daß ihr für alle Zeit das Wiederkommen vergeßt. Du bist immer ein kluger Mann gewesen, Clay. Warum hast du Jim nicht aufgehalten? Man kann nicht nur immer gehorchen und Befehle ausführen. Tut mir leid für dich, Alter.«
Clay Jenkins sieht ihn nur an und friert erbärmlich, als sich Ray bückt und einen kleinen Packen aufhebt.
Er ist allein, denkt der Alte verblüfft, der geht ganz allein auf uns alle los, genau wie sein Vater. Was hat er da? Großer Gott.
Ray Thayer reißt den Packen auf. Er zieht etwas heraus, auf das der alte Jenkins voller Furcht und Entsetzen stiert. Jenkins möchte schreien, losbrüllen und die anderen warnen. Aber der Knebel sitzt zu fest. Das Frösteln packt den Alten stärker, als Ray unter die Decke kriecht, mit der der Packen umhüllt gewesen ist.
Gleich danach kommt Ray wieder hoch. Er hat eine Zigarre im Mundwinkel und blickt den Alten an.
»Jetzt lernt ihr es«, sagt er dumpf. »Ich fange an, Clay. Und wenn ich mit euch fertig bin, seid ihr entweder tot oder so weit gerannt, daß ihr für alle Zeit Frieden geben werdet. Jetzt fange ich es an, mein Freund.«
Nein, nein, denkt der Alte, das kannst du nicht tun, Ray, das nicht. Du wirst die Herde… Nein, Ray.
Aber der ist schon weg. Das Pferd des alten Clay schnaubt. Dann erscheint es für Augenblicke. Im Sattel sitzt Clay Thayer zusammengekauert und jetzt so klein wie der alte Jenkins.
Sie erkennen ihn nicht, selbst nicht auf zwanzig Yards Distanz, fährt es dem Alten durch den Kopf. Sie werden glauben, daß ich es bin, der dort reitet. Großer Gott, sie haben keine Chance, er erledigt sie alle, wenn er will. Auf die Idee, daß ich es nicht sein könnte, der hier reitet, kommen Londsdale und Adam nie. Jetzt macht er aus diesem Tal eine Hölle.
Die Herde ist verloren.
*
»Er sucht dahinten am Bach herum«, brummt Londsdale und wechselt einen Blick mit Adam. »Was er bloß finden will, hm? Nun gut, kehren wir um.«
Sie schwenken. Der eine nimmt die Südflanke links, der andere reitet rechts von der Herde aus den Hang weiter. Ihre Stimmen sind bis zu Clay Jenkins gedrungen. Vergeblich hat der Alte versucht, sich zu rollen und gegen einen Busch zu treten. Sie haben nichts gemerkt, sie haben Ray Thayer für den Alten gehalten, diese Narren.
Jetzt sind sie weg. An der Nordseite des Tales ist kein Wächter mehr.
Er kommt, denkt der Alte, und die Furcht treibt ihm den Angstschweiß aus allen Poren.
Der Hufschlag wird lauter. Der Reiter ist vorbei und hält an. Dann greift er in die Jagdtasche, die er sich umgehängt hat. Im nächsten Augenblick hebt er die Hand zum Mund, beißt fest auf die Zigarre, Glut taucht wie ein glimmender roter Punkt in der Nacht am Sperrzaun auf.
Es zischt eine halbe Sekunde später. Funkensprühend frißt sich die Flamme ihren Weg.
Der Mann holt aus, schleudert das Ding im weiten Bogen mitten unter die Rinder. Dann hat er bereits die zweite Patrone an der Zigarre. Glut brennt in seinen Handschuh ein Loch. Er achtet nicht darauf. Er schleudert die zweite Patrone weg, die dritte, vierte.
Dann reitet er scharf an und nach links. Dort ist nur ein Mann. Der wird drehen, sobald es laut wird, dann kommt er zurück.
Komm, denkt Ray und knirscht mit den Zähnen. Komm nur, Mister.
Leicht geduckt sitzt er im Sattel, das Gewehr in der Faust.
Und dann…
Mit einem brüllenden Krach, der den Luftdruck bis weit über Ray Thayer schleudert, schießt ein Riesenblitz am Ende der Weide hoch. Grell flammt eine Feuersäule gegen den Nachthimmel, zuckend huscht der Schein wie die Helligkeit eines Gewitterblitzes über die Herde hinweg.
Rinder wirbeln durcheinander, andere brüllen, blöken, sind blitzschnell hoch. In diesem Augenblick kommt von links die zweite Detonation. Der Donner hallt über das Land wie nach dem Abschuß einer schweren Haubitze.
Vorbei ist es mit der Stille. Rinder stieben überall los, rasen nach Süden durch das Tal. Als die ersten Tiere muhend davonrennen und in blinder Panik über andere hinwegtrampeln, gehen die Druckwellen der nächsten beiden Explosionen über die Herde hinweg.
Sie kommen so schnell, daß ihre Schläge ineinander überzugehen scheinen. Die Masse der Herde ist hoch. Von Norden her rast in die verwirrte, quirlende, brüllende Masse Stiere jenes halbtaube, zum Teil verletzte Rudel hinein, das am Nordzaun gelegen hat.
Beim ersten Knall ist Adam herumgewirbelt, stößt einen durchdringenden Schrei aus. Der Luftdruck fegt neben ihm über die Büsche hinweg und reißt ihm den Hut vom Kopf. Unter Adam krümmt sich das Pferd zusammen.
Mein Gott, denkt der Cowboy entsetzt, was ist das?
Der zweite Blitz schießt schon hoch, der dritte, der vierte…
Nach hinten, denkt Adam voller Schreck, nach hinten. Da war doch Clay, da war doch gerade noch…
Er drückt dem Pferd die Hacken in die Weichen, bringt es herum und prescht los. Im nächsten Moment sieht er das Pferd von Clay zwischen den Büschen auftauchen. Es ist zwar Clays Gaul, aber der Mann darauf…
»Verdammt, das ist doch nicht Clay!« brüllt Adam los und reißt sein Gewehr hoch. »Das ist doch nicht…«
Vor ihm der Blitz, ehe er abdrücken kann. Sein Pferd steigt mit einem schmetternden Gewieher steil hoch. Dann kippt es zur Seite.
»Yeeeh – Yeeeh!«
Weit hallt der Schrei vor Adam. Der Cowboy liegt am Boden, hat beim Sturz sein Gewehr verloren und kommt halb benommen auf die Knie.
»Yeeeh – Yeeeh!«
Das Pferd rast genau auf ihn zu. Er sieht die weiße Blesse von Clays Gaul heranschießen und hört den schrillen, anfeuernden Schrei des Mannes im Sattel.
Mein Revolver, denkt Adam.
Der Gaul ist schon da, galoppiert keinen halben Yard an ihm vorbei, als Adam den Revolver gerade heraus hat.
»Narr!« faucht der Mann über ihm und wirbelt sein Gewehr herum. »Narr, zum Teufel mit euch!«
Adam wird auf den Rücken geschleudert. So bleibt er liegen, keine dreißig Yards von seinen Rindern entfernt.
Der Mann reißt sein Pferd herum und prescht zurück. Jetzt steckt das Gewehr im Scabbard. Dafür greift er wieder in die Tasche.
Als Londsdale in diesen ersten fünfzehn Sekunden brüllend vor Schreck anhält und Ferguson heranrast, können sie bereits nichts mehr tun.
»Sie gehen durch!« brüllt Londsdale mit überschlagender Stimme. »Ferguson, sie brechen aus!«
»Bin ich blind?« fährt ihn Ferguson wütend an. »Was hältst du noch lange Reden? Los, an die Flanke! Schieß, Mann!«
Es ist vergeblich, als sie das versuchen. Die ganze Herde ist jetzt hoch und rast in das Tal hinein. Einige Augenblicke später stampfen die ersten Rinder den südlichen Sperrzaun nieder.
Londsdale und Ferguson jagen rechts der durchgehenden Masse dahin. Sie schießen in die Luft oder den Stieren vor die Hufe. Doch sie erreichen nur, daß die Rinder nicht an dieser Flanke aus dem Tal rennen. Der Boden scheint zu schwanken, die Erde dröhnt und bebt unter achttausend Hufen. Eine immer dichter werdende Staubfahne wallt aus dem Tal hoch und legt sich wie ein Grauschleier auf die Hänge.
»Sie rennen gegen den Damm an!« brüllt Ferguson. »Londsdale, sie rasen in das Staubecken und brechen sich die Hälse. Zum Damm, Mann, schnell!«
Im gleichen Augenblick faucht der Blitz über sie hinweg. Zweimal kracht es ohrenbetäubend hinter der davonrasenden Herde.
Das ist die Hölle.
Obwohl kaum anderthalb Minuten vergangen sein mögen, ist die Herde schon in voller Stampede. In das Dröhnen und Trommeln der Hufe mischen sich markerschütternde Schreie. Zwei, drei Dutzend Rinder sind beim Anrennen gegen den Zaun gestürzt. Andere wälzen sich nun über sie hinweg. Keine achtzig Yards weiter ist der obere Staudamm, ein steil aufragender Erdwall, gespickt mit hervorstehenden spitzen Steinen. Dahinter geht es in die Tiefe.
Londsdale und Ferguson jagen auf den Damm zu, um eine Katastrophe zu verhindern. Sie wissen beide zu gut, daß sich die Stiere hinter dem Steilabfall die Hälse brechen werden. Die Herde kommt, jagt donnernd links am Damm vorbei und drängt jetzt in breiter Bahn auf die Weidehütte zu.
Während Ferguson feuert und die Rinder wenigstens dem tödlichen Steilabhang des Dammes ausweichen, brüllt Londsdale voller Furcht: »Sie rennen die Hütte um, sie rasen genau gegen die Hütte an! He, wo sind die anderen?«
Wo sind seine Partner?
*
Die Hütte bebt unter den vier wilden, brüllenden Schlägen, die die Nachtstille jäh zerreißen. Das eine Fenster klirrt, als wolle es fast zerbrechen.
Mit einem Schrei fährt Pablo, einer der Ranchhelps, hoch. Als er von der oberen Pritsche springt, landet er auf dem wild fluchenden Dexter Lane. Der wird wuchtig und unvorbereitet zu Boden gedrückt. Pablo wälzt sich herum und stößt mit den Beinen gegen den Ofen. Der schwankt, das Rohr löst sich aus der Wand und fällt polternd über den Tisch. Die dabei mitgerissene Lampe kollert Lemmy Lane zwischen die Beine und läßt den knicknasigen Burschen wütend losschreien.
In der Hütte ist der Teufel los. Sie brauchen zwanzig Sekunden, ehe sie die Tür aufstoßen. Thorpe, der vierte Mann, wirft sich hinaus. Er sieht irgendwo links und rechts einige Schüsse aufblitzen. Unter ihm tobt die Herde. Ihre dunkle Masse wälzt sich direkt auf den Zaun zu.
»Raus!« krächzt Dexter Lane hinter Thorpe. »Verflucht, geh doch von mir runter, du Idiot! Was kriecht der Kerl hier herum? Lemmy, raus hier, los!«
Lemmy hat den Fall über das verdammte Ofenrohr gerade hinter sich. Er sucht irgendwo nach einem Halt, erwischt die Bank und reißt sie um. Jetzt liegen ihre Waffen am Boden.
»Pablo, schnell!«
Pablo ist der zweite Mann, der aus der Tür hetzt. Er hat keine Stiefel an, stürzt ins Freie und erkennt die Situation auf Anhieb.
»Zum Corral!« ruft er heiser. »Schnell, Thorpe, die Pferde nehmen!«
Er reißt seinen Sattel vom Haken an der Außenwand und stürmt auf den Corral zu. Dort jagen die Pferde im Kreis herum. Ehe Thorpe und Pablo das Gatter erreichen, kippt es bereits um. Über die umfallenden Latten hinweg rasen die ersten zwei Pferde hinaus.
»Halt, brrr!« brüllt Thorpe und reißt die Arme hoch, springt den Pferden in den Weg. »Halt, halt, zurück!«
Im nächsten Moment bringt ihn nur noch ein schneller Sprung zur Seite aus der Bahn des herausstürmenden Pferdes. Hinter Thorpe aber ist Lemmy Lane herangekommen. Er sieht noch, wie Thorpe zur Seite hechtet. Dann kommt der Gaul auch schon und rammt Lane, ehe er abducken oder wegspringen kann, schleudert ihn im Bogen rücklings weg.
Lemmy Lane fällt seinem Bruder Dexter genau vor die Stiefel. Dann schreit er gellend los. Sein linker Arm bricht, als Lane über einen Stein geschleudert wird. Wimmernd rollt sich der Revolverschießer herum.
»Dexter!«
»Die Pferde«, sagt Dexter Lane verstört und sieht, wie es Pablo gelingt, einem Gaul an die Trense zu springen und das Pferd zu halten. »Sie gehen durch. Haltet unsere Pferde…«
Er stürzt vergeblich auf den Corral zu. Dort hat es jetzt auch Thorpe geschafft. Ihm gelingt es jedoch nicht mehr, den Sattel auf den Gaul zu werfen. So schwingt er sich auf den Pferderücken, drückt die Hacken ins Fell und jagt hinter Pablo her aus dem leeren Corral. Die anderen Pferde sind auf und davon, ehe die Lanes eines erwischen können.
»Dexter!« kreischt Lemmy schrill vor Schmerz und torkelt auf seinen Bruder zu. »Dexter, mein Arm. Mein Arm ist gebrochen.«
Dexter Lane fährt herum. Obwohl Lemmy nur sechs Schritt von ihm entfernt ist, geht sein Geschrei im Brüllen der Rinder unter. Zur gleichen Sekunde stieben die ersten Rinder auch schon den Hang hoch, genau auf die Hütte zu.
Entsetzt sieht sich Dexter Lane das an. Dann zerrt er Lemmy mit an die Bäume. Seine Stimme überschlägt sich, als er die Stiere heranrasen sieht. Sie sind keine fünfzig Yards mehr entfernt. Zehn Yards aber sind es noch bis zu den Bäumen.
»Lauf!« schreit Dexter seinen Bruder an »Lauf doch! Sie trampeln uns tot, sie rennen uns nieder. Auf den Baum, schnell, Lemmy.«
Der brüllt vor Furcht, kann die linke Hand nicht gebrauchen. Mit der Rechten greift er nach dem untersten Ast und kreischt: »Schieb doch, Dexter, los!«
Dexter Lane wuchtet seinen jammernden Bruder hoch. Der zieht sich heulend auf den Ast, erreicht den nächsten, will höher, als er abrutscht und herunterfällt. Im gleichen Augenblick sind auch schon die ersten Stiere da. Lemmy rollt sich in Todesangst hinter den Baumstamm und sieht, wie Dexter von einem Stier gerammt wird. Dexter fliegt im Bogen davon und glaubt, daß ihm der Stoß alle Rippen gebrochen hat. Nach Luft ringend, kommt Dexter hoch. Jetzt kümmert er sich nicht mehr um seinen brüllenden Bruder. An Lemmy vorbei springt er an den Baum und zieht sich höher. Durch ihr Gebrüll dringt Lemmys schrille, durchdringende Stimme zu Dexter hoch, der sich vor Schmerz krümmt und sich kaum halten kann.
»Hilf mir, Dexter, hilf mir doch! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch, Dexter!«
»Ich kann nicht«, stöhnt Dexter über ihm. »Wirf dich hinter den Baum, bleib am Stamm liegen, Lemmy.«
»Du Hund, du verdammter Kerl, du läßt mich unter die Hufe kommen, du läßt deinen Bruder im Stich.«
Dann schweigt er, weil eine ganze Ladung Sand in seinem Mund landet. Der Staub überschüttet ihn, er bekommt kaum noch Luft und preßt sich eng an den Baumstamm. An ihm vorbei huschen Schatten. Das Dröhnen und Trommeln, das Brüllen und Schreien macht ihn taub. Lemmy Lane liegt und glaubt, daß die Welt untergeht. Der Boden bebt. Ein Stier kracht gegen den Baum. Dann keilt er mit den Hufen aus und tritt Lemmy in die Rippen. Der wimmert nur noch, bis der Staub ihm die Nasenlöcher zusetzt und er kaum noch atmen kann. Schmerz wütet in Lemmy Lanes Seite. Er liegt und sieht kaum noch etwas.
Über ihm ist Dexter, der höllische Schmerzen im Rücken hat. Zweimal noch krachen Stiere gegen den Baum, bilden ein Hindernis, hinter dem Lemmy Lane liegt. Durch den Staub dringt das Bersten von Holz. Die Hütte bricht im Ansturm der Rinder zusammen.
Irgendwann ist es vorbei. Einzelne Schüsse peitschen südlich der beiden Lanes durch die Nacht. Die Staubwolke senkt sich langsam. In der Ferne verliert sich das Donnern und Dröhnen der Hufe. Dort hinten rast die Herde weiter, biegt in die Nordrichtung.
Big Jim Vances Herde donnert geradewegs auf den Südarm des French Creek zu. Entsetzt sehen es die wenigen Männer, die noch neben den Stieren reiten. Aber sie können nichts mehr tun. Keiner hat mehr Patronen, die Munition ist verschossen.
»Sie rennen in den trockenen Bacharm«, ruft Londsdale Ferguson zu. »Sie brechen sich die Hälse, Mensch. Wir lenken sie nicht mehr ab, wir schaffen es nicht.«
Aus! denkt Ferguson nur. Das kostet ein Viertel der Herde, wenn nicht mehr. Das überlebt Big Jim nicht, das bringt ihn um.
Er blickt sich um, aber hinter ihnen kommt niemand mehr. Sie sind schon sechs Meilen gerast. Weit hinter ihnen liegt die Weidehütte zusammengebrochen unter den Bäumen.
Dort knickt jetzt Lemmy Lane beim Aufstehen ein und stürzt wieder aufs Gesicht. Stöhnend rutscht Dexter vom Baumstamm herab. Er landet auf einem toten Stier und kommt gekrümmt auf seinen Bruder zu. Einen Augenblick sieht er sich suchend um.
Sein Gewehr lehnte am Baum. Jetzt ist nichts mehr von der Waffe zu sehen. An der Stelle liegt ein Stier am Boden. Und selbst wenn sie zu dreien wären, wie wollten sie das schwere Tier vom Gewehr wälzen?
Nur Lemmy hat noch seinen Revolver. Bei dem Durcheinander in der Hütte hat es Dexter Lane nicht geschafft, an seinen Revolver zu kommen. Der Waffengurt muß dort irgendwo unter den Trümmern liegen, verdeckt von einem Berg aus Balken und Brettern.
»Ich – ich kann nicht gehen«, jammert Lemmy greinend und hält sich die Seite. »Ich – ich sterbe… Die Schmerzen.«
»Habe ich vielleicht keine?« fragt Dexter wütend. »Los, wir müssen hier weg. Gib mir deinen Revolver. Ich stütze dich, Lemmy. Hölle, die Hütte, alles hin. Und kein Gaul zu sehen, niemand mehr hier. Reiß dich zusammen, du Narr, so schlimm kann es nicht sein.«
Lemmy wimmert, als Dexter ihn hochzieht und stützt. Sie stolpern los – Dexter keuchend, Lemmy immer wieder einknickend.
»Wohin?« fragt Lemmy schließlich japsend, als sie an den am Boden liegenden toten Tieren vorbei sind. »Ein Pferd – ist denn kein Pferd da?«
»No, du Jammerlappen«, brummt Dexter Lane mürrisch. »Wir müssen zur Ranch. Der Teufel soll die Kerle holen, die uns das eingebrockt haben, ich bringe sie um. Weiter, bleib nicht stehen! Wir haben nur einen Revolver, Mensch. Wenn sie jetzt kommen, dann knallen sie uns ab wie Hasen. Weiter, weiter, weg hier!«
Sie schleppen sich fünfhundert Yards weit, bis sich Lemmy im Bacheinschnitt einfach fallen läßt.
»Ich – ich kann nicht mehr. Ich kann nicht…«
»Hoch mit dir, weiter!«
»Laß mich – liegen. Der verdammte alte Narr Jenkins, der hat es uns gesagt, aber keiner hat ihm geglaubt«, wimmert Lemmy Lane. »Jetzt hat Coole sich ein Rudel rauher Burschen geholt. Kommen sie schon her, Dexter?«
»No, ich höre nichts«, gibt der zurück. »Hör auf mit deinem Gejammere, Bruder. Wir müssen zur Ranch und es Kilburn sagen.«
»Dem, ausgerechnet dem?« stöhnt Lemmy. »Der verdammte Narr ist an allem schuld. Warum mußte er schießen? Jetzt haben wir es. Die packen uns und legen uns auf die Nase, weil Kilburn den Alten erschossen hat. Ich sage dir, wenn ich eine
Chance bekomme… Ich bin fertig, ich sterbe… Ich rede. Ich fresse das nicht aus, was dieser Idiot Kilburn eingebrockt hat.«
»Halt’s Maul!« zischelt Dexter. »Sie denken immer noch, daß es Viehdiebe waren. Wir haben geschworen, nicht darüber zu reden. Sei still, Bruder! Der alte Thayer ist tot, damit basta. Ich sage dir…«
Klick!
Es ist hinter und über ihnen. Dexter wirbelt erschrocken herum und sieht den Mann über sich stehen. Der Mann hat sein Gewehr unter dem Arm und steht ganz still, als sich Dexter Lane zur Seite wirft und die Hand nach unten stößt.
»Gib auf!« ruft Thayer fauchend. »Streck sie hoch, Mann, sonst frißt du…«
Er zieht schon, der Dexter Lane. Er reißt den Revolver im Wegrollen heraus und feuert.
Kilburn, denkt Ray Thayer, Kilburn hat Dad…
Sein Gewehr brüllt auf, als Lanes Kugel sich durch die Weste bohrt und ein Loch im Leder hinterläßt. Da geht in Ray eine Wandlung vor, die ihn rücksichtslos feuern läßt. Zwei, dreimal klickt der Unterbügel. Peitschend der Knall des Revolvers noch einmal unter ihm. Der Mann dort kollert auf die hellen Steine am Grund des ausgetrockneten Bacharmes. Dort bleibt er liegen und rührt sich nicht mehr.
»Nein!« stößt Lemmy gellend hervor, als Ray losgeht. »Nicht schießen, nicht schießen. Ich habe keine Waffe, ich bin am Ende. Nicht schießen, Mann!«
Der Mann ist groß und breit. Er geht zu Dexter und hebt ihn mit dem Gewehrlauf an. Dexter fällt langsam auf den Rücken. Seine Augen sind starr in den Nachthimmel gerichtet.
»Dexter!« wimmert Lemmy. »Dexter, was – was ist, was ist mit ihm?«
Der Mann kommt auf ihn zu, das Gewehr sitzt ihm auf der Brust.
»Nicht schießen!« keucht Lane schrill und wagt sich nicht zu rühren. »Ich habe nichts getan, ich – ich…«
»Weißt du, wer ich bin?«
»Nein, aber schieß nicht, ich bin doch wehrlos! Meine Rippen, mein Arm… Oaah, nicht schießen!«
»Ich bin Ray Thayer«, sagt der Mann über ihm und packt ihn blitzschnell. »So, du Schurke, und jetzt mach den Mund auf! Ich schwöre dir, ich hänge dich auf, wenn du nicht redest. Noch sind wir auf meinem Land, und Diebe hängt man. Was war mit Kilburn und meinem Vater?«
»Ich sage alles, aber schieß nicht, nicht aufhängen!« fleht Lane. »Vance hat uns angeworben, uns und ein paar Freunde. Es fing im Herbst an. Wir mußten Vance-Rinder von der Weide holen. Es sollte aussehen, als wären es Viehdiebe. Drück nicht ab, schieß nicht, Thayer, ich sage alles!«
Ich bringe dich um, denkt Ray zornerfüllt. Mord, glatter Mord. Sie haben Dad erschossen.
»Ihr habt also auch Rinder von den Dawes und uns geholt?«
»Ja, Vance wollte es so«, stößt Lane heraus und ist bleich wie ein Leichentuch geworden. »Schließlich glaubten sie alle, daß Viehdiebe hier waren. Vance stellte uns dann ein. Zwei unserer Freunde holten ab und zu immer wieder ein paar Rinder. Vance wußte das alles, er brauchte einen Grund, um auf euch loszugehen. Er wollte euch mit den Viehdiebstählen in Verbindung bringen. In der Nacht, als dein Vater starb, war er mit Kilburn und unseren beiden Freunden unterwegs. Bei dem Regenwetter wollten sie von den Dawes Rinder holen. Es war die richtige Nacht. Dann kam ihnen dein Vater in den Weg. Kilburn schoß sofort.«
Ray Thayer starrt auf ihn hinab, hat die Hand um den Schaft des Gewehres und den Finger am Abzug.
»Kilburn«, sagt er unheimlich ruhig. »Kilburn, und Howard Vance. Und Jim Vance, weiß er davon?«
»Nein, er ahnt nichts, Thayer. Er – er wollte uns nicht einstellen, er wollte zuerst keinen Krieg. Dann gab es angeblich Viehdiebe hier, und er ließ Howard einige harte Burschen anwerben. Er wußte nicht, daß wir schon lange für den arbeiten. Das ist die Wahrheit, Thayer. Ich schwöre es dir, aber – laß mich leben. Wir waren nicht dabei, als Kilburn deinen Vater erschoß, damit hatten wir nichts zu tun.«
»Ihr hättet ihn genauso erschossen, wenn er eure Gesichter gesehen und den verdammten Trick erkannt hätte«, entgegnet Ray Thayer eisig. »Hoch mit dir, auf die Böschung. Du kommst mit, Mister. Ich kenne jemanden, dem du deine Geschichte noch mal erzählen kannst. Vorwärts!«
Er reißt ihn hoch und treibt ihn vor sich her. In drei Minuten sitzt Lemmy Lane wimmernd vor ihm auf dem Pferd. Es geht nach Norden.
Lane zittert vor Furcht, als er den Weg vor sich sieht.
Sie reiten genau auf die Vance- Ranch zu.
*
Der alte Dawes sieht seinen Sohn Joe starr an, als der staubbedeckt in die Küche tritt. »Bill ist zurück«, sagt Joe Dawes keuchend. »Dad, Bill hat Ray mitgebracht.«
Die Tür zum Flur steht offen, als Joe Dawes redet. Seine Stimme schallt durch den Flur, dringt bis in das hintere Zimmer. Oben klappt eine Tür, Schritte auf der Treppe, Mona Dawes kommt herunter.
»Wo ist er denn hin? Warum kommt er nicht her?« fragt sie in der Küche verstört. »Joe, wo ist Ray jetzt?«
»Das weiß Bill nicht. Ray hat ihn auf die Ranch geschickt. Er sagt, Ray sei unnatürlich ruhig geblieben und hätte sich nach jedem der fünf Burschen erkundigt. Danach wäre Ray in die Stadt geritten. Was ist denn mit Cliff?«
»Er schläft.«
Er schläft nicht. Er zieht sich gerade hoch und steht leicht schwankend, aber er steht. Einen Moment dreht sich alles um ihn.
Nicht umfallen, denkt Cliff Thayer verbissen, nicht umfallen, Junge. Es wird besser, gleich hast du es geschafft. Stehenbleiben, Cliff, nimm dich zusammen.
Er hält sich krampfhaft am Bett fest und macht dann die Augen weit auf.
Ah, denkt er, Ray ist da. Und er ist allein. Ich weiß, wie er denkt, er denkt wie unser Vater. Ray braucht auch niemanden, doch es sind fünf Mann, und es wird Big Jims ganze Mannschaft sein, die er gegen sich hat. Warte, Ray, allein sein ist eine verdammte Sache. Ich kann gehen, wollen wir wetten? Ich bin ganz gesund. Da sind meine Hosen…
Die Zähne zusammengebissen, hebt er den linken Fuß an und geht los. Er atmet stoßweise, aber er steigt in die Hosen, zieht sich die Weste über, greift nach der Jacke. Dann zieht er die Stiefel an und lehnt sich einen Augenblick gegen die Wand.
Ray ist da und wird kämpfen. Und er soll im Bett bleiben – er, der kleine Bruder?
Als die Tür aufgeht und er durch den Gang humpelt, sehen sie ihn an wie einen Geist.
»Cliff, um Gottes willen«, sagt Mona Dawes entsetzt. »Cliff, was willst du tun? Du bist krank, Cliff, du hast Fieber gehabt von dem kalten Wasser und deiner Rißwunde im Rücken. Cliff, was hast du vor?«
»Gebt mir ein Pferd, einen Revolver und ein Gewehr!« sagt er »Ich muß reiten.«
»Nein. Großer Gott, Cliff, du holst dir den Tod.«
Er sieht sie an, zuletzt das Mädchen, dem die helle Angst im Gesicht geschrieben steht.
»Und wenn ihn sich mein Bruder holt?« fragt er leise. »Ich könnte nie mehr in einen Spiegel sehen. Versteht ihr das nicht? So schwach bin ich nicht mehr, daß ich nicht reiten kann, Joe, hol mir ein gutes Pferd!«
»Joe, tu’s nicht, er ist doch krank!« sagt sie mit zitternden Lippen. »Joe…«
»Geh, Joe!« sagt der alte Dawes gepreßt. »Geh und hole alles! Tochter, nach oben! Er muß reiten, halte ihn nicht auf. Würde er es nicht, wäre er in seinen Augen kein Mann mehr. Tochter, hörst du?«
»Oh, mein Gott, warum müssen Männer so sein? Cliff, sieh dich vor, kehre um, wenn es zuviel für dich wird.«
Er lächelt seltsam, nickt nur. Dann hebt er die Hand und legt sie auf ihre Schulter.
»Danke, für alles.«
Cliff Thayer hinkt langsam auf den Vorbau, sieht, wie Joe ihm das Pferd holt, seinen Waffengurt abschnallt und ihm reicht. Als er sich in den Sattel ziehen will, schrecken sie alle zusammen.
Dumpf nachhallend und die Luft erschütternd, stehen drei, vier schwere Detonationen im Nordosten in der Nacht. Dünn und sehr weit weg, aber mit dem Wind zu ihnen getragen, wehen Schüsse durch die Stille danach.
»Unsere Südweide«, stößt Cliff hervor. »Das war auf unserer Südweide, Joe.« Er zieht sich hoch, sitzt im Sattel und treibt das Pferd mit lauten Rufen an.
Ray, denkt er, als er aus dem Hof reitet, kein anderer. Er hat es angefangen, ganz allein. Großer Gott, sie schießen immer noch da oben. Wenn sie auf Ray feuern…
Cliff Thayer gibt dem Pferd die Zügel frei und legt etwa anderthalb Meilen zurück, als er es hört.
Links von ihm dringt das dumpfe, dröhnende Geräusch einer in Panik dahinrasenden Herde durch die Nacht. Es zieht nach Nordwesten davon. Schüsse peitschen. Dann wird alles still, bis das Brüllen jäh anschwillt und er genau darauf zureitet.
Bald darauf sieht er Stiere pulkweise durch ein Tal jagen und reißt sein Pferd herum, lenkt es blitzschnell zwischen Büsche.
Reiter tauchen auf. Sie preschen dicht an ihm vorbei und jagen brüllend um die verstreuten Rinderrudel. Noch zwei Reiter erscheinen, galoppieren hinter den anderen her. In einer weit ausholenden Kreisbewegung beginnen sie die Rinder zu einem Block zusammenzutreiben. Doch sie sind keine fünf Minuten damit beschäftigt, als das nächste Rinderrudel, vielleicht hundert Tiere, aus dem Einschnitt des French Creek heranrast. Sofort wenden sich die vier Mann von dem gerade zusammengetriebenen Rudel ab. Sie stellen sich dem neuen Rinderpulk in den Weg und fangen es dicht vor dem Buschstreifen, in dem Cliff steckt, ab.
»Pablo, drüben hin, wir haben sie schon. He, Londsdale, hierher.«
Zwei Mann treiben jetzt das Rudel auf die anderen Stiere zu. Die beiden anderen halten keine dreißig Yards vor Cliff Thayer am Hang. Ihre Stimmen schallen laut zu ihm hin.
»Pablo, du mußt auf die Ranch, schnell. Hier ist nicht mehr zu machen, überall bewegen sich einzelne Rinderpulks durch das Buschgelände. Du mußt die Mannschaft holen! Alle Mann müssen her, sonst zerstreuen sich die Rinder im Umkreis von zehn Meilen. Verdammt, diese Katastrophe. Wir vier – das ist alles, was noch da ist. Hau ab, Mann, hol die Mannschaft!«
»Und was soll ich Big Jim sagen, Ferguson?«
»Nun, irgendwer hätte die Herde in Stampede gebracht, wir hätten keinen gesehen. Es könnten zwanzig oder auch nur fünf Mann gewesen sein. Sage ihm, es sei aus mit der Herde. Mindestens dreihundert tote Rinder allein hinten am Bach. Sie sollen unterwegs aufpassen, daß sie nicht auf die Kerle stoßen, die uns das eingebrockt haben! Los, hau ab, schnell!«
»In Ordnung, Ferguson.«
»Paß selbst auf, die Kerle können überall sein.«
Als Pablo davonreitet, lenkt Cliff langsam sein Pferd herum. Er hört Ferguson noch irgend etwas rufen. Dann reitet er im Schritt zweihundert Yards weiter, ehe er dem Pferd die Hacken gibt und Pablo vorsichtig folgt.
Zwanzig Mann? geht es Cliff durch den Kopf. Einer, Freunde, nur einer. Jetzt habt ihr es, den Schlag muß Jim Vance erst verdauen. Es wird ihm verdammt schwer werden. Ray war da und hat es auf seine Art getan. Aber wohin ist er jetzt? Was hätte Dad getan?
Cliff Thayer grübelt zwei Minuten. Dann weiß er, was sein Vater getan hätte. Old Nat Thayer wäre jetzt zur Ranch geritten und hätte sich Big Jim Vance gekauft. Ray müßte nicht sein Sohn sein, wenn er es nicht auch täte.
*
»Lieg still, Ratte!« zischelt der Mann neben Lemmy Lane und setzt ihm den Revolver an den Kopf. »Rühr dich nicht, Hundesohn, sonst passiert dir was!«
Er schlägt mich nieder, denkt Lane voller Furcht. Mein Gott, ich bin halbtot von diesem Ritt. Als ich schreien mußte, hat er mir einen Knebel in den Mund gestopft und ist weitergejagt. Ich bin schon tot.
Hufgetrommel vor ihm, das sich von Südwesten nähert. Und dann prescht jemand auf den Ranchhof, schreit gellend wie ein Indianer los.
Es wird lebendig vor ihnen, Türen fliegen auf, Lichtschein breitet sich aus.
»Boß, die Herde ist überfallen worden! Boß…«
Der alte Mann im Haus quält sich hoch. Mühsam nur zieht er sich den Hausrock über, nimmt den Stock und humpelt durch den Flur. Als er die Tür öffnet, sieht er seine Männer laufen, Pferde satteln und sich unter dem Vorbau zusammenrotten.
Pablo tritt hastig auf ihn zu, sieht an ihm vorbei.
»Boß, sie haben die Herde überfallen. Wir sind nur noch vier Mann. Wo Clay geblieben ist, wissen wir nicht. Adam fehlt, die Lanes sind verschwunden. Boß, ungefähr dreihundert Rinder liegen tot im French Creek. Wo ist Howard, Boß?«
So ist es, denkt der Alte und lehnt sich an die Wand. Howard ist nie da, wenn man ihn braucht. Hm, die Herde, meine Herde haben sie überfallen.
»Wer war es, Pablo?«
Seine Stimme klingt gebrochen, das Sprechen fällt ihm schwer.
»Ich weiß nicht, wir haben keinen gesehen. Es ging ganz plötzlich los, Boß. Ferguson führt jetzt, aber wir haben keine Munition mehr, und die Rinder verstreuen sich immer mehr. Boß, wir brauchen jede Hand, um die Herde wieder zu sammeln, sonst rennen die Stiere zehn Meilen weit und wandern ab. Ist denn Howard nicht da, Boß?«
»Er ist mit Kilburn zur Stadt«, antwortet der Alte bedrückt. »Reitet – du auch, Flint – alle Mann zur Herde! Und treibt sie zurück auf – auf unsere Weide!«
»Boß, willst du allein hierbleiben? Soll nicht jemand von uns…?«
»Die Herde, rettet sie!« bestimmt der alte Jim Vance. »Macht, was ich sage! Ich brauche niemanden.«
Sie sehen sich an, ehe sie losreiten. Manch einer sieht sich nach dem Alten um. Er lehnt an der Wand und rührt sich nicht.
Verloren, denkt Jim Vance. Aber es ist kein Zorn mehr in ihm, er ist nur todmüde. Verloren, Howard Ich habe dich machen lassen, was du wolltest, Junge. Jetzt sieh auch zu, wie du damit fertig wirst. Wo ist meine Bank, meine Bank…
Er geht los. Der Stock tackt auf die Vorbaubohlen. An der Bank bleibt er stehen, setzt sich seufzend. Die Nacht ist kühl. Die Hauswand ist in seinem Rücken. Und vor ihm liegt der Hof – seine Ranch, eine große, mächtige Ranch.
Der alte Mann macht die Augen zu, er will warten. Und es ist ihm gleich, ob es kühl ist oder ob es lange dauert. Warten auf Howard, seinen Sohn, der ihm sagte, er sei damals nur feige gewesen, zu feige, gegen Nat Thayer hart genug einzusteigen.
Feige, denkt der Alte, war ich nie. Ich war nur zu klug. Er hätte mich umgebracht. Ja, Nat hätte es getan, wenn ich keine Ruhe gegeben hätte. Etwas fehlte mir, was Nat immer besaß. Der Mut, sich selbst zu opfern, wenn es sein mußte. Ich war nie der Mensch, der das getan hätte. Feige nennt mich mein eigener Sohn, weil er keinen Verstand hat. Er hat keinen, ich habe es befürchtet. Wer mag meine Herde angegriffen haben, wer nur? Sollte Clay doch recht behalten, daß Old Bill Cooley gefährlicher ist als zehn rauhe Burschen? Hat er sich Leute geholt? Oder ist es…
Er will das nicht zu Ende denken. Der Gedanke bereitet ihm beinahe körperliche Schmerzen. Zweimal hat er Nat und dessen ältesten Sohn miteinander gesehen, und er hat gewußt, daß dieser Junge vielleicht noch entschlossener sein mußte, als der alte Nat. Sollte der etwa… Der? Dem traut er es zu. Wenn der hier wäre, der ging sie alle mit offenem Visier an, der würde jedem an den Hals springen.
So einen Sohn, denkt der Alte, so einen Sohn müßte ich haben. Und Nat hat seinen Jungen weggejagt. Mir ist unbegreiflich, wie er das tun konnte.
Wenn Ray hier wäre, dann…
*
»Hast du gehört?« fragt der Mann neben Lemmy Lane leise. Er flüstert nur, seine Stimme klingt zischelnd. Und doch hört Lane den Grimm heraus. »Jetzt sind sie weg, wie? Und mein Freund Howard Vance ist mit dem Mörder Kilburn in der Stadt. Sie werden bald hier sein, lange kann es nicht mehr dauern, Lane, du Ratte. Der Alte ist allein. Siehst du, dort sitzt er. Er wartet auf seinen Sohn, Lane. Bald kommt er und mit ihm Kilburn. Wenn sie da sind, gehen wir los. Ich halte dich mit einer Hand, mein Freund. So werden wir um die Ecke kommen. Und dann wirst du deine Geschichte erzählen. Du wirst sie laut erzählen. Verstehst du? Sehr laut, Lane.«
Lane friert erbärmlich und preßt die Zähne aufeinander. Er weiß jetzt, daß der Mann neben ihm nicht nur eisenhart, sondern auch verschlagen ist. Dieser Mann hat keine Nerven, und er hat Zeit.
»Sie werden Tyler irgendwo auflesen, Lane«, flüstert Ray Thayer. »Und dann wird er ihnen sagen, daß er deinen kleinen Bruder aus Versehen erschossen hat. Er wird ihnen erzählen, daß er nicht weiß, wo ich bin. Was meinst du, was Howard macht? Er kehrt um, er wird zur Ranch zurückkommen, weil er hier die ganze Mannschaft hat. Weißt du, was er fühlen wird, der großmäulige Narr Howard Vance? Ich kann es dir sagen, Lane: Angst, fürchterliche Angst. Für ihn ist Kilburn nicht Sicherheit genug, er braucht ein Dutzend Männer, wenn er sich sicher fühlen will. Die findet er hier. Das glaubt er, bis er hier ist. Sie sind alle zur Weide hinaus, genau wie ich es mir ausgerechnet hatte.« Er wird mit Kilburn allein sein, ganz allein.
Er hat es sich ausgerechnet, denkt Lane entsetzt. Der hat das alles geplant? Er ist mit dem Teufel im Bunde, nicht zu fassen. So mußte es kommen, wenn etwas auf der Weide passierte. So, und nicht anders. Alle reiten hin, und er greift sich Howard Vance. Jetzt müßte man weglaufen können und nie mehr wiederkommen brauchen. Cole und Dexter sind tot. Vielleicht hängen sie mich auf.
Er schlottert am ganzen Leib vor Furcht, als er den harten Hufschlag hört.
Zwei Pferde, das hört er genau.
»Paß auf!« zischelt dieser unheimliche Mister neben ihm. »Da sind sie schon, wetten? Jetzt stehen wir auf, mein Freund. Du gehst neben mir her, an meiner linken Seite, Mister! Wir brauchen ja nur um das Holz hier zu gehen, nur zehn kleine Schritte, Lane, du Ratte. Dann darfst du reden, verstanden? Machst du dein Maul eher auf, als ich es dir erlaube, dann passiert dir was, ich schwöre es dir. Sieh mal, der Vorbau liegt im Laternenschein. Dorthin reiten sie gleich, mitten ins Licht. Komm, Lane, aufstehen! Und jetzt gehen!«
Der dumpfe Hufschlag wird lauter. Die beiden Reiter kommen unter dem Balkengerüst her in den Hof.
»Geh!« sagt Ray Thayer und hat den Colt in Lanes Rücken. »Geh und sei still.«
Er hält ihn mit der linken Hand am Kragen und schiebt ihn vor sich her.
Die beiden Reiter sind jetzt im Hof.
Links Kilburn, rechts Howard Vance. So halten sie am Vorbau. Und dann erst sehen sie den alten Mann auf der Bank.
*
Howard Vance und Kilburn werfen sich erstaunte Blicke zu. Mitternacht ist längst vorbei, der Morgen graut bald. Und Big Jim sitzt draußen in der kalten Nacht.
»Was – was machst du hier?« fragt Howard stockend. »Warum bist du nicht…«
»Die Herde«, antwortet der alte Mann müde. Ihn fröstelt etwas. Seine linke, kaum bewegliche Hand zittert zum Stock. »Die Herde ist von Nats Südweide ins Niemandsland gelaufen. Stampede, Howard.«
»Was ist?« Howard wird kreidebleich. »Und die Männer?«
»Sie sind alle fort, auch Flint, der Koch«, erwidert der Alte verbittert. »Ich bin allein, mein Sohn. Warum seht ihr euch so an? Ihr kommt schnell wieder, wie? Wart ihr gar nicht in der Stadt?«
»Keiner da«, keucht Howard Vance, und mit einemmal wird er von der Angst beschlichen. »Alle auf der Weide? Und die Lanes, wo sind die, Dad?«
In diesem Moment stöhnt jemand ganz hinten. Dann gibt es einen dumpfen Fall und einen schrillen Schrei.
»Einer ist hier«, sagt der Mann im Schatten fauchend. »Und ich habe ihn gebracht, ihr Mörder.«
Er steht dort hinten noch im Schatten des Schuppendaches und hat die Beine leicht gespreizt.
»Ray Thayer!« stößt Howard Vance hervor und bemerkt, wie Kilburn aus dem Sattel rutscht, wegtaucht, den Revolver herausreißt. »Kilburn, schieß!«
Er schießt nach dem Aufsetzen und unter dem Leib des Pferdes her. Deutlich sieht Kilburn, wie der Mann hinten jetzt erst zieht und seinen Standpunkt um keinen Zoll verändert. Brüllend hallt der Knall des Schusses über den Ranchhof. Dann springt das Pferd an, drängt zur Seite und gibt die Sicht auf Kilburn frei.
Getroffen, denkt Kilburn, ich habe ihn getroffen. Er hat gezuckt, gleich fällt er um.
Er fällt nicht um. Er bleibt wie ein Baum, den nur ein Axthieb getroffen hat, nach einer kurzen Erschütterung stehen.
»Für Nat Thayer«, zischelt der Sohn voller Gilt und Galle, als er abdrückt. »Da hast du es, Mörder.«
Der Revolver brüllt auf. Und dann trifft die Kugel Kilburn mitten in die Brust. Sie schleudert den geduckt stehenden Revolvermann einen vollen Schritt zurück. Kilburn krümmt sich immer mehr zusammen, dreht sich. Aus seinem Revolver schießen drei, vier Feuerblitze auf den Boden zu. Dann fällt er um, genau am Rand des Vorbaues.
»Mörder«, sagt Ray Thayer noch einmal fauchend, und sein Revolver schwenkt, der Lauf zeigt jetzt mitten auf Howard Vances Brust. »Nicht bewegen, Howard, sonst drücke ich ab! Sitz still, du Halunke, oder ich blase dich vom Pferd und Big Jim vor die Füße.«
Kilburn, denkt Vance verstört und begreift es immer noch nicht. Kilburn hatte doch die Deckung durch das Pferd, er hat zuerst gefeuert. Und doch liegt er am Boden, den Colt hat er verloren. Kilburn ist tot, niemand ist hier. Jetzt bringt er mich um, er bringt mich um.
Howard Vance sitzt wie erstarrt auf seinem Pferd, wagt keine Bewegung.
»Lane!«
»Ja«, wimmert der Mann, der klein wie ein Schatten am Boden liegt. »Nicht schießen, Thayer, ich sage alles!«
Was, denkt Howard Vance, Lane redet? Das ist ja Lemmy Lane. Und dann…
»Kilburn hat Nat Thayer erschossen«, ruft Lane schrill über den Hof. »Mister Vance, Kilburn hat es getan. Ihr Sohn war dabei, Mister Vance, und noch zwei andere. Sie wollten von den Dawes in jener Nacht Rinder stehlen, als der alte Thayer dazukam.«
Nicht reden, denkt Howard Vance voller Furcht und hat das Gefühl, daß ihm alles Blut aus dem Kopf weicht. Nicht reden, Mann.
Aber er spricht, der Mann am Boden, und er sagt noch mehr. Worte hallen über den Hof, begleitet von einem Stöhnen, das vom Vorbau kommt.
»Das – das ist nicht wahr«, sagt der alte Mann stöhnend. Und als er aufstehen will, stößt er gegen seinen Stock, der umfällt, auf die Vorbaudiele poltert. »Howard, du hast den anderen und uns selbst Vieh gestohlen? Du hast – hinter meinem Rücken? Und Nat Thayer, diesen guten Mann, ihr habt ihn…«
Der Sohn des alten Nat geht los. Langsam, den Revolver an der Hüfte. Und er sieht, wie Howards Gesicht leichenblaß wird, wie Howard zwischen dem Alten und ihm hin und her blickt wie ein gehetztes Tier.
»Lüge, Lüge!« stammelt Howard Vance. »Dad, ich schwöre dir…«
»Schweig!« unterbricht ihn der alte Mann.
»Mein Sohn ein Viehdieb, ein Mörder? Mein Sohn.«
»Das ist er«, bestätigt Ray Thayer eisig. »Tut mir leid, Big Jim. Ich hatte nie etwas gegen euch, oder besser: nie etwas gegen dich. Howard, du erbärmlicher Schuft, ich werde dir kein Haar krümmen, du Strolch, obwohl ich dich wegen meines kleinen Bruders mit den bloßen Händen umbringen könnte. Ich will dich vor einer Jury sehen, nur das, du Lump. Du wolltest doch immer so groß sein, größer als dein Vater und jeder andere Mann in diesem Land. Aber du wirst klein sein, du erbärmlicher Feigling, klein und jämmerlich in deiner Angst vor dem Gesetz. Ich wollte dich umbringen wegen Cliff, aber ich tu’s nicht. Deine Strafe soll schlimmer sein als der Tod. Ich komme jetzt, Howard. Und ich werde dich von deinem prächtigen Rappen holen.«
»Nein!« schreit Howard Vance schrill. »Ich… Vor einer Jury? Ich soll ins Jail, ich? Dort bekommst du mich nie hin, du nicht. Ich werde euch alle…«
Jäh schlägt er die Hacken an und jagt los. Ray wird nicht schießen, nicht auf ihn. Er will ihn ja lebend haben. Also, nur weg.
»Was?« sagt der alte Mann und sitzt wie zu Stein erstarrt auf der Bank vor dem Haus. »Er läuft weg, er flieht, der Feigling? Daß er auch das noch tun muß, auch das noch, mein Gott.«
»Howard, halt, ich schieße dir den Gaul unter dem Sattel weg!« brüllt Ray ihm nach. »Howard!«
Aber der reitet weiter, er will zwischen Stall und Scheune vom Hof verschwinden.
Noch dreißig Yards, als er den Mann hinter der Scheune hervorhumpeln sieht. Dort hat er gestanden, der Mann, den viele einen Krüppel genannt haben. Die ganze Zeit hat er dort gestanden. Jetzt geht er. Er zieht sein Bein nach und hat den Revolver in der Faust.
Der Krüppel, denkt Howard entsetzt, der verfluchte Krüppel, wo kommt der her? War er nicht restlos fertig? Ich bringe ihn um, ich bringe ihn… Ah, er hat den Revolver, er hat ja einen Revolver.
»Halt!« ruft Cliff Thayer schneidend. »Halt, Vance, hier kommst du nicht vorbei!«
Der Revolver ruckt hoch, als Vance mit einem schrillen Angstschrei sein Pferd auf dem Fleck herumreißt und versucht, im scharfen Knick nach rechts an der Scheune vorbeizukommen. Vor ihm rechts der Hochbehälter mit dem Wassertank, auf den das Pferd zuschnellt, nicht mehr ganz herumkommt, nicht ausweichen kann.
Sie sehen alle, wie der Gaul mitten in das Balkengestänge unter dem Eisenbehälter hineinrast, sich überschlägt und die Balken zerbrechen. Sie hören das schrille Wiehern des Pferdes und den gellenden, jäh abreißenden lauten Schrei von Howard Vance.
Balken fallen dröhnend herab, der runde, zwanzigtausend Liter fassende Hochbehälter neigt sich. Und dann schlägt er mit Donnergetöse herunter und begräbt Pferd und Reiter unter sich.
Wasser rauscht, gluckst über den Hof.
»Howard«, sagt der alte Mann. »Howard, Junge.«
Von rechts kommt Ray Thayer heran, von links der kleine Cliff. Er zieht sein Bein ein wenig nach und hält die linke Schulter schief. So kommen sie aufeinander zu.
Er ist bestraft genug, denkt Ray bitter, jetzt ist es vorbei. Ich habe meinen kleinen Bruder wieder.
Er tut mir leid, denkt Cliff und schluckt. Totgeschlagen zu werden, vor den Augen des alten Jim Vance, das ist fürchterlich für einen Vater, gewiß ist es das. Er ist doch nur ein armer, kranker und alter Mann, der große Jim Vance. Nun hat er niemanden mehr. Ich aber bin mächtig reich an diesem Tag geworden. Der Große ist wieder da. Ich bin richtig zufrieden.
Sie sehen sich an, und dann wenden sie sich um. Sie sagen es beide wie aus einem Mund zum Vorbau hoch. Dort sitzt der alte Mann und sieht zwei Thayers auf seiner Ranch.
»Es tut uns leid, Big Jim.«
Zwei Thayers und die gleichen Worte. Söhne eines Mannes, der vielleicht stolz wäre, wenn er sie sehen könnte. Der andere Mann auf der Bank nickt nur vor sich hin. Er ist krank und alt und von nun an ganz allein. Das Geld zählt nicht mehr, nichts ist mehr wichtig für ihn. Sein Sohn ist tot. Zuletzt war er noch feige, das ist das Schlimmste für Big Jim Vance. Der Alte wäre mit dem Colt in der Faust gestorben. Ein ehrlicher Tod, denkt der Alte und nickt immer noch vor sich hin, auch das konnte er nicht schaffen. Clay hatte recht, als er sagt: »Fang nie mit einem Thayer etwas an, Junge. Am Ende bist du tot.«
*
Die Leute sehen sich an. Niemand spricht, als die beiden Männer an den Erdhügel treten und die Schaufel nehmen. Der eine Mann hält die Schulter leicht schief, der andere hat die Kugel Kilburns längst vergessen und nimmt nun die erste Schaufel Erde.
»Er war ein guter Mann«, sagt Ray Thayer laut und klar. »Die Erde soll ihm leicht sein.«
Dann klatscht die Erde dumpf auf den Sarg.
»Er tut mir leid«, sagt Cliff Thayer, und auch von seiner Schaufel rutscht die Erde nach unten. »Zuletzt mochte ich ihn. Das ist die reine Wahrheit.«
Dann treten sie zur Seite. Dort stehen nur zwei Frauen. Mabel O’Henry ist immer noch schön. Und Sheila O’Henry faßt verstohlen nach Rays Hand.
»Bleib bei mir, Ray, bitte.«
»Ja«, sagt er leise und denkt, daß er es nie begreifen wird. Alles hat Big Jim Vance Sheila vermacht, jeden Stein und jeden Cent. Und dabei hat er gewußt, daß sie immer wieder auf der Thayer Ranch war – bei Ray, daß sie ihn mochte und es offen zeigte. Jetzt ist er tot, und sie ist seine Erbin, sie allein. Dort liegt er nun, drei Monate hat er Howard überlebt, der alte Mann. Warum er wohl sein Testament nie geändert hat? Vielleicht wollte er, daß alles, was er einmal geschaffen hatte, erhalten blieb? Er kannte nur einen Mann, der sein Lebenswerk erhalten konnte. So muß es wohl gewesen sein.
Seltsam, denkt Ray, seltsamer, alter Mann. Sheila und ich werden heiraten. Dann leite ich Big Jims Ranch. Ein Thayer auf der Vance-Ranch – unbegreiflich, warum er das wohl wollte. Einmal hat Howard mit seinen Männern meinen kleinen Bruder gehetzt und ihm keine Chance gelassen. Und nun das hier. Er war einsam in den letzten Monaten, der alte Mann.
Still und friedlich ist er gestorben. Ein Mann, ohne Hoffnung, jemals seinen Namen mit seiner Ranch verbunden zu wissen. Man wird sie eines Tages die Thayer-Ranch nennen. Das hat er gewußt und so gewollt.
Einem hat er es gesagt, dem alten Clay Jenkins.
»Ich will den besten Mann für mich, Clay. Eines Tages wird er es verstehen. Dann sage es ihm, Clay. Den besten Mann für meine Ranch: Ray Thayer.«
Den besten Mann.