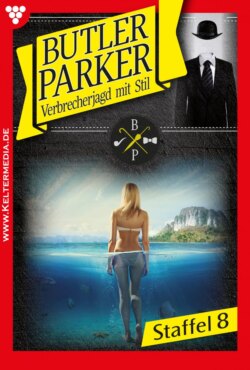Читать книгу Butler Parker Staffel 8 – Kriminalroman - Günter Dönges - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJosuah Parker war mehr als nur leicht verwirrt.
Er stand nämlich plötzlich einer Dame gegenüber, die ihn fatal an jene Kleopatra erinnerte, die seinerzeit in Ägypten Geschichte gemacht hatte.
Sie trug ein enganliegendes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln reichte. Die nackten Füße mit den rot gelackten Zehennägeln steckten in leichten Sandalen, und auf den schlanken Oberarmen befanden sich goldschwere Spangen in Form von sich windenden Schlangen.
Ihre dunklen Augen blitzten erfreut, als sie Parker vor sich sah. Sie strich sich das rabenschwarze Haar ihrer Ponyfrisur glatt und schaute einen Moment selbstzufrieden auf ihr verwegen anmutendes Dekolleté. Sie schien bemerkt zu haben, daß auch Parker beeindruckt war.
»Wo kommt Ihr her, Fremder?« erkundigte sie sich mit einer reizenden Kinderstimme, in der aber bereits Verruchtheit zu erkennen war.
»Parker – Josuah Parker«, stellte der Butler sich formvollendet vor und lüftete höflich seine schwarze Melone.
»Kommt Ihr aus Mesopotamien?« wollte Kleopatra wissen.
»Eigentlich nicht direkt«, erwiderte Parker höflich, »mehr aus Chikago, falls Ihnen das ein Begriff ist, Königin!«
Sie nickte geistesabwesend und griff nach ihrem Metallspiegel, in dem sie sich bewunderte. Sie schien plötzlich jedes Interesse an Parker verloren zu haben und entschwebte.
Parker sah ihr verdutzt nach. Mit solch einer Begegnung hatte er nicht gerechnet. Er war gespannt, was sonst noch alles auf ihn zukommen würde. Er machte sich auf Überraschungen gefaßt.
Die nicht lange auf sich warten ließen, wie sich sehr schnell zeigen sollte.
Madame Pompadour kreuzte seinen Weg.
Parker konnte durchaus verstehen, warum und wieso ein gewisser französischer König ihr sein intimes Vertrauen geschenkt hatte. Madame war vielleicht noch attraktiver als Kleopatra. Was mit ihrer ausgeprägten fraulichen Reife Zusammenhängen mußte.
Sie zwinkerte Parker zu und winkte ihm mit dem Zeigefinger vertraulich. Dieser Wink war eine mehr als eindeutige Einladung und Herausforderung, ihr ins Nebenzimmer zu folgen.
Parker befand sich in einem echten Zwiespalt der Gefühle. Sollte er Madame folgen? Oder sollte er sich diskret zurückziehen? Nun, bevor er zu einem Entschluß kam, erschien Ludwig XV. auf der Bildfläche und benahm sich wenig königlich.
Was sich in einer saftigen Ohrfeige ausdrückte, die er Madame verabreichte.
Die Pompadour kreischte auf wie eine beleidigte Marktfrau und trat ihrem Liebhaber und König kurz und knapp gegen das Schienbein.
Worauf der königliche Ludwig das Gesicht schmerzvoll verzog und zu einer zweiten Ohrfeige ausholte. Die aber nicht mehr ihr Ziel erreichte, da Madame es vorgezogen hatte, das Weite zu suchen.
»Ich fordere Genugtuung«, schnarrte Ludwig den Butler an und zog seinen Zierdegen.
Parker, der das bisher für einen schlechten Scherz gehalten hatte, wurde augenblicklich und zielsicher von diesem Stoßdegen bedroht.
Er sah sich daher gezwungen, seinen Universal-Regenschirm einzusetzen. Und Parker erwies sich schon nach dem ersten Durchgang als ein wahrer Meister der Fechtkunst.
Ludwig XV. starrte verblüfft seinem Degen nach, den Parker ihm geschickt aus der Hand geschlagen hatte.
»Ich werde meine Wachen alarmieren«, schnarrte der königliche Ludwig und maß den Butler mit ausgesprochen zornigen Blicken, »die Bastille wird ihn zur Vernunft bringen!«
»Echauffieren Sie sich nur nicht«, bat Parker höflich und machte den Kratzfuß nach, den Ludwig gerade getan hatte. Dann wandte der König sich um und ging mit wallender Perücke davon. Er hinterließ eine süßliche Parfümwolke.
Josuah Parker räusperte sich leicht, als er endlich allein war. Er hatte längst erkannt und eingesehen, daß dieser Besuch seine Nerven zu strapazieren begann. Er hoffte dringend, in die Jetztzeit zurückkehren zu können. Diese hastigen Sprünge in die Geschichte und Vergangenheit verwirrten ihn nur unnötig.
»Ganz schön verrückt, was?« Parker drehte sich zu der ironisch klingenden Stimme um, die hinter ihm ertönte. Er sah sich einem jungen und sportlichen Mann gegenüber, die ihn sehr eindeutig an Robin Hood erinnerte. Das hing schon mit der Kleidung dieses edlen Räubers zusammen, der eine enganliegende Hose trug und darüber ein rotes Wams. In den Händen hielt der Retter der Enterbten und Erniedrigten Pfeil und Bogen.
»Zumindest etwas ungewöhnlich«, erwiderte Parker in seiner höflichen Art und Weise.
»Die hier sind doch alle bekloppt«, behauptete Robin Hood verächtlich, »wundert mich, daß man die frei herumlaufen läßt.«
»Sie – Sie sind einer der Pfleger?« erkundigte sich Parker aufatmend.
»Pfleger? Daß ich nicht lache! Eingesperrt hat man mich hier. Lebendig begraben. Und was die Pfleger betrifft, so will ich Ihnen ein Geheimnis verraten.«
»Ich lasse mich gern überraschen«, versprach Parker. Er sah Robin Hood erwartungsvoll an.
»Die Pfleger«, sagte der Räuber mit leiser Stimme und sah sich dabei mißtrauisch um, »die Pfleger, Sir, die sind doch alle verrückt. Haben Sie das noch nicht mitbekommen?«
*
»Na, endlich, Parker«, sagte Mike Rander und strebte schnell auf seinen Butler zu, »ich habe Sie schon überall gesucht. Ich brauche einen harten Schluck.«
»Wenn Sie gestatten, Sir, würde ich mich solch einem Verlangen nur zu gern anschließen«, erwiderte Parker.
»Unheimlich, dieses Maskenfest«, redete Rander weiter und wischte sich dicke Schweißtropfen von der Stirn, »wissen Sie, wer mir da eben einen fast unsittlichen Antrag gemacht hat?«
»Ich bin auf alles gefaßt, Sir.«
»Die Zarin Katharina!«
»Was zu ihr passen würde, Sir, falls man der Historie glauben darf.«
»Mein Bedarf ist auf jeden Fall reichlich gedeckt, Parker. Wir werden uns absetzen. Kommen Sie, suchen wir die Bar und Doc Waterson.«
Zu Randers Enttäuschung stießen sie zuerst auf den Chef des Hauses. Dr. Waterson war etwa 55 Jahre alt, groß und massig wie ein Turm. Er glich irgendwie Laughton, dem gewichtigen Filmschauspieler.
»Ein gelungener Abend, wie?« fragte er strahlend.
»Wahrscheinlich«, gab Rander zurück, »Sie werden das besser beurteilen können als ich.«
»Alles Therapie, mein Bester«, redete Waterson weiter. Er trug übrigens Zivilkleidung, einen Smoking, dessen Jackett sich über seinem Bauch strammte. »Das hier gehört mit zur allgemeinen Entkrampfung meiner Gäste. Und Sie werden gesehen haben, wie begeistert sie mitspielen.«
»Wobei sich die Frage erhebt, Sir, woher Sie diese originellen Kostüme haben«, schaltete Josuah Parker sich ein.
»Woher wohl? Eigener Fundus. Alles aus Spenden.« Waterson knipste ein noch strahlenderes Lächeln an und winkte Cäsar, der mit einem seiner Legionäre durch den Korridor hinüber in den großen Festsaal stampfte.
»Sie müssen erstklassige und zahlungsfähige Gönner haben«, stellte der junge Anwalt fest.
»Hab’ ich! Hab’ ich!« Waterson nickte freudig, »dafür biete ich aber auch echte Heilungen. Hypnose, Gruppentherapie. Individualbehandlung und das Freimachen verschütteter Persönlichkeit. Man weiß mich zu schätzen!«
»Wie schön für Sie«, sagte Rander trocken.
»Wer schätzt Sie, Sir, wenn man höflichst fragen darf?« Parker wollte es wieder mal genau wissen.
»Die Angehörigen meiner Patienten«, präzisierte Waterson prompt, »ich könnte die Kapazität des Hauses verdoppeln. Und vielleicht werde ich wirklich noch mal anbauen. Das ist kaum noch eine Geldfrage.«
»Vorher möchten wir uns aber verabschieden«, sagte Rander ohne jedes Bedauern, »es war nett, daß Sie uns eingeladen haben, Doc. Wir haben … Moment, was ist denn los!? Parker!«
Er sah seinem Butler nach, der die Bar gefunden oder zumindest gewittert zu haben schien, denn sein Butler schritt zwar gemessen, aber doch unverkennbar schnell aus dem kleinen Empfangsraum und verschwand im Korridor.
»Entschuldigen Sie mich!« sagte nun auch Waterson und hatte es sehr eilig.
Erst jetzt hörte Rander einige spitze und grelle Schreie. Und erst jetzt wurde ihm bewußt, daß der allgemeine Geräuschpegel erheblich zugenommen hatte.
Er kam zu dem treffenden Schluß, daß irgend etwas passiert war. Er konnte sich vorstellen, daß vielleicht eine handfeste Prügelei zwischen Buffalo Bill und Kolumbus stattfand.
In diesem Haus war eben alles möglich.
*
Parker blieb betroffen stehen.
Er hatte sich in der Tür zu einem kleinen rechteckigen Saal aufgebaut und schaute auf die Guillotine, die man darin versteckt hielt.
Dieses mechanische Gerät zum schnellen Ablösen eines diversen Kopfes vom Rumpf sah ungemein echt aus. Das Schrägmesser war hochgezogen und sollte von einem Mann bedient werden, dessen Kleidung an die der Sansculotten aus der Französischen Revolution erinnerte. Der Henker machte einen fast heiteren und gelösten Eindruck und sah interessiert auf den jungen Adeligen, dessen Kopf man bereits samt Körper auf die Wippe geschnallt hatte.
Irgendwie spürte Parker, daß dies alles kein Spaß mehr war! Er fühlte, daß sich etwas zusammenbraute, das schreckliche Folgen nach sich zog.
Parker boxte sich einen Weg durch die Masse der neugierigen Zuschauer. Es handelte sich um etwa zwanzig Frauen und Männer, die alle Kostüme trugen. Aber das störte sie nicht. Sie fühlten sich der Französischen Revolution verhaftet, und sie wollten einen Kopf rollen sehen.
Parker schaffte es nicht mehr.
Es wurde plötzlich totenstill. Der Geräuschpegel war völlig in sich zusammengerutscht.
Der junge Adelige auf der Wippe der Guillotine schien sich in sein schreckliches Schicksal ergeben zu haben. Er wehrte sich nicht mehr gegen die Griffe der beiden Henkersknechte, deren Gesichter hinter Masken verborgen waren.
Die Wippe wurde herumgelegt.
Der Körper des Opfers befand sich jetzt waagerecht unter dem Fallbeil. Der Kopf wartete nur noch darauf, vom Rumpf getrennt zu werden.
»Halt!« Parker rief mit einer an sich leisen Stimme. Da es aber totenstill geworden war, wirkte sein Einwand wie der Stoß einer Fanfare.
Doch seine Stimme wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Sie verhallte ungehört.
Dann legte der Sansculotte einen Sperrhebel um, und das Fallbeil zischte nach unten, direkt auf den Nacken des Opfers zu.
Parker schloß ungewollt die Augen. Er wollte das Schreckliche nicht sehen. So hilflos wie im Moment hatte er sich bisher selten gefühlt.
Dann, als der Geräuschpegel wieder anstieg, schaute er hinauf auf das Gerüst der Guillotine.
Das Opfer erhob sich gerade und grinste mit törichtem Gesichtsausdruck in die Menge, die sich an den Händen faßte und das Blutgerüst umtanzte. Übrigens zu den Klängen einer Rumba, was eigentlich nicht paßte und eine Art Anachronismus war.
»Sie dachten doch nicht etwa, die Guillotine sei echt, Mister Parker?«
Der Butler wandte sich zu Dr. Waterson um, der hinter ihm aufgetaucht war.
»Der Wahrheit die Ehre«, bekannte Parker, »ich glaubte in der Tat an die Schärfe des Fallbeils!«
»Sehr echt, nicht wahr?« Waterson schien stolz zu sein.
»Ungewöhnlich echt«, bekannte der Butler weiter, »gehören diese Spiele auch zu Ihrer Beschäftigungstherapie?«
»Selbstverständlich!« Waterson nickte begeistert und sah zufrieden auf seine Patienten, die den kleinen Saal verließen. Wahrscheinlich strömten sie in den nächsten Raum, um etwas für ihre Gesundheit zu tun.
»Werden damit nicht Energien freigesetzt, die man später kaum noch hemmen kann?« wollte Parker wissen.
»Sicher nicht.« Waterson sagte es mit Nachdruck. »Darauf achte ich schon, Sie sehen etwas mitgenommen aus, Mister Parker.«
»Darf ich Sie etwas fragen?« erkundigte sich der Butler.
»Aber sicher.« Waterson beugte sich neugierig zu Parker hinunter.
»Wo finde ich die Hausbar?« stellte der Butler kurz und knapp seine Frage, »mir scheint, Sir, daß ich das brauche, was man einen herzhaften Schluck zu nennen pflegt!«
*
»Und dann?« wollte Sue Weston eine knappe Stunde später wissen. Sie hielt sich zusammen mit Rander und Parker im Studio des Penthouse auf und hatte sich bis zu diesem Punkt die ungewöhnliche Geschichte angehört, und zwar in einer Mischung aus Amüsiertheit und Grauen.
»Wir gewannen den Parkplatz«, berichtete Rander weiter, »reden wir nicht mehr davon, Miß Weston, daß ein Häuptling der Sioux uns noch kurz vor dem Einsteigen skalpieren wollte!«
»Zu schweigen von Hannibal, Sir, der Ihnen sein Kurzschwert in die unteren Rippenpartien zu jagen beabsichtigte!«
»Tatsächlich!« Rander schüttelte den Kopf, »ein Alpdruck, was wir erlebt haben, Sue. Sagenhaft. Von solchen Dingen träumt man normalerweise nur.«
»Und das alles spielte sich in einem Privatsanatorium ab?« erkundigte sich die Sekretärin.
»Richtig.« Rander nickte. »Ein Bungalow- und Gebäudekomplex in der Nähe von Stratford. Eine sehr reizvolle Gegend nördlich von Rock Falls.«
»Muß man Stratford kennen?« fragte Sue lächelnd.
»Sie sollten es vergessen«, gab Rander zurück, »Sie sollten vor allen Dingen dieses Nervensanatorium vergessen. Und diesen Dr. Waterson!«
»Wird Ihnen das gelingen?« Sue musterte Rander und Parker nacheinander sehr betont.
»Ich werde mich bemühen«, erwiderte Rander.
»Und ich werde es erst gar nicht versuchen, Miß Weston«, räumte der Butler ein, »dieses Szenarium werde ich wohl niemals wieder vergessen.«
»Wie sind Sie eigentlich dorthin geraten?« Sue hatte einen echten Nachholbedarf an Informationen, denn sie war ein paar Tage unterwegs gewesen und hatte in New York eine Freundin besucht.
»Wir fuhren im Auftrag eines Klienten, dessen Sohn bei Waterson untergebracht ist«, informierte Rander also, »dieser Junge, übrigens ein Rauschgiftsüchtiger, der privat behandelt werden soll, schrieb schreckliche Briefe an seine Eltern. Daraufhin setzten wir uns in Bewegung.«
»Konnten Sie den Rauschgiftjüngling sprechen?« wollte Sue Weston wissen.
»Nur sehr kurz. Und er wußte plötzlich nicht mehr, was er geschrieben hatte. Er redete sich auf Mißverständnisse heraus.«
»Er log, Sir, falls mir diese Offenheit gestattet ist.« Parker hatte sich korrigierend eingemischt.
»Möglich«, sagte Rander zurückhaltend, »wir haben den Eltern des Jungen geraten, sich an die Behörden zu wenden.«
»Stand der junge Mann vielleicht unter irgendeinem Druck?« wollte Sue Weston wissen. Sie wußte, daß sie mit dieser Frage dem Butler einen echten Gefallen erwies.
»Offensichtlich«, sagte Parker prompt und schnell, »meiner bescheidenen Ansicht nach war er entsprechend präpariert worden.«
»Und welche schrecklichen Dinge schrieb er an seine Eltern?« Sue Westens Neugier steigerte sich.
»Lassen wir das«, wollte Rander ausweichen und das Thema beenden, »für mich ist die Sache erledigt.«
»Nun, die Berichte des jungen Mannes, die sich in drei Briefen befanden, die aus dem Sanatorium hinausgeschmuggelt wurden, diese Berichte sprachen von Mord!« Parker hatte sich nicht beeindrucken lassen.
»Mord?!« Sue staunte nicht schlecht.
»Von Mordversuchen«, schwächte Mister Rander sofort ab, »die Phantasien eines Rauschgiftsüchtigen, wenn Sie mich fragen, Sue … Hier alles in Ordnung? Wie war der Rückflug? Warum sind Sie nicht noch ein paar Tage in New York geblieben?«
Bevor Sue antworten konnte, meldete sich der Türsummer.
Parker verließ gemessen und würdevoll das Studio seines jungen Herrn und begab sich hinüber in die große Wohndiele. Hier öffnete er einen Wandschrank und schaltete das hauseigene Fernsehgerät ein, das in Sekundenschnelle sofort Bild und Ton lieferte.
Vor dem Eingang zum Lift, der von der Straße aus direkt hinauf zum Penthouse reichte, stand ein schlanker Mann von vielleicht 55 Jahren.
Er machte einen aufgeregten und nervösen Eindruck. Er klingelte gerade ungeduldig und erneut.
Parker betätigte auf elektrischem Weg den Türöffner und wartete, bis der Besucher den Privat- und Direktlift betreten hatte. Als der Lift sich dann nach oben bewegte, begab Parker sich zurück zu seinem jungen Herrn, der ihm bereits mit Sue Weston entgegenkam.
»Nun?« fragte Rander.
»Mister Moberly«, meldete Parker gemessen, »er scheint das zu sein, was man ungewöhnlich erregt nennt.«
»Mister Moberly?« fragte Sue Western und sah Rander neugierig an.
»Der Vater des bewußten Rauschgiftjünglings«, erklärte Mike Rander und verzog sein Gesicht, »jetzt fehlt nur noch, daß etwas passiert ist.«
*
»Vor einer Stunde kam der Anruf«, sagte Moberly und wischte sich den Schweiß von der hohen Stirn, »und ich weigere mich einfach, das zu glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Michael tot sein soll. Ich weigere mich entschieden.«
Rander schwieg betroffen, und Sue senkte den Blick. Fast verlegen griff sie nach einem Stenoblock und ließ sich an ihrem Schreibtischchen in Randers Studio nieder.
Josuah Parker stand wie eine Statue aus Bronze an der Tür und verzog keine Miene.
»Mikes Herz soll versagt haben«, redete Paul Moberly weiter, »das wenigstens sagte Dr. Waterson. Aber das glaube ich einfach nicht, Rander! Sie wissen doch, Mike schrieb von den Mordversuchen im Sanatorium. Wissen Sie, was ich glaube? Er ist umgebracht worden. Man hat ihn ermordet!«
»Haben Sie sich schon mit der Polizei in Verbindung gesetzt?« fragte Rander.
»Das werde ich, darauf können Sie sich verlassen! Ich fahre gleich los nach Stratford. Und, bitte, Sie werden mitkommen. Sie müssen mitkommen! Ich will mich nicht abspeisen lassen. Ich will wissen, wer meinem Jungen umgebracht hat. Und warum man es getan hat. Ich will die Wahrheit herausfinden. Und wehe dem, der für diese Tat verantwortlich ist. Mit meinen eigenen Händen werde ich dieses Schwein erwürgen. Mit meinen eigenen Händen!«
»Darf ich fragen, ob Sie sich möglicherweise noch im Besitz der bewußten drei Briefe Ihres Sohnes befinden, Sir?« schaltete der Butler sich ein.
»Natürlich. Und für mich sind sie ein wichtiges Beweismittel! Ich habe sie unten im Wagen. In meinem Aktenkoffer.«
»Ist der Wagen unbewacht?« erkundigte Parker sich weiter.
»Meine Frau ist im Wagen. Sie will unbedingt mit nach Stratford. Aber versuchen Sie ihr das auszureden, Mister Rander. Sie bricht mir doch glatt zusammen, wenn sie Mike sieht.«
Bevor Rander antworten konnte, ging erneut der Türsummer des Privatlifts.
Parker öffnete in der Wohnhalle den Wandschrank und schaltete das hauseigene Fernsehgerät ein.
Er wußte sofort, was passiert war, als er die vor Angst bebende schmale Frau sah, die verzweifelt klingelte, um dann in sich zusammenzusinken.
Parker eilte nach unten auf die Straße, um der Frau zu helfen, die übrigens Mistreß Moberly hieß.
*
Sie bat um ein Glas Milch, das Parker ihr selbstverständlich bieten konnte. Er schätzte es, seinem jungen Herrn Milch zu servieren. In seinen Augen befand Rander sich immer noch im Stadium des Wachsens, er brauchte laut Parker die wertvollen Mineralstoffe, Spurenelemente und hochwertigen Eiweiß- und Milchfettstoffe, die Parker manchmal raffiniert mit hochprozentigen Beigaben auffrischte.
Mistreß Moberly merkte überhaupt nicht, daß ihr Milchgetränk ebenfalls etwas hochgejubelt worden war. Gierig trank sie das Glas leer, bevor sie überhaupt in der Lage war, ihre Geschichte zu erzählen.
Sie war im Grunde knapp genug.
Sie hatte im Wagen gesessen, dessen Tür plötzlich von einem jungen Mann aufgerissen worden war. Dieser junge Mann hatte kommentarlos die Wagentür geöffnet und den Aktenkoffer an sich genommen. Dann war er in Sekundenschnelle verschwunden und hatte eine völlig entnervte Frau zurückgelassen.
»Darf ich noch etwas Milch nachservieren?« erkundigte sich Parker höflich bei ihr.
»Haben Sie keine anderen Sorgen?« bellte Mister Moberly den Butler an, »rufen Sie die Polizei! Verständigen Sie einen Streifenwagen! Klarer Fall, daß das ein gezielter und geplanter Überfall gewesen ist.«
»Darin haben Sie recht«, pflichtete Rander dem Mann bei, »es ging wohl um die bewußten drei Briefe.«
»Wobei sich automatisch die Frage erhebt, Sir, woher dieser junge Mann von den drei Briefen wußte, die immerhin aus dem Sanatorium geschmuggelt wurden.« Parker hatte wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen.
»Haben Sie mit irgendeiner Person über die Briefe gesprochen?« erkundigte sich Rander bei Moberly.
»Nein. Das heißt – warten Sie. Ja, richtig. Mit Ihnen habe ich drüber gesprochen. Aber sonst …? Nicht, daß ich wüßte.«
»Und Sie, Mistreß Moberly?«
»Ich habe mit keinem Menschen darüber gesprochen.« Sie schüttelte langsam den Kopf und stierte wieder zu Boden. Sie befand sich hart am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wie deutlich zu sehen war. Der Tod ihres Jungen und der Überfall, den sie gerade über sich hatte ergehen lassen, das alles war einfach zuviel für sie.«
»Wollen Sie Ihre Frau etwa mit nach Stratford nehmen?« fragte Rander leise Mister Moberly.
»Sie will mit. Um jeden Preis.«
»Versuchen Sie, es ihr auszureden, Mister Moberly.«
»Ich möchte sie bei mir haben«, sagte Moberly, »allein würde sie bestimmt durchdrehen. Wann fahren wir?«
»Wir?«
»Sie werden doch mitkommen, oder?«
»Was versprechen Sie sich davon, Mister Moberly. Die Polizei wird Ihnen besser helfen können.«
»Bitte, Sir. Bitte, kommen Sie mit! Paul, äh, mein Mann, braucht jetzt Ihre Hilfe. Wir kennen uns in Stratford nicht aus. Und dann der Umgang mit den Behörden. Sie wissen doch, daß er von Mord spricht.«
»Für wieviel Tage wünschen Sie gepackt zu sehen, Sir?« fragte Parker staubtrocken von der Tür her. »Wenn ich vorschlagen darf, so würde ich zu dem Wochen-Set raten.«
»Moment mal! Parker … Wir … Wir …« Rander war wirklich noch nicht bereit, sich in dieses neue Abenteuer zu stürzen. Gewiß, Moberly war ihm bekannt. Er hatte ihn schon verschiedentlich als Anwalt vertreten, aber er fühlte sich nicht verpflichtet, in diese privaten Dinge einzugreifen.
»Vergessen Sie mich nicht«, rief Sue Weston Parker zu, »ich nehme den kleinen Lederkoffer und die Reisetasche.«
»Sie wollen mitkommen, Sue?« Rander sah Sue Weston fast strafend an.
»Eine Sekretärin gehört in allen Lagen an die Seite ihres Chefs«, übertrieb Sue ernst, »ich werde selbstverständlich auch die Reiseschreibmaschine und das Diktiergerät mitnehmen?«
Mike Rander nickte ergeben.
Er ahnte wieder mal, was da auf ihn zukam. Erfreulich konnte es sicher nicht sein.
*
Von einem Maskenball im Sanatorium war keine Rede mehr, als Rander und Parker sich bei Dr. Waterson melden ließen. Genau das Gegenteil war der Fall. Es herrschte eine spürbar gedrückte Stimmung. Von den Patienten bekamen Rander und Parker nichts zu sehen. Man schien sie absichtlich in den Einzelhäusern und Bungalows zurückgehalten zu haben.
Waterson sah ernst, aber würdevoll aus, als er in das Besuchszimmer trat.
»Ich freue mich, daß Sie das Ehepaar Moberly begleitet haben«, sagte er, »aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Es war schrecklich, als ich den Moberlys ihren Sohn zeigte. Mistreß Moberly erlitt einen Nervenzusammenbruch.«
»Ich weiß«, erwiderte Rander, »hat Mister Moberly mit Ihnen gesprochen!«
»Wegen dieser Briefe? Ja, wir diskutierten darüber. Ich schließe Mord selbstverständlich aus. Wer sollte Mike schon umgebracht haben?! Er war ein netter Junge, vielleicht ein wenig aufbrausend, aber sonst anpassungsfähig.«
»Mister Moberly verlangt eine Autopsie, ist Ihnen das bekannt, Doktor?«
»Auch ich bestehe darauf, um jeden Verdacht aus dem Weg zu räumen«, erklärte Waterson, »ich habe mich deswegen bereits mit dem Sheriff dieses Bezirks in Verbindung gesetzt. Und selbstverständlich kann und soll Mister Moberly noch einen Arzt oder Coroner seiner Wahl hinzuziehen.«
»Sie schließen Mord also aus?« Rander sah Dr. Waterson aufmerksam ah.
»Selbstverständlich«, erklärte der Arzt kategorisch. »Mike starb an akutem Herzversagen. Wenn Sie mich fragen, so muß der Junge es verstanden haben, sich Rauschgift zu verschaffen. Er starb mit größter Wahrscheinlichkeit an einer Überdosis.«
»Hatte er bestimmte Freunde hier im Haus?«
»Clive Muscat.«
»Was ist das für ein Patient?« wollte Rander wissen. Er hatte die Fragen übernommen, während Josuah Parker sich absichtlich zurückhielt. Er wollte den Arzt aus der Distanz studieren, wie er es immer gern tat. Es galt, die Persönlichkeit dieses Mannes auf sich wirken zu lassen.
»Clive Muscat ist Alkoholiker«, erläuterte Dr. Waterson gelassen, »ein schwieriger junge Mann, der noch unter Entziehungserscheinungen leidet.«
»Könnte man diesen Clive Muscat sprechen?«
»Natürlich, aber was versprechen Sie sich davon?«
»Vielleicht gewisse Informationen«, schaltete Josuah Parker sich jetzt höflich und gemessen ein, »grundlos dürfte Michael Moberly diese Briefe nicht geschrieben haben.«
»Wann bekomme ich diese Briefe endlich zu sehen?« fragte Waterson etwas aggressiv, »was steht in ihnen? Was hat Mike konkret behauptet?«
»Er schrieb von Mordversuchen in Ihrem Sanatorium!«
»Von Mordversuchen an ihm?«
»In etwa«, gab Parker ausweichend zurück.
»Dann war sein Geist bereits verwirrter als ich annahm«, entgegnete Waterson kopfschüttelnd, »ich kann nur immer wieder fragen, wer ihn denn ermorden wollte? Glauben Sie mir, meine Patienten habe ich unter Kontrolle! Ich habe erstklassige Mitarbeiter.«
Bevor Mike Rander auf diesen Punkt näher eingehen konnte, war draußen auf dem Korridor plötzlich ein erstickter Aufschrei zu hören, dem ein dumpfer Fall folgte.
Parker war ungemein schnell an der Tür, die er noch schneller öffnete.
Er sah, daß zwei stämmige Pfleger damit beschäftigt waren, einen etwa 30jährigen schlanken Mann wegzuschaffen. Sie bedienten sich dabei brutaler Mittel. Sie hatten dem Mann die Arme auf den Rücken gedreht und schleiften ihn hastig in einen Raum, dessen Tür sie mit einem kräftigen Fußtritt geöffnet hatten.
»In der Tat, Sir«, wandte Parker sich an Doc Waterson, der neben ihm erschienen war, »Ihre Mitarbeiter dürften das sein, was man erstklassig nennt. Mir imponiert zum Beispiel die diskrete Wahl ihrer Behandlungsmittel. Es muß eine wahre Freude sein, in Ihrem Haus leben zu dürfen.«
*
»Mir scheint, daß ich bereits das Vergnügen hatte«, sagte Parker zu dem jungen Mann, der ins Sprechzimmer gekommen war. Er hatte sich auf keinen Fall getäuscht, denn er stand Robin Hood gegenüber, der auf dem Maskenfest der Patienten behauptet hatte, alle Pfleger seien total verrückt.
»Clive Muscat«, stellte Hood sich vor. Er trug jetzt eine Art Einheitskleidung, die aus Hose und Hemd bestand und an die Ausgehkleidung der Armee erinnerte.
»Mein Name ist Parker – Josuah Parker«, gab sich nun auch Parker zu erkennen, »ich erfuhr, daß Sie mit dem inzwischen verstorbenen Mike Moberly eng befreundet waren.«
»Wer hat Ihnen denn das erzählt?« Muscat machte einen völlig normalen Eindruck. Was wohl auch damit zusammenhing, daß er auf Pfeil und Bogen verzichtet hatte.
»Dr. Waterson.«
»Dann muß es ja stimmen«, gab Muscat spöttisch zurück, »was erwarten Sie jetzt von mir?«
»Die ehrliche Antwort auf einige bescheidene Fragen«, erwiderte der Butler. »Entspricht es den Tatsachen, Mister Muscat, daß es hier im Sanatorium zu gewissen Mordversuchen gekommen ist?«
»Wie war das? Mordversuche!?« Muscat grinste und schüttelte dazu den Kopf. »Davon habe ich noch nie gehört. Wer hat denn das behauptet?«
»Ihr Freund Moberly.«
»Mein Freund? Hören Sie, ich habe Moberly nur flüchtig gekannt.«
Es war erstaunlich, wie Muscat seine Antwort verkaufte. Er grinste und deutete dabei auf eine Tischlampe, die auf der Fensterbank stand. Sie sah völlig unverdächtig aus und lieferte sicher auch ein gutes Licht, aber dennoch schien sie mehr zu sein als nur eine Lampe.
Als Muscat schließlich in einer Art Kurzpantomime die Bewegungen eines Telefonierenden machte, da wußte der Butler Bescheid. In der Lampe mußte sich ein Mikrofon befinden. Muscat wußte das und hütete sich aus irgendwelchen Gründen, jetzt und hier die Wahrheit zu sagen.
»Sie haben Mike Moberly also nur flüchtig gekannt«, wiederholte Parker und bediente sich einer anderen Taktik, »welchen Eindruck hatten Sie von ihm?«
»Total durchgedreht, das war er. Das Rauschgift hatte ihn schon fertig gemacht, bevor er hierher kam. Er litt an Halluzinationen, und an ’nem Verfolgungswahn. Ja, das war es! Verfolgungswahn! Er fühlte sich am laufenden Band gejagt und verkroch sich am liebsten unter seiner Bettdecke. Das war der Grund, warum ich die Bekanntschaft zu ihm nicht ausgebaut habe. Selbst in mir sah er irgendeinen Menschen, der ihm ans Leder wollte.«
»Können Sie sich vor stellen, Mister Muscat, daß er ermordet wurde?«
»Ermordet? Lächerlich! Wenn überhaupt, dann hat er sich selbst umgebracht, das ist meine Meinung.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Hinweise«, sagte Parker und nickte Muscat zu.
»Gern geschehen«, erwiderte Muscat, der überhaupt nicht mehr an den edlen Robin Hood erinnerte. Er schien unter irgendeinem Druck zu stehen und Angst zu haben. Auf seiner Stirn hatten sich Schweißtropfen gebildet. Er schielte immer wieder hinüber zur Tischlampe.
»Eine letzte Frage vielleicht noch«, rief Parker dem jungen Mann zu, der auf eine zweite Tür im Besucherzimmer zugehen wollte. Muscat blieb stehen und drehte sich um.
»Sind Sie freiwillig hier?« erkundigte sich Parker.
»Wie man’s nimmt«, gab Muscat zurück, »ich bin Trinker, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Ich habe im Suff eine Frau überfahren und säße jetzt wohl schon im Gefängnis, wenn die ärztlichen Gutachten nicht gewesen wären. Statt Gefängnis bin ich jetzt hier bei Doc Waterson. Und ich bin verdammt froh, daß die Sache so geschaukelt werden konnte. Freiwillig bekommen Sie mich hier vorerst nicht raus.«
Er deutete, während er redete, wieder hinüber auf die Tischlampe. Dann öffnete er die Verbindungstür und verließ das Besucherzimmer. Parker wartete, bis die Tür sich hinter Muscat geschlossen hatte. Dann ging er sehr leise auf die bewußte Tischlampe zu und untersuchte sie.
Als geschulter Bastler brauchte der Butler nicht lange zu suchen. Er fand den Miniatursender im und am Haltegestänge des Lampenschirms. Muscat hatte also nicht gelogen. Das Gespräch war abgehört worden. Parker fragte sich, warum Dr. Waterson das tat. Hatte er etwas zu verbergen? Wollte er wissen, was man über ihn und sein Sanatorium sagte?
Parker nutzte die Gelegenheit, das Besuchszimmer auf einem anderen Weg zu verlassen. Er folgte Muscat und wollte die Tür öffnen. Es überraschte ihn kaum, daß diese Verbindungstür inzwischen versperrt war. Man wollte die Patienten unter Verschluß halten und ihnen keine Möglichkeit geben, das Gelände zu verlassen.
Dennoch öffnete Parker ungeniert die Tür.
Dazu benutzte er sein kleines Spezialbesteck, mit dem er das Türschloß bewegte, damit es sich ihm willig öffne. Er sah in einen langen Korridor, der ihn an einen Hotelflur erinnerte. Etwa zehn Türen zu beiden Seiten führten in diverse Zimmer.
Der Gang war leer.
Parker lustwandelte langsam über den dicken Teppich und versuchte sein Glück bei jeder Tür, die er passierte. Alle Türen waren fest verschlossen.
Er hatte schon fast das Fenster erreicht, das den Korridor nach hinten begrenzte, als er hinter der vorletzten Tür rechts einen leisen und erstickten Aufschrei hörte, was ihn stutzig werden ließ.
Bevor er diese Tür öffnen konnte, hörte er hinter sich das Geräusch schneller Schritte.
Parker wandte sich um.
Er sah sich zwei stämmigen Pflegern gegenüber, die weiße Kittel trugen und einen sehr entschlossenen Eindruck machten. Sie bauten sich vor ihm auf und schüttelten fast gleichzeitig und vorwurfsvoll die Köpfe.
»Schon wieder angehauen, Limers?« fragte der Pfleger, der einen kleinen Schnurrbart trug.
»Warum immer dieses Theater?« erkundigte sich der zweite Pfleger, der einen etwas unrasierten Eindruck machte.
»Ich fürchte, Sie sind das Opfer einer Verwechslung«, sagte der Butler, »mein Name ist Parker – Josuah Parker.«
»Komm schon, Limers«, sagte der Schnurrbartträger und griff herzhaft zu.
Was er aber besser nicht gemacht hätte, denn Parker klopfte ihm mit dem bleigefütterten Griff seines Universal-Regenschirms nachdrücklich auf die Finger, worauf der Schnurrbärtige erstickt jaulte.
Der Unrasierte wollte klüger sein und nach Parker treten. Er hatte sich einen besonders gemeinen Tritt ausgedacht, aber Parker hatte mit solch einer Absicht bereits gerechnet.
Er trat, geschickt wie ein Torero, einen halben Schritt zurück und benutzte erneut den Bambusgriff seines Regenschirms. Diesmal hakte er damit unter und hinter den Fuß des Tretenden, der daraufhin das Gleichgewicht verlor und krachend auf dem Boden landete. Er blieb einen kurzen Moment benommen liegen.
Der Mann mit dem Schnurrbart steckte selbstverständlich nicht auf. Er warf sich vor und wollte den Butler mit einem Klammergriff an sich reißen.
Er hätte es besser sein lassen.
Parker, nicht unflott und sehr phantasievoll, wenn es darum ging, sich Muskelmännern zu erwehren, stellte seinen Regenschirm auf den Boden und kippte den Griff schräg nach vorn.
Auf dieses Hindernis krachte der Schnurrbart mit voller Wucht. Er fiel mit seinem Brustbein auf den Bambusgriff und hatte anschließend unter Luftschwierigkeiten zu leiden, die sich derart steigerten, daß er sich freiwillig auf dem Teppichboden niederließ und japste.
»Ich bedaure unendlich, falls ich Sie inkommodiert haben sollte«, entschuldigte sich Parker, »aber Sie sollten Ihren Eifer in Zukunft vielleicht etwas dämpfen. Blinder Eifer schadet nur, wie der Volksmund es so treffend ausdrückt.«
Parker stieg über die beiden Pfleger, die jetzt selbst der Pflege bedurften und begab sich zurück zum Besuchszimmer.
Es war leer.
Parker wollte diesen Raum gerade auf reguläre Art und Weise verlassen, als die Tür aufgerissen wurde. Doc Waterson und ein Pfleger kamen schnell herein, stutzten und sahen sich dann etwas unsicher an.
»Limers«, fragte Waterson vorsichtig.
»Parker«, stellte der Butler richtig.
»Aufpassen, Chef, das ist ein Trick!« sagte der Pfleger und blockierte die Tür.
»Mein Name ist Parker«, wiederholte der Butler noch mal, »ich unterhielt mich gerade, wenn Sie sich erinnern, Doc, mit einem gewissen Clive Muscat.«
»Wie – wie heißt Ihr Arbeitgeber?« fragte Waterson mißtrauisch.
»Mister Mike Rander, der zusammen mit dem Ehepaar Moberly hierher nach Stratford gekommen ist.«
»Okay«, meinte Waterson erleichtert und knipste sein Lächeln an, »das geht in Ordnung, Mister Parker.«
»Mir scheint, daß ich verwechselt worden bin!«
»Genau. Und zwar mit John Limers, der Ihnen zum Verwechseln ähnlich sieht. Hoffentlich hatten Sie deswegen keinen Ärger, Mister Parker.«
»Auf keinen Fall«, gab der Butler gemessen zurück, »und was den Ärger anbetrifft, Mister Waterson, so sollten Sie diese spezielle Frage an zwei Pfleger richten, die inzwischen aus ihrer Benommenheit erwacht sein müßten.«
*
»Haben Sie diesen Limers gesehen?« fragte Rander. Der junge Anwalt war gerade zurück ins Hotel gekommen, nachdem er das Ehepaar Moberly zum Sheriff begleitet hatte.
»Mitnichten, Sir. Dieser Herr und Doppelgänger wurde mir leider unterschlagen.«
»Ob es ihn überhaupt gibt?« warf Sue Weston skeptisch ein.
»Dies, Miß Weston, wird die Zukunft lehren.«
»Die es in diesem Fall wohl nicht geben wird«, meinte Anwalt Rander und winkte mit einer entsprechenden Handbewegung ab, »wir waren bei Sheriff Denver. Er konnte den Moberlys den Autopsiebefund vorlegen. Mike Moberly starb einwandfrei an Herzversagen. Sheriff Denver lehnte daraufhin jede weitere Verfolgung dieses Falles ab, was juristisch einwandfrei ist.«
»Darf man fragen, Sir, wie das Ehepaar Moberly daraufhin reagiert hat?«
»Moberly wies auf den Raub seines Aktenkoffers hin.«
»Und?« Sue Weston sah Rander erwartungsvoll an.
»Nun, Denver sieht dann keinen Zusammenhang. Er ist der Ansicht, daß der Aktenkoffer in Chikago regulär gestohlen wurde. Mit anderen Worten, er unterstellt einen Vorgang, der in keinem Zusammenhang mit dem Tod Mikes und dessen Briefen zu sehen ist.«
»Werden die Moberlys jetzt zurück nach Chikago fahren?« wollte Sue Weston wissen.
»Ich habe sie dazu überredet, Sue. Hier können sie doch nichts erreichen. Sie würden mit ihrem Verdacht nur gegen Windmühlenflügel ankämpfen.«
»Eine sehr gute Detailentwicklung«, ließ Parker sich vernehmen, »ich muß gestehen, Sir, daß mich die Anwesenheit des Ehepaares Moberly auf die Dauer irritiert hätte.«
»Wollen Sie etwa bleiben?« Rander sah seinen Butler erstaunt an. »Was versprechen Sie sich davon, Parker? Machen Sie sich doch endlich mit dem Gedanken vertraut, daß hier kein Kriminalfall auf Sie wartet!«
»Möglicherweise, Sir, gelingt es meiner bescheidenen Wenigkeit, Sie ein wenig umzustimmen«, antwortete Parker würdevoll, »ich vergaß, Ihnen und Miß Weston von einer Abhöranlage im Besuchszimmer des Sanatoriums zu erzählen.«
»Na und?«
»Und von der offensichtlichen Angst eines gewissen Clive Muscat, der sich verständlicherweise nicht traute, die Wahrheit zu sagen.«
»Das sind doch Dinge, die Sie übertrieben darstellen«, gab Rander leicht gereizt zurück, »geben Sie schon zu, daß Sie hier einen Fall finden wollen … Um jeden Preis, Sie haben ihn sich nun mal in den Kopf gesetzt und jetzt suchen Sie nach Details.«
»Darf ich mir die Freiheit nehmen, Sir, Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten?«
»Na schön …«
»Gestatten Sie mir, dem Sanatorium einen nächtlichen Besuch abzustatten, der nicht unbedingt angemeldet zu sein braucht!«
»Was versprechen Sie sich davon Parker?«
»Eine Besichtigung ohne Führung, Sir.«
»Sie wollen mit verschiedenen Patienten sprechen?«
»Auch dies, Sir, schwebt mir in der Tat vor.«
»Und wann soll der Spaziergang stattfinden?«
»In den Morgenstunden, Sir, etwa gegen 2.30 Uhr. Ich werde mir die Freiheit nehmen, die südliche Grundstücksmauer zu übersteigen. Dort scheint mir der Zugang möglich zu sein.«
*
Josuah Parker war bereits nach Einbruch der Dunkelheit aktiv.
Gegen 22.00 Uhr verabschiedete er sich von seinem jungen Herrn und von Sue Weston. Er wollte, wie er behauptete, etwas auf Vorrat schlafen, da er ein alter, müder und relativ verbrauchter Mann sei. Parker zog sich auf sein Zimmer zurück, das sich in einer netten, sauberen Pension befand.
Dieses Zimmer entsprach genau seinen Wünschen und Vorstellungen. Nach dem Hochschieben des Fensters war er in der Lage, hinunter auf das angrenzende Flachdach einer Remise zu steigen. Von diesem Flachdach aus war es ein Katzensprung bis auf den Erdboden.
Als Parker diesen erreichte, war er entsprechend ausgerüstet. Er beabsichtigte einen gewissen Test vorzunehmen. Er wollte, falls es so etwas wie eine Gegenseite gab, diese zu Aktionen herausfordern. Er wußte im vorhinein, daß er sich auf ein gefährliches Abenteuer einließ.
Nach einem Spaziergang von fast vierzig Minuten Dauer erreichte er jenes Mauerstück, von dem er im Hotelzimmer seines jungen Herrn gesprochen hatte.
Am Fuß dieser Mauer, die gut und gern zwei Meter hoch war und deren Krone mit Glasscherben gesichert war, nahm er im Schutz von hohen Sträuchern einige Manipulationen vor. Dazu gehörte vor allen Dingen das Anbringen einer Zeituhr eigener Bauart. Nach Ablauf einer vorher eingestellten Frist gab der Stundenzeiger eine Sperre frei. Diese Sperre wiederum war dann so freundlich, gewisse Reaktionen auszulösen.
Parker nahm sich sehr viel Zeit, zumal er noch ungestört arbeiten konnte. Dann stellte er sorgfältig die Zeituhr und begab sich zurück in die kleine Pension. Mit einer Geschmeidigkeit und sportlichem Eifer, den man Parker niemals zugetraut hätte, stieg er über die Remise zurück in sein Zimmer, ohne sich bei seinem jungen Herrn oder Sue Weston zurückgemeldet zu haben. Er hoffte sehr, daß sein Bluff zu einem Zugzwang der Gegenseite führen würde.
Parker war nämlich fest davon überzeugt, daß es längst eine Gegenseite gab. Für solche Dinge hatte er nämlich eine sehr feine Antenne.
*
Mitternacht war lange vorüber, die Uhren gingen langsam auf 2.30 Uhr zu.
Ein leichter Wind war aufgekommen, der dunkle Regenwolken vor den Mond trieb. Die Sichtverhältnisse waren schlecht geworden. Die bewußte Mauer des Sanatoriums war nur als vager Schatten auszumachen.
2.30 Uhr!
Am Fuß der Mauer tat sich einiges.
Eine Gestalt richtete sich plötzlich auf und stieg behend wie eine Eidechse an der Mauer hoch und erreichte die Krone.
Hier verhielt die nur vage zu erkennende Gestalt. Sie schien auf das Gelände des Sanatoriums zu spähen und dabei sehr vorsichtig und mißtrauisch zu sein.
Sekunden später, als die Gestalt sich anschickte, noch höher zu steigen, Sekunden später passierte es.
Zwei Schüsse, die offensichtlich aus einer Schrotflinte stammten, peitschten auf. Sie waren ungedämpft und zerrissen die Stille der Nacht. Selbst der Wind schien für einen Moment den Atem anzuhalten.
Die nur vage zu erkennende Gestalt wurde voll getroffen.
Sie hielt sich für einen Augenblick. Dann rutschte sie haltlos ab und landete am Fuß der Mauer in dichtem Gesträuch.
Hinter der Mauer waren schnelle Schritte zu hören, dann leise Stimmen. Von weither bellte ein aufgeschreckter Hund.
Jenseits der Mauer folgte ein feines Scharren, das lauter und intensiver wurde.
Davon hörte die immer noch nur vage erkennbare Gestalt am Fuß der Mauer nichts.
Halb verdeckt von den Zweigen des Gesträuchs, lag sie ruhig auf dem Boden und rührte sich nicht mehr. Wie gesagt, die beiden Schrotschüsse waren Volltreffer gewesen.
*
Es ging auf 3.00 Uhr zu, als auf dem Flachdach der Hotelremise sich jemand an Parkers Zimmerfenster heranpirschte.
Diese Gestalt, die allerdings recht gut zu erkennen war, bewegte sich mit einer erstaunlichen Unbekümmertheit. Sie schien genau zu wissen, daß ihr keine Gefahr drohte. Sie hatte inzwischen das Fenster von Parkers Zimmer erreicht und benutzte einen ordinären Glasschneider, um das Fensterglas in einem kleinen Halbbogen zu durchtrennen. Dann griff die behandschuhte Hand ins Zimmer hinein und entriegelte das Fenster.
Leise wurde das Fenster hochgeschoben. Anschließend stieg der Unbekannte in Parkers Zimmer.
Eine kleine Taschenlampe flammte auf und suchte die Ecken ab. Dann bewegte sich die Gestalt in die Mitte des Zimmers, stieg auf einen Stuhl, den sie neben den Tisch gestellt hatte, kletterte darauf und fingerte nach der Deckenfassung der Lampe.
Dabei irrte der Schein der Taschenlampe kurzfristig durch den einfachen, aber sauberen Raum. Da war der solide Schrank mit der Doppeltür, das einfache Holzbett, der Waschtisch und schließlich ein uraltes Kanapee, das aber sehr gemütlich und einladend aussah.
Doch das alles interessierte die Gestalt nicht, die übrigens einen bulligen und kräftigen Eindruck machte. Sie fingerte noch immer an der Deckenfassung der Lampe herum und fand endlich, wonach sie gesucht hatte.
In der behandschuhten Hand dieser Gestalt lag eine flache Metallkapsel, die fatal an einen gängigen Minisender erinnerte.
Der Mann stieg vom Stuhl, stellte die Sitzgelegenheit weg und wandte dabei automatisch dem Schrank den Rücken zu, was sich nicht sonderlich auszahlte.
Dadurch entging dem Unbekannten nämlich eine erstaunliche Tatsache, wie sich zeigen sollte.
Die rechte Schranktür wurde leise aufgedrückt.
Ein gewisser Josuah Parker, vollständig und korrekt gekleidet, stieg leise ins Zimmer. Dann nahm Parker seinen Universal-Regenschirm hoch und legte den bleigefütterten Bambusgriff nachdrücklich auf den Hinterkopf des nächtlichen Besuchers.
Der Mann gab daraufhin einen leisen Seufzer der Müdigkeit von sich und beeilte sich, auf dem Boden ein kleines Nickerchen zu absolvieren.
*
Dieser nächtliche Eindringling kam schlagartig und ohne jeden Übergang wieder zu sich.
Sein Kurzschlaf hatte genau dreieinhalb Minuten gedauert.
»Ein gewisser Kopfschmerz wird mit Sicherheit in den kommenden Stunden vergangen sein«, tröstete Parker seinen nächtlichen Gast, der sich aufgesetzt hatte und den Butler völlig überrascht musterte.
»S… S… Sie!?« stammelte er dann leicht verwirrt.
»In der Tat«, erklärte Parker, »ich kann Ihre Enttäuschung verstehen. Sie waren sicher der Meinung, meine bescheidene Wenigkeit sei mittels zweier Schrotladungen ins Jenseits befördert worden, nicht wahr?«
Der nächtliche Gast nickte unwillkürlich, bis er merkte, daß er sich gehenließ. Augenblicklich stoppte er seine Bewegungen und rieb sich dann vorsichtig den Hinterkopf.
»Ich war so frei, mich durch ein Double vertreten zu lassen«, führte der Butler höflich weiter aus, »eine von mir angekleidete Gummipuppe mit entsprechender Gasfüllung, die durch einen Zeitschalter zur Mauerbesteigung freigelassen wurde …«
»Ich – ich weiß überhaupt nicht, wovon …«
»Natürlich sind Sie ahnungslos«, bestätigte Parker milde, »natürlich wissen Sie nicht, wovon ich im Augenblick rede. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden bald alles begreifen! Und was den Minisender in Ihrer Hand betrifft, so fanden Sie ihn selbstverständlich rein zufällig.«
Der Mann sah verblüfft in seine Hand, die natürlich leer war. Parker hatte diesen Minisender längst an sich genommen und zu seinem Beutegut erklärt.
Der nächtliche Gast war für den Butler übrigens kein Unbekannter. Es handelte sich um den Unrasierten, dessen Bartstoppeln noch gewachsen waren. Dieser Pfleger erinnerte sich ebenfalls und hatte das Gefühl, etwas für seine Freiheit tun zu müssen.
Er sprang unvermittelt auf, was ihm trotz seiner Stämmigkeit sehr schnell gelang. Doch er hatte die Rechnung ohne einen gewissen Josuah Parker gemacht, der sich stets einiges einfallen ließ.
Der Mann stand noch nicht ganz auf seinen Beinen, als er auch schon wieder auf dem Hosenboden saß. Der Pfleger aus dem Nervensanatorium hatte im Eifer völlig übersehen, daß sein rechtes Fußgelenk mit einem soliden Strick am Bettpfosten befestigt worden war. Und dieser Strick erwies sich jetzt als ausgesprochen hinderlich.
»Sie sollten sich wie ein erwachsener Mensch benehmen«, sagte Parker mißbilligend.
»Lassen Sie mich gehen«, reagierte der Pfleger gereizt und knotete den Strick von seinem Fußgelenk los.
»Aber selbstverständlich«, meinte Parker entgegenkommend, »versäumen Sie auf keinen Fall, Dr. Waterson die herzlichsten Grüße auszurichten.«
»Waterson?«
»Ihr Hörvermögen ist erstaunlich gut entwickelt«, gab der Butler würdevoll zurück.
»Was hat Waterson mit dem hier zu tun?« fragte der Mann und richtete sich vorsichtig auf. Er hatte den Strick endlich losgeknüpft.
»Fragen Sie mich das bitte nicht«, erwiderte Parker gemessen. »Mir scheint, daß Sie dafür kompetenter sind.«
»Sie – Sie wollen mich tatsächlich gehenlassen?« Der Pfleger konnte es nicht glauben.
»Der Rückweg über die Remise steht Ihnen frei. Nachträglich meinen Dank für Ihr Erscheinen. Ich hoffte, daß sich irgendeine offizielle Person aus dem Sanatorium zeigen würde.«
»Wieso?«
»Weil ich von der Annahme ausging, daß man möglicherweise einen Minisender installiert hatte. Was stimmte, wie sich erfreulicherweise zeigte.«
»Und – und was wollen Sie jetzt tun?«
»Über diesen speziellen Punkt werde ich ausgiebig nachdenken müssen«, gestand Parker, »nach der Sprechweise des Volkes soll man bekanntlich niemals etwas überstürzen. Auch Ihnen empfehle ich diese Weisheit, falls Sie auf dem schnellsten Weg zurück in das Sanatorium zu gehen beabsichtigen!«
Der Pfleger mit dem Stoppelbart sah den Butler zweifelnd und unsicher an.
»Ich könnte mir nämlich vorstellen, daß Sie unter Umständen nicht mehr sonderlich lange leben werden«, schloß Parker seine Ermahnungen, »ein Herzversagen wird Ihnen ja wohl bekannt sein. Wie im Fall Michael Moberly!«
*
»Sie ließen ihn tatsächlich gehen?« fragte Rander eine Viertelstunde später, nachdem der Butler ihn aus dem Schlaf geweckt hatte. Auch Sue, die den Butler oft schneller verstand als Mike Rander, wirkte irritiert. Die Sekretärin trug einen leichten Morgenmantel, der ihre ausgeprägten und sympathischen Formen wirkungsvoll unterstrich.
»Gewiß, Sir. Er wäre hier in der Pension nur lästig gewesen, wie ich bemerken möchte. Zudem wollte ich dem Herrn die Zeit und Möglichkeit einräumen, sich seine speziellen Gedanken zu machen, was seine Rückkehr in das Sanatorium betrifft.«
»Muß der Mann sich erschreckt haben, als Sie plötzlich hinter ihm standen«, sagte Sue und schmunzelte.
»Das Leben ist voller Überraschungen«, stellte der Butler fest.
»Woher wußten Sie eigentlich von den beiden Schrotschüssen?« erkundigte sich Rander, »normalerweise hätten Sie die doch gar nicht hören können. Das Sanatorium ist doch viel zu weit entfernt von hier!«
»Auch ich war so frei, mich eines Minisenders zu bedienen«, gestand Parker offen, »als die beiden Schüsse fielen, nachdem laut meiner Uhr das Double an der Mauer hochgestiegen war, rechnete ich mit dem nächtlichen Besuch. Ich ging von der Voraussetzung aus, daß man das Corpus delicti aus meinem Zimmer bergen wollte.«
»Und woher wußten Sie wieder von diesem Minisender?« schaltete Sue Weston sich lächelnd ein.
»Durch die beiden Schüsse, die mir sagten, daß man unser Gespräch belauscht hatte. In diesem Gespräch hatte ich absichtlich eine genaue Zeit genannt, um die Bewegungen der Gegenseite besser kontrollieren zu können.«
»Sie sind ganz schön abgefeimt«, sagte Rander lachend, »aber es hat sich wieder mal gelohnt!«
»Darf ich Ihre Bemerkung dahingehend interpretieren, Sir, daß Sie jetzt an einen Mord glauben, was den Tod des Michael Moberly betrifft?«
»Also schön«, meinte Rander und war plötzlich sehr ernst, »lassen Sie die Puppen tanzen, Parker! Sie haben freie Hand. Dieser Waterson scheint jede Menge Dreck am Stecken zu haben.«
Sue Weston kam nicht mehr dazu, ihrerseits etwas zu sagen. Das hing mit einer Eierhandgranate zusammen, die durch das Fenster geflogen kam, nachdem sie das Glas durchschlagen hatte.
*
»Oh …!« sagte Josuah Parker nur und sah hinunter auf den eiförmigen Sprengkörper, der offensichtlich echt war.
Sue Weston hatte sich an die Brust von Rander geflüchtet.
Rander handelte sofort und warf sich zusammen mit Sue hinter einen der beiden leichten Sessel.
Es war eine Frage von Sekundenbruchteilen, bis der Sprengkörper explodierte.
Josuah Parker löste das anstehende Problem auf seine Art und Weise, also souverän.
Fast gelassen griff er nach seinem Universal-Regenschirm und senkte den bleigefütterten Bambusgriff nach unten. Dann benutzte er seinen Schirm als Golfschläger, nahm erst mal genau Maß und produzierte dann einen Treibschlag, der selbst einen Vollprofi in Erstaunen versetzt hätte.
Die Eierhandgranate wurde voll erwischt und begab sich auf ihre Flugbahn.
Sie zischte durch die zerbrochene Fensterscheibe hinaus in die frische Nachtluft und war nicht mehr zu sehen.
Dafür hingegen war sie gut zu hören.
Noch mitten in der Flugbahn platzte sie auseinander, worauf der Scherbenrest aus dem Fensterrahmen flog und sich ins Zimmer ergoß.
»Donnerwetter«, sagte Rander, der bleich um die Nase geworden war und sich jetzt erhob. Er half Sue auf die Beine, die sich nach wie vor gegen seine Brust lehnte.
»Ein Attentat, Sir!«
»Sie hätten diesen Pfleger nicht gehenlassen dürfen«, meinte Rander vorwurfsvoll.
»Ich glaube kaum, Sir, daß der Stoppelbärtige für diesen Anschlag verantwortlich zeichnet«, gab der Butler gemessen zurück, »hier dürften bereits andere Kräfte am Werk sein, wie ich unterstellen möchte.«
*
Sheriff Denver sah verschlafen und leicht verkatert aus, als er auf der Bildfläche erschien. Seine Stimmung war dementsprechend gereizt.
»Eierhandgranate!?« fragte er skeptisch, »sind Sie sicher, daß es eine war?«
»Bei Tageslicht besehen werden Sie die Spuren der Explosion leicht feststellen können«, erwiderte Parker.
»So was gibt es doch gar nicht«, wunderte sich Denver, »so was hat’s hier noch nie gegeben.«
»Wir haben sie sehr genau gesehen«, schaltete Mike Rander sich ein, »und drüben das Fenster, Sheriff. Aus einer Laune heraus haben wir’s bestimmt nicht zertrümmert.«
»Wie lange werden Sie hier in Stratford bleiben?« erkundigte sich Denver mißmutig.
»Was hat das mit der Eierhandgranate zu tun, Sheriff?« Rander wunderte sich.
»Seitdem Sie hier aufgekreuzt sind, gibt es nichts als Ärger. Zuerst die Autopsie, dann diese wirren Mordanklagen und jetzt die angebliche Eierhandgranate.«
»Das alles paßt Ihnen nicht, wie?« Rander konnte nur noch ironisch sein.
»Wir wollen hier unsere Ruhe haben«, meinte Sheriff Denver, »und was den angeblichen Mord betrifft, so sind das Hirngespinste, wenn sie mich fragen.«
»Sie können sich nicht vorstellen, daß so etwas im Sanatorium passiert, oder?«
»Hören Sie, Mister Parker, ich kenne Doc Waterson seit ein paar Jahren. Ein erstklassiger Arzt und Bürger unserer Stadt. Bisher hat es noch nie Ärger mit ihm gegeben. Lächerlich, daß in seinem Sanatorium ein Mord passiert sein soll!«
»Ausgesprochen lächerlich, daß eine Eierhandgranate ins Zimmer geworfen wurde!« Rander lächelte mokant.
»Sehen Sie da etwa einen Zusammenhang?« Sheriff Denver fauchte den jungen Anwalt wütend an.
»Parker, jetzt sind Sie an der Reihe.« Rander wandte sich an seinen Butler, »ich denke, auch Sie haben noch etwas zu erzählen.«
Parker faßte sich kurz, was seine Erlebnisse mit dem Pfleger angingen. Er berichtete sehr konzentriert von der Mauerbesteigung seines Doubles und der beiden Schrotschüsse.
»Hoffentlich können Sie all diesen Unsinn auch beweisen«, sagte Sheriff Denver, als Parker geendet hatte, »falls nicht, sollten Sie sich um ’nen Freiplatz im Sanatorium bemühen. Dann hätten Sie’s nämlich dringend nötig.«
*
»Na, wo haben wir denn die Puppe, die an der Mauer hochgestiegen ist?«
In Denvers Stimme schwangen Hohn und auch so etwas wie eine gewisse Erleichterung mit.
Es war hell geworden, und Denver, Parker und Rander hatten sich hinaus zur Mauer begeben. Zu Parkers Enttäuschung war von der Puppe nichts mehr zu sehen. Auch die Zeituhr war verschwunden. Von dem Minisender mal ganz zu schweigen, den er immerhin gut versteckt hatte.
Die Gegner hatten ganze Arbeit geleistet und alle Spuren hervorragend verwischt. Irgendwie hatte Parker ja damit gerechnet, doch diese Präzision beeindruckte ihn. Selbst das Gras stand hoch und fest. Es schien niemals niedergetreten worden zu sein. Bis auf die Stellen natürlich, wo Parker sich in der Nacht bewegt hatte.
»Gehen wir also zu Waterson«, redete Denver weiter, »unterhalten wir uns mit dem Pfleger, den Sie angeblich in Ihrem Pensionszimmer überrascht haben.«
Eine Viertelstunde später standen sie im Besuchszimmer des Sanatoriums diesem Pfleger gegenüber. Der Mann hatte sich zwar frisch rasiert, aber sah dennoch etwas ungepflegt aus.
Er wußte selbstverständlich von nichts.
»Ich bestreite ganz entschieden, bei Ihnen im Zimmer gewesen zu sein«, sagte er aufgebracht, »und ich habe Zeugen dafür, daß ich die ganze Nacht über hier im Haus gewesen bin. Ich hatte zusammen mit Steve Nachtdienst auf der geschlossenen Station. Und auch mit Mistreß Colbert. Soll ich sie holen?«
»Was er sagt, stimmt!« Dr. Waterson, der sich ebenfalls im Zimmer aufhielt, nickte bestätigend, um sich dann an Josuah Parker zu wenden, »sind Sie sicher, nicht das Opfer eines vielleicht außergewöhnlichen Alptraums gewesen zu sein?«
»Wenn Sie gestatten, Sir«, erwiderte Parker, »werde ich mir die Freiheit nehmen, Sie in den nächsten Tagen zu konsultieren. Mir scheint, daß ich tatsächlich etwas überreizt bin.«
*
Auch die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten, wie sich schnell herausstellte.
Der Besuch an der Mauer des Sanatoriums war vorgezogen worden. Jetzt auf der Rückfahrt und wieder in Stratford, wollte Sheriff Denver sich die Wirkung der Handgranate aus der Nähe ansehen.
Nun, er sah zwar etwas, aber nicht das, wovon Parker gesprochen hatte. Denver sah einen brennenden Holzschuppen, dessen Dach gerade in sich zusammenrutschte.
Dieser Schuppen befand sich genau unterhalb der Flugbahn, die die Eierhandgranate genommen haben mußte. Wahrscheinlich war sie von der Gewalt der Explosion durchgeschüttelt worden, und das Holz hatte die herumwirbelnden Granatsplitter aufgenommen.
Von diesen Dingen aber war nichts mehr zu sehen. Der bewußte Holzschuppen war nur noch eine kleine Feuerhöhle. Das trockene Holz brannte wie Zunder, den man zusätzlich noch mit Benzin behandelt haben mußte.
Nach Treibstoff roch es nämlich penetrant.
»Natürlich reiner Zufall«, sagte Rander und grinste Denver ironisch an. Dann wies er hinüber auf die Rückseite der Pension, in der sie abgestiegen waren, »von dort bis hierher hätte man ja auch niemals eine Eierhandgranate werfen können!«
»Sie sagen es«, meinte Denver und nickte zufrieden, »um den Schuppen ist es nicht schade …«
»Schade aber um die Beweismittel«, meinte Rander.
»Hirngespinste! Was versprechen Sie sich von diesen Märchen, Mister Rander? Ich weiß, Sie sind Anwalt. Warum ziehen Sie dann solch eine Show ab? Warum wollen Sie Waterson unbedingt etwas am Zeug flicken?«
»Vielleicht meine sehr private Form der Freizeitbeschäftigung«, gab Rander ärgerlich zurück, »seit wann sind Sie eigentlich als Sheriff dieses Bezirks tätig?«
»Seit fast zehn Jahren!«
»Es geschehen immer wieder Zeichen und Wunder«, spöttelte der junge Anwalt, »die Bewohner des Bezirks scheinen nicht gerade hohe Ansprüche zu stellen!«
Dieser Wortwechsel wurde nicht unter vier Augen geführt. Es gab eine Menge neugieriger Zuschauer, die sich kein Wort entgehen ließen. Und wie beliebt Denver war oder sein mußte, zeigte sich an den Reaktionen auf ihren Gesichtern. Von offenem Spott bis hin zur Verlegenheit spiegelten diese Gesichter alles wider. Denver schien in ihren Augen ein zwar skurriler, aber dennoch ausgeprägter Trottel zu sein.
Rander hielt eine weitere Unterhaltung für sinnlos. Er nickte seinem Butler zu und ging dann zusammen mit ihm hinüber zur nahen Hotelpension.
Denver sah ihnen nach. Sein Mund war zu einem schmalen Strich geworden, wie es in einschlägigen Romanen immer wieder so treffend heißt. Seine Gedanken schienen nicht gerade rosa gefärbt zu sein.
»Nun sagen Sie schon, daß ich ihn nicht auf die Palme hätte bringen sollen«, wandte Rander sich an seinen Butler.
»Sheriff Denver dürfte das sein, Sir, was man gemeinhin verstimmt nennt.«
»Das ist mir gleichgültig. Soviel Ignoranz reizt mich einfach.«
»Mister Denver ist vielleicht, was diesen Fall betrifft, einfach überfordert.«
»Auf keinen Fall! Dumm ist er nicht, nur befangen. Wissen Sie, mir kommt da gerade ein Gedanke. Ob er nicht von Waterson gekauft sein könnte?«
»Sir, es handelt sich immerhin um einen Vertreter des Gesetzes.«
»Na, und … wäre er der erste Vertreter unseres Gesetzes, der Schmiergelder annimmt? Auch Sheriffs sind nur Menschen. Sie sind doch keine Ausnahmenaturen. Nein, nein, Parker, Denver spielt ein falsches Spiel, wenn Sie mich fragen! Und was die Autopsie angeht, ich werde sie wiederholen lassen, falls die Moberlys einverstanden sind, und zwar von neutralen Sachverständigen. Jetzt will ich es genau wissen!«
Sie hatten inzwischen die Vorderfront der Hotelpension erreicht und betraten die kleine Empfangshalle.
Der Tagesportier winkte ihnen zu, kam um die Theke der kleinen Rezeption herum und überreichte Rander einen Brief.
Der Anwalt studierte den Absender.
»Von den Moberlys«, sagte er dann zu Parker, während er den Umschlag neugierig öffnete. Rander überflog die wenigen handschriftlichen Zeilen.
»Das ist aber eigenartig«, sagte er dann, Parker den Brief reichend, »die Moberlys sind abgefahren. Das geht in Ordnung. Aber sie entbinden uns von der Weiterverfolgung dieses Falls. Sie schreiben, daß sie sich durch die Autopsie haben überzeugen lassen, daß jeder Verdacht auf Mord unbegründet ist. Wie finden wir denn das, Parker?«
»Ich erlaube mir, Sir, dazu das Prädikat ausgezeichnet zu wählen. Inzwischen scheint man auch das Ehepaar Moberly unter Druck gesetzt zu haben!«
*
Parker benahm sich wirklich mehr als auffällig.
Er stand auf dem Dach seines hochbeinigen Monstrums und benutzte ein schweres und leistungsstarkes Fernglas, um das Gelände des Sanatoriums zu beobachten.
Er mußte mit Sicherheit von den Gebäuden dieses Sanatoriums aus gesehen werden. Aber das schien ihn nicht zu stören. Genau das Gegenteil war sogar der Fall. Er sorgte immer wieder dafür, daß das Sonnenlicht sich in der Optik des Fernglases derart spiegelte, daß die Lichtreflexe unbedingt bemerkt wurden.
Parker trieb dieses Spiel vielleicht zehn Minuten lang, als sich etwas Sichtbares tat.
Im Obergeschoß des Haupt- und Verwaltungsgebäudes bewegte sich eine Gardine. Dann erkannte Parker durch sein Fernglas, daß er nun endlich seinerseits beobachtet wurde. Hinter der Gardine stand eine Gestalt, die ebenfalls ein Fernglas benutzte.
Parker genierte sich nicht.
Genau diese Reaktion hatte er herausfordern wollen. Er war gespannt, wie man jetzt reagieren würde. Er konnte sich lebhaft vorstellen, daß gewisse Leute im Sanatorium nervös wurden.
Sie benutzten einen Landrover und preschten in schneller Fahrt an die Mauer heran. Sie hielten so, daß sie vom Wagen aus gerade noch den Butler auf dem Dach seines Monstrums sehen konnten.
Parker senkte sein Fernglas, regulierte die Schärfe und erkannte zwei liebe alte Bekannte. Es handelte sich um die beiden Pfleger Hank und Steve, wie er inzwischen wußte. Hank, der Mann mit den Bartstoppeln, wirkte irgendwie gehemmt und verlegen. Und jetzt, es war deutlich zu sehen, zwinkerte er dem Butler zu. Da er wußte, daß er durch das Fernglas beobachtet wurde, konnte er sicher sein, daß dieses Zwinkern auch bemerkt wurde.
Parker nahm dieses Zwinkern zur Kenntnis, ohne es im Moment zu werten. Er nahm das Fernglas wieder etwas höher und übersah dann im wahrsten Sinn des Wortes die beiden Pfleger des Sanatoriums.
»Was – was soll denn das?« rief Steve ihm schließlich zu. Der Schnurrbartträger hatte sich im offenen Landrover hochgestellt und winkte, um sich zusätzlich bemerkbar zu machen.
Parker dachte nicht im Traum daran, auf diese Frage zu antworten. Er ignorierte die beiden Männer, die jetzt leise miteinander beratschlagten, um dann sehr schnell zu wenden und zurück zum Hauptgebäude zu fahren.
Nun stieg auch der Butler vom Dach seines hochbeinigen Monstrums und setzte sich ans Steuer. Er fuhr ein gutes Stück an der Mauer entlang, bis er einen neuen, günstigen Beobachtungspunkt erreicht hatte.
Dann begann sein Spiel von vorn.
Er begab sich hinauf auf das Dach seines Wagens und betätigte sich wieder als Beobachter, sehr ungeniert und betont auffällig. Er wußte inzwischen, wie stark er gewisse Nerven strapazierte. Ein Mann wie Doc Waterson zum Beispiel litt mit Sicherheit bereits unter erhöhtem Blutdruck.
Es dauerte etwa zehn Minuten, bis der Landrover wieder erschien.
Diesmal saß auch Waterson mit im Wagen. Er stieg aus und kam schnell auf die Mauer zu, hinter der Parker sich auf dem Wagendach aufgebaut hatte.
»Mister Parker! Mister Parker?!«
Der Butler lüftete höflich seine schwarze Melone.
»Was bezwecken Sie eigentlich damit?« rief Waterson gereizt, »soll ich Ihnen den Sheriff an den Hals schicken? Ich verbitte mir diese Spioniererei. Meine Patienten werden unruhig.«
»Erfreulich, daß dies im Gegensatz zu Ihnen geschieht«, gab der Butler höflich zurück, »aber wenn Sie darauf bestehen, werde ich selbstverständlich das räumen, was man gemeinhin das Feld nennt.«
Ohne sich weiter um Waterson zu kümmern, stieg Parker vom Wagendach und fuhr davon, um nach einer Viertelstunde und an anderer Stelle sich erneut aufzubauen. Gewiß nicht aus dem Grund, die Patienten des Sanatoriums zu beunruhigen. Dem Butler ging es um ganz andere Personen.
*
Es ging auf Mittag zu, als Josuah Parker seine Rundreise um die Sanatoriumsmauer beendete.
Er hatte den Landrover noch in zwei weiteren Fällen zum Herumkurven gezwungen. Und er hatte zur Kenntnis genommen, daß die beiden Pfleger Hank und Steve sich darauf beschränkt hatten, ihn nur schweigend zu beobachten.
Parker hatte aber auch eine zusätzliche Kleinigkeit registriert.
Beim Beobachten der Gebäude war ihm ein Handtuch aufgefallen, das aus dem Oberlicht eines der Bungalows hervorgestreckt und bewegt worden war. Dieses Handtuch schien ihm ein bestimmtes Signal mitzuteilen, doch was dieses Signal bedeutete, vermochte der Butler natürlich nicht zu sagen.
Im Zusammenhang mit dem Handtuch dachte er spontan an Clive Muscat, mit dem Michael Moberly befreundet gewesen war. Dieser junge Mann, der als Robin Hood aufgetreten war, hatte ihn schließlich schon mal gewarnt, als er auf das Abhörgerät im Besuchszimmer hingewiesen hatte. Wollte Muscat – wenn er es gewesen war – ihm mitteilen, daß er festgehalten wurde, daß er eingesperrt worden war? Oder bedeutete das Winken mit dem Handtuch eine intensive Warnung?
Parker steuerte seinen hochbeinigen Wagen gerade hinauf auf die Landstraße, die, nach Stratford führte, als ihm plötzlich der Weg versperrt wurde.
Der bewußte Landrover schoß förmlich hinter einem dichten Gesträuch hervor und stelle sich quer zur Straße. Am Steuer erkannte Parker den Schnurrbärtigen. Neben ihm saß Doc Waterson.
Parker mußte sich blitzschnell entscheiden, was zu tun war. Sollte er sich auf eine Unterhaltung einlassen, die Waterson mit Sicherheit von ihm fordern wollte? Oder sollte er Waterson einfach aus dem Weg gehen und ihn leerlaufen lassen?
Dr. Waterson richtete sich auf und hielt sich an der Windschutzscheibe fest. Er winkte Parker zu und schien ihm auch etwas zuzurufen. Was der Butler übrigens nicht verstand, denn aus gewissen Gründen der Sicherheit hatte er sämtliche Fenster seines Wagens geschlossen. Das Panzerglas hatte sich bereits in der Vergangenheit schon als günstig erwiesen, wenn man auf Parker geschossen hatte. Offen, oder nur aus dem Hinterhalt heraus.
Josuah Parker kam zu einem Entschluß.
Seiner Ansicht nach war es noch zu früh, sich mit dem Chef des Sanatoriums zu unterhalten. Waterson sollte und mußte noch etwas im eigenen Saft braten.
Ohne sich also um das Winken des Arztes zu kümmern, kurvte der Butler mit seinem hochbeinigen Monstrum geschickt um den quergestellten Landrover herum. Ihm kam zustatten, daß sein Wagen eben derart hochbeinig war, daß er unebenes Gelände noch leichter nehmen konnte als ein Rover.
Im Rückspiegel beobachtete Parker, daß Waterson ihm verblüfft nachschaute. Mit dieser Reaktion hatte der Arzt sicher nicht gerechnet. Er ließ sich gerade zurück auf seinen Sitz fallen, während der Schnurrbärtige sich mühte, den Landrover wieder auf die Straße zu bekommen.
Die erwartete Verfolgung blieb aus, wie sich herausstellte.
Der Landrover kurvte zurück in das unübersichtliche Gelände und war bald verschwunden. Parker steigerte das Tempo seines Wagens und ließ dabei seine schwarz behandschuhte Hand mit den Kipphebeln und Tasten des Armaturenbretts spielen, worauf sich erstaunliche Dinge taten.
Unter dem Wagen, etwa in Höhe des Auspufftopfes, rasselte eine normale Eisenkette hinunter auf den Boden. Diese Eisengliederkette war etwa 30–40 Zentimeter lang und mündete in einer Art Glockenklöppel.
Dieser Glockenklöppel schlug und hämmerte auf den unbefestigten Feldweg und wirbelte hohe Staubwolken hoch. Es dauerte nur knapp hundert Meter, bis Parkers Wagen eine lange, dichte und gelbe Staubwolke hinter sich ließ, die jede Sicht versperrte.
Parker nutzte diese Staubwand, um hinter dem nächsten Wegknick scharf nach rechts abzubiegen. Er hielt zwischen hohem Gesträuch und barg erst mal seine Staubkette. Dann stellte er den Motor ab und verließ den Wagen.
In taktisch günstiger Position bezog er Stellung. Parker hatte, wenn es verlangt wurde, sehr viel Geduld. Sie hatte sich in der Vergangenheit schon recht oft mehr als gelohnt.
*
Es dauerte etwa fünf Minuten, bis der Landrover sich durchgekämpft hatte.
Zuerst hörte Parker nur den bulligen Motor, dann sah er den Wagen, der sich schemenhaft durch den hochgewirbelten Staub schob. Sehr langsam und sehr vorsichtig.
Parker wartete weiter, und es dauerte wiederum zehn Minuten, – bis der Landrover sein Versteck erneut passierte. Diesmal war der Wagen erheblich schneller, da die Staubwolken sich bereits zu legen begannen.
Parker erkannte Dr. Waterson und den Schnurrbärtigen Steve. Beide Männer schienen sich vergewissert zu haben, daß Parker wirklich das nähere Gelände des Sanatoriums verlassen hatte.
Genau darauf war es dem Butler angekommen.
Er legte seinen Universal-Regenschirm korrekt über seinen linken Unterarm und schritt dann würdevoll und gemessen durch das mit Gesträuch und Gestrüpp übersäte Gelände. Sein Ziel war eine kleine Anhöhe, von der aus man das Parktor des Sanatoriums beobachten konnte.
Parker hätte auch jetzt nicht sagen können, warum er sich so verhielt. Er handelte instinktiv aus einem vagen Mißtrauen, aus einem Verdacht heraus. Er konnte sich nämlich vorstellen, daß Waterson die Gelegenheit nutzte, um Gefahrenmomente aus dem Weg zu räumen.
Wie gut Parker sich in die Gedankenwelt der Gegenseite zu versetzen vermochte, sollte sich bald zeigen.
Nach etwa 30 Minuten öffnete sich das Parktor des Sanatoriums. Fast zögernd erschien ein kleiner Sportwagen, in dem zwei Bekannte saßen.
Das Steuer hatte der Schnurrbartträger Steve übernommen. Neben ihm saß der Pfleger Hank, der gegen seine Bartstoppeln einfach nicht ankam. Die beiden Pfleger trugen Zivilkleidung und schienen sich einen schönen Tag zu machen.
Sie nahmen Richtung auf die nahe Asphaltstraße, doch dazu mußten sie erst noch den unbefestigten Feldweg benutzen, den Parker mit seiner Eisenkette gepflügt hatte.
Parker wollte sich schon wieder dem Sanatorium widmen, als ihm eine Kleinigkeit auffiel.
Als der kleine Sportwagen vom Parktor auf den Feldweg kurvte, rutschte der Pfleger mit den Bartstoppeln etwas weich und schlaff gegen den Fahrer des Wagens. So, als wäre er nicht mehr Herr seiner Muskeln und Bewegungen.
*
Steve, der Pfleger mit dem Schnurrbart, beendete sehr schnell seine Ausfahrt. Zu schnell, wie Parker fand.
Der Butler war zurück zu seinem Wagen gegangen.
Und diesmal hatte Parker sich etwas mehr beeilt als sonst. Ja, im Grund hatte er eine unziemliche Hast an den Tag gelegt, die er sich normalerweise nie gestattet hätte. Parker hatte nämlich das sichere Gefühl, daß er die beiden Pfleger nicht aus den Augen lassen durfte.
Er hatte seinen Wagen erreicht und – blieb dann stehen. Parker brauchte nicht weiterzugehen. Wie auf einer Bühne spielte sich alles in seiner unmittelbaren Nähe ab. Die beiden Pfleger schienen vollkommen sicher zu sein, daß sie nicht beobachtet wurden.
Das heißt, diese Sicherheit hatte nur Steve.
Sem Partner Hank hingegen wirkte ungemein teilnahmslos. Ja, er schien inzwischen sogar eingeschlafen zu sein. Er hing mit dem Oberkörper halb über der seitlichen kleinen Wagentür und machte einen völlig desinteressierten Eindruck.
Was den Butler stutzig machen ließ.
Zumal Steve jetzt den Kofferraum öffnete und einen Benzinkanister hervorzog. Ihm war keineswegs das Benzin ausgegangen. Er öffnete den Verschluß des Kanisters und – schüttete eine gehörige Portion Treibstoff in den Kofferraum.
Dann wanderte er um den Wagen herum und übergoß die Sitze. Beide Sitze, um ganz genau zu sein. Dabei kümmerte es ihn überhaupt nicht, daß sein Partner Hank noch auf dem Beifahrersitz saß. Ja, auch Hank bekam eine gehörige Portion mit ab. Steve erwies sich als sehr benzinbewußt.
Parker hatte selbstverständlich schon lange und richtig geschaltet.
Hier sollte ein Türke gebaut werden, wie der Volksmund es vielleicht ausgedrückt hätte, deutlicher gesagt, es sollte ein tödlicher Unfall inszeniert werden. Ein Mord an dem Pfleger Hank!
Warum das so sein mußte, lag klar auf der Hand.
Der Krankenpfleger Hank hatte sich eine Blöße gegeben, als er den Minisender aus Parkers Hotelzimmer hatte holen wollen. Das war seinen Auftraggebern sicher nicht entgangen. Oder Hank selbst hatte in aller Offenheit davon berichtet. Hank war also zu einer Gefahr geworden. Mit Sicherheit hatte er noch mehr zu erzählen, falls man ihn in die Zange nahm.
Und solchen möglichen Erzählungen sollte jetzt vorgebaut werden. Ein toter Zeuge konnte eben nicht mehr reden. Und einem Toten konnte man alles in die Schuhe schieben, was unbequem war.
Später, nach der Brandsetzung, konnte man den ganzen Vorfall so darstellen, als habe Hank einen Wagen widerrechtlich benutzt und sich dabei zu Tode gefahren. Die Welt war ja voller Gefahren.
Da Josuah Parker schon immer etwas gegen Mord hatte, mußte er sich sehr schnell etwas einfallen lassen. Es wurde sogar höchste Zeit dazu, denn Pfleger Steve hatte seine Benzinverteilung beendet, und ließ den leeren Kanister, dessen Verschluß er zugeschraubt hatte, zurück in den Kofferraum gleiten. Dann trat er prüfend zur Seite und begutachtete sein mörderisches Werk.
Parker handelte inzwischen.
Er verdrehte den bleigefütterten Bambusgriff seines Universal-Regenschirms gegen den eigentlichen Schirmstock, der nichts anderes war als ein erstklassiges Blasrohr, auf das selbst Indianer des Amazonas neidisch geworden wären.
Durch das Verdrehen des Griffs tat sich zweierlei. Einmal wurde eine CO-Gaspatrone in Blasbereitschaft versetzt, zum zweiten wartete ein buntgefiederter Blasrohrpfeil darauf, durch das Treibgas in Bewegung gesetzt zu werden.
Steve war soweit.
Parker übrigens auch.
Jetzt hing alles davon ab, ob Parker auch genau traf.
*
Und wie er traf.
Mit feinem Zischen jagte der Blasrohrpfeil durch den hohlen Schirmstock und begab sich auf die Luftreise, die nicht lange währte.
Steve zuckte wie unter einem harten Peitschenhieb zusammen, als die Spitze des Pfeils sich in seine rechte Gesäßhälfte bohrte. Sein Gesicht nahm einen völlig verblüfften Ausdruck an. Dann griff er fast zögernd nach der schmerzenden Stelle und hielt den buntgefiederten Pfeil in der Hand.
Seine Verblüffung mußte enorm sein.
Er konnte sich auf keinen Fall erklären, woher dieser Pfeil wohl gekommen war. Er war nicht größer als eine kleine Stricknadel, sah aber unheimlich aus. Steve hatte nichts gehört, sondern plötzlich nur etwas gespürt. Und zwar sehr deutlich.
Er wendete und drehte den Pfeil in der Hand, duckte sich nervös und mißtrauisch ab und beobachtete die grüne Mauer des nahen Strauchwerks. Dann wollte er sich wohl schleunigst absetzen und die Flucht ergreifen. Doch dazu fand er keine Kraft mehr.
Er schaffte zwei Schritte, dann taumelte er, knickte in den Knien ein und schlug wie ein gefällter Baum zu Boden. Er kroch vielleicht noch viereinhalb Zentimeter über die Grasnarbe und blieb dann regungslos liegen.
Das Betäubungsgift, mit dem die Spitze des Pfeils bestrichen war, hatte wieder mal nachhaltig gewirkt. Parker durfte mit seiner Geheimwaffe mehr als zufrieden sein.
Er wartete noch einen Moment ab, um dann langsam hinüber zum Sportwagen zu gehen. Auch die nächsten Maßnahmen wollten schließlich genau überlegt sein.
*
Der Sportwagen loderte wie eine Pechfackel.
Er war kaum noch zu erkennen, so tobten und wüteten die Flammen. Schwarzer Qualm strich seitlich ab und hüllte die nähere Umgebung ein. Es war nur noch eine Frage von Sekunden, bis der Tank explodierte.
»Zurück. In Deckung!« schrie Doc Waterson und ging mit gutem Beispiel voran. Er lief hinüber zu den nahen Bäumen und suchte Schutz. Zwei Pfleger, die Parker bisher noch nicht gesehen hatte, folgten Waterson und warfen sich auf den Boden.
Parker paßte scharf auf. Er wollte nicht überlistet werden. Er hatte keine Neigung, in diese Flammenhölle geworfen zu werden.
Er ließ seine Vorsicht selbstverständlich nicht erkennen. Parker tat so, als sei er völlig ahnungslos. Er baute sich ebenfalls hinter einem Baumstamm auf. Und zwar etwas vor Waterson, der damit schräg hinter ihm stand.
Parker nahm seine schwarze Melone ab und fächelte sich scheinbar kühle Luft zu, doch in Wirklichkeit benutzte er den eingebauten Innenspiegel, um Waterson genau zu beobachten. Übrigens nicht nur ihn, sondern auch die beiden Pfleger, die weiße Kittel trugen.
Parker hatte im Sanatorium Alarm geschlagen, nachdem der Sportwagen in Flammen aufgegangen war. Waterson und die beiden Pfleger erschienen daraufhin ungemein schnell am Parktor und waren mit ihrem Landrover hinüber zur Brandstelle gebraust, gefolgt von Parker, der sein hochbeiniges Monstrum benutzt hatte.
Parker zuckte unwillkürlich zusammen, als der Benzintank auseinanderplatzte.
Es gab eine gewaltige Detonation, die Druckwelle rüttelte und zerrte an seinem Körper. Blechteile des Wagens wurden hoch in die Luft geschleudert und regneten als kleine Brandbomben zurück auf den Boden. Der Sportwagen war jetzt überhaupt nicht mehr zu erkennen.
Ein schneller Kontrollblick in den Spiegel der schwarzen Melone.
Ein schneller Blick, der sich lohnte.
Waterson winkte hastig nach rechts.
Die beiden Pfleger, die sich zu Boden geworfen hatten, standen schnell auf und liefen auf Waterson zu, der ihnen etwas zurief, was Parker wegen des prasselnden Feuers nicht verstand.
Die beiden Pfleger duckten sich ab wie Katzen, die gemeinsam einen arglosen Vogel beschleichen wollen. Ihr Ziel war Parker, wie der Melonen-Innenspiegel deutlich bewies.
Parker wartete, bis sie sich ihm auf drei, vier Meter genähert hatten. Noch waren die beiden Männer waffenlos, aber wahrscheinlich wollten sie sich auf ihre Muskeln und ihre Pfleger-Spezialgriffe verlassen.
Wollten sie ihn wirklich angreifen? Oder mißverstand er ihre Annäherungsversuche? Wollten sie sich nur näher an den brennenden Wagen heranschieben?
Parker blieb ruhig und entspannt. Er hatte keine Angst. Auch zwei handfeste Gegner waren nicht in der Lage, seine Nerven in Unordnung zu bringen. Dazu mußte man schon mit ganz anderen Geschützen feuern.
Parker wandte sich zu ihnen um und lächelte neutral.
Die beiden Pfleger blieben sofort stehen und schauten ihn aus kalten Augen an. Es waren Augen von harten Profis, wie Parker sofort erkannte. Es waren die Augen von Männern, deren Handwerk aus Mord bestand.
Sie wußten nicht, was sie tun sollten.
Einer von ihnen, ein Mann mit einer hohen Stirnglatze, drehte sich etwas verlegen zu Waterson um, der hinter seinem Baumstamm hervorkam.
Der zweite Pfleger, ein Mann mit einer ausgeprägten Hakennase, griff langsam in seine Hosentasche. Sicher nicht, um sein Taschentuch hervorzuholen.
Die Situation spitzte sich zu, zumal alle Beteiligten plötzlich genau wußten, wer sie waren und welche Rolle sie spielten. Es gab keine Geheimnisse mehr, keine Tarnung. Man wußte wechselseitig, was man voneinander zu halten hatte.
»Kann ich möglicherweise irgend etwas für die Herren tun?« erkundigte sich Parker höflich. Dabei fixierte er die beiden Pfleger und auch Waterson, der sich inzwischen näher herangeschlichen hatte.
Parkers Höflichkeitsfloskel, die in diesem Moment Sinnlos und grotesk erschien, schuf Unsicherheit. Die beiden Profis mit den kalten Augen wurden leicht verunsichert. Mit dieser Frage hatten sie auf keinen Fall gerechnet.
Jetzt sah sich der Mann mit der ausgeprägten Hakennase fragend nach Waterson um.
Dr. Waterson war in Schweiß geraten, wie seine Stirn verriet. Und dieser plötzliche Schweißausbruch hing sicher nicht mit dem brennenden Auto und der sengenden Hitze zusammen, die dem Autowrack entströmte.
In diesem Augenblick war die auf und ab schwellende Sirene eines Polizeistreifenwagens zu vernehmen.
Waterson senkte den Kopf und ging mit müden Schritten weg.
Die beiden Profis in den weißen Pflegerkitteln entspannten sich und folgten ihrem Herrn und Meister. Der Mann mit der Hakennase nahm dabei langsam die Hand aus seiner Hosentasche.
*
Sheriff Denver verzichtete darauf, den Brand mit seinem Feuerlöscher zu bekämpfen. Was in diesem Stadium zweifellos richtig war, denn zu erreichen war nichts. Das Feuer hatte seinen Höhepunkt bereits überschritten und fiel in sich zusammen.
»Sie haben den Brand zuerst bemerkt?« Denver wandte sich an Parker.
»In der Tat, Sir«, gab Parker zurück, »daraufhin informierte ich das Sanatorium und bat darum, die zuständige Polizei zu alarmieren.«
»Erzählen Sie genauer!«
»Ich fürchte, Ihre Erwartungen enttäuschen zu müssen«, meinte Josuah Parker, »ich kann nur wiederholen, daß ich den brennenden Wagen entdeckte, der bereits in hellen Flammen stand, wie der Volksmund es wohl auszudrücken pflegt.«
»Irgendwelche Insassen?« Denver sah den Butler scharf an.
Dr. Waterson zeigte sofort großes Interesse an diesem Thema und schob sich näher an Denver und Parker heran. Die beiden Profis in ihren weißen Pflegerkitteln hielten sich abseits. Das heißt, sie näherten sich langsam dem brennenden Wagen. Sie wollten wohl auskundschaften, was im Wrack noch zu erkennen war. Wahrscheinlich hatten sie in dieser Hinsicht sehr genaue Vorstellungen.
»Sie fragen nach Insassen.« Parker schüttelte langsam den Kopf. »Ich fürchte, Sir, Sie erneut enttäuschen zu müssen. Von Insassen konnte ich nichts feststellen, wobei ich allerdings bemerken möchte, daß es mir bereits unmöglich war, näher an den Wagen heranzugehen. Er brannte schon zu sehr.«
»Warten wir’s also ab«, sagte Sheriff Denver. Dann nahm er sich Waterson vor und deutete auf den Wagen. »Der Wagen kommt mir irgendwie bekannt vor, Doc.«
»Kunststück!« Waterson nickte, »es ist mein Sportwagen. Ein kleiner Lancia. Wie er hierher auf die Straße gekommen ist, kann ich wirklich nicht sagen.«
»Demnach muß er also widerrechtlich benutzt worden sein.«
»Das ist anzunehmen, Sheriff.«
»Von wem?«
»Keine Ahnung, Sheriff. Von mir hat keiner vom Personal die Erlaubnis bekommen, den Sportwagen zu benutzen. Er muß also …«
»… gestohlen worden sein«, schaltete Josuah Parker sich gemessen ein, »vielleicht von einem Ihrer Patienten. Waterson?«
»Das – das wäre schon möglich, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann.«
»Dann vielleicht von einem Ihrer Angestellten?« Diese Frage stellte Sheriff Denver.
»Kaum anzunehmen. Aber möglich ist ja schließlich alles, Sheriff.«
»Hallo, Doc!« Einer der beiden Pfleger-Profis rief nach dem Chef des Sanatoriums und deutete dabei auf das Auto, dessen Flammen inzwischen in sich zusammengefallen waren.
Parker, Sheriff Denver und Waterson gingen schnell zum Wrack hinüber.
»Der Wagen muß leer gewesen sein«, meldete der Profi mit der Stirnglatze. Während er sprach, wurde Watersons Gesicht zu einer undurchsichtigen Maske.
»Leer?« erkundigte sich Parker in einem scheinbar überraschten Tonfall, »demnach müßte der Fahrer sich doch in der Nähe aufhalten.«
»Tatsächlich, leer!« Sheriff Denver schirmte mit der flachen Hand sein Gesicht gegen die Hitze ab, die der Wagen ausströmte. Er hatte sich gefährlich nahe an das glühende Wrack herangeschoben.
»Möglicherweise liegt der Fahrer ganz in der Nähe. Verletzt und nicht in der Lage, sich bemerkbar zu machen«, sagte Josuah Parker würdevoll, »vielleicht sollte man sich auf die entsprechende Suche begeben.«
Die beiden Profis in weißen Pflegerkitteln schwärmten sofort aus. Sie ließen sich diesen Rat nicht noch mal geben. Sie schienen wild darauf zu sein, den Fahrer des Sportwagens zu finden.
Was Parker durchaus verstehen konnte.
*
»Und wo stecken die beiden Typen zur Zeit?« erkundigte sich Mike Rander etwa anderthalb Stunden später. Er saß zusammen mit Sue Weston in Parkers hochbeinigem Wagen. Aus Gründen der Sicherheit fuhren sie durch die Landschaft. Parker wollte vermeiden, daß ihre Unterhaltung abgehört wurde. Da er eine große Anzahl technischer und elektronischer Tricks auf diesem Gebiet kannte, vermied er so jedes Risiko.
»Ich war so frei, Sir, die beiden Herren ein wenig zu separieren.«
»Können Sie auch im Klartext reden?« Rander lächelte amüsiert.
»Gewiß, Sir. Die Herren Hank und Steve befinden sich zur Zeit in einer kleinen Jagdhütte.«
»Sind sie sicher untergebracht?«
»Dafür, Sir, kann ich mich verbürgen!«
»Und wie lange wollen Sie die beiden Pfleger festhalten? Sie wissen, was Sie da praktiziert haben, grenzt an Menschenraub, falls dieser Tatbestand nicht schon gegeben ist!«
»Gewiß, Sir.«
»Und wann wollen Sie die beiden Männer wieder freilassen?«
»Ich denke, Sir, daß man vielleicht nur jenen Pfleger wieder auf freien Fuß setzen sollte, dessen Vorname Steve lautet.«
»Der Bursche also, der Hank umbringen wollte?«
»Gewiß, Sir.«
»Glauben sie, daß er zurück zu Waterson gehen wird?«
»Diese Möglichkeit, Sir, sollte man ihm zumindest einräumen.«
»Damit provozieren Sie doch einen zweiten Mordversuch.«
»Ich hoffe, Sir, widersprechen zu dürfen. Man räumt diesem Steve zwar die Rückkehrmöglichkeit ein, doch ich möchte annehmen, daß er diese Gelegenheit nicht ergreifen wird.«
»Und was geschieht inzwischen mit diesem Hank?« schaltete sich Sue Weston ein.
»Man würde ihn an einen anderen, noch sicheren Ort transferieren, wenn ich es so ausdrücken darf. Mister Hank wird zu einem sehr freiwilligen Faustpfand in unseren diversen Händen werden.«
»Na schön«, Rander nickte, »fragt sich jetzt, was Waterson tun wird. Er weiß, daß der Wagen leer war, als er in Brand geriet. Er muß sich also bestimmte Gedanken machen.«
»Dies, Sir, möchte ich doch sehr hoffen«, gab Parker bescheiden zurück, »ich wäre enttäuscht, wenn es anders käme.«
*
Doc Waterson schien absolut keinem Zugzwang zu unterliegen. Rander, Parker und Sue Weston waren in ihre Hotelpension zurückgekehrt. Das heißt, sie stiegen aus dem hochbeinigen Wagen des Butlers und gingen auf den Hintereingang zu. Es war früher Nachmittag geworden, und große, schwarze Gewitterwolken gaben sich am Himmel ein Stelldichein. Es roch förmlich nach einem fulminanten Gewitter und nach sehr viel Regen.
»Nichts«, sagte Rander, als sie die kleine Hotelhalle betraten. Er hatte eigentlich damit gerechnet, daß Waterson ihnen zumindest eine Nachricht hinterließ.
»Darf ich mir erlauben zu empfehlen, in der Bar einen Erfrischungsdrink zu sich nehmen zu wollen?« meinte Parker in seiner gespreizten Art, »ich möchte inzwischen die Zimmer inspizieren.«
»Sie glauben an eine Falle?«
»Man sollte mit allen Eventualitäten rechnen, Miß Weston«, gab der Butler höflich zurück, »das heißt, eine Falle im normalen Sinn erwarte ich selbstverständlich nicht. Damit würde die Gegenseite ihre bisherige Zurückhaltung aufgeben und Sheriff Denver unnötiges Material in die Hände spielen.«
Ohne sich auf nähere Erklärungen einzulassen, verschwand der Butler über die Treppe nach oben ins Obergeschoß.
Rander nickte Sue Weston zu. Sie schlenderten hinüber in die gemütlich eingerichtete Bar und ließen sich vom Inhaber des Hauses, der gleichzeitig der Barkeeper war, zwei Drinks mixen.
»Draußen beim Sanatorium soll ein Wagen ausgebrannt sein?« erkundigte sich der Mann beiläufig, während er die Drinks servierte.
»Stimmt. Und von dem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen.«
»Komische Geschichte, wie?«
»Vielleicht«, erwiderte Rander, »kennen Sie Doc Waterson?«
»Nur flüchtig«, sagte der Chef der Pension, »er läßt sich hier bei uns in der Stadt kaum sehen.«
»Scheint überlastet zu sein, der Mann.«
»Und wie! Das Sanatorium ist stets ausverkauft.«
»Aber Ärger mit den Insassen gibt es doch wohl kaum?«
Der Inhaber der Pension beschäftigte sich mit dem Polieren eines Glases.
»Kaum«, sagte er dann ein wenig mundfaul.
»Worüber Sheriff Denver sich bestimmt freuen wird.«
»Der bestimmt!« Der Chef des Hauses lächelte ironisch. »Denver interessiert sich fürs Fischen, mehr aber auch nicht. Und er geht hoch, wenn er mal dienstlich werden muß. Wie zum Beispiel vor anderthalb Monaten.«
Rander war klar, daß der Inhaber der Pension auf eine ganz bestimmte Linie hinaus wollte. Dieser Mann wollte ihm etwas mitteilen, aber so, daß man es nicht so deutlich merkte.
»Vor anderthalb Monaten?« gab Rander prompt als Echo zurück.
»Da brach einer aus dem Sanatorium aus und spielte verrückt. Er hatte sich in ’ner kleinen Jagdhütte verschanzt und knallte um sich.«
»Ach nein!« Sue hatte sich eingeschaltet, »dieser Mann hatte sich eine Waffe verschafft?«
»Sie befand sich in der Jagdhütte, die wiederum Waterson gehört!«
»Und konnte Ihr Sheriff diesen Nervenkranken wieder einfangen?«
»Das schon. Aber der Mann war tot, als man ihn aus der Hütte herausholte.«
»Selbstmord?« fragte Rander knapp.
»Denver«, gab der Inhaber der Pension ebenso knapp zurück, »unser Sheriff muß wohl nicht richtig gezielt haben.«
»Hand aufs Herz«, meinte Rander und dämpfte seine Stimme, »Sheriff Denver ist hier in der Stadt wohl nicht sehr beliebt, wie?«
»Kommt darauf an, wen Sie fragen«, gab der Inhaber der Pension zurück, »es gibt Leute, die auf ihn schwören.«
»Und es gibt Leute, die ihn sicher nicht mehr wählen werden, oder?«
»Darauf können Sie sich verlassen, Mister Rander.«
»Zu den Leuten, die ihn mögen, gehört aber sicher Doc Waterson, nicht wahr?« Sue Weston reichte ihm das leere Glas und bat um eine neue Füllung.
»Waterson und Denver sind ein dickes Ei«, meinte der Inhaber der Pension, »muß damit zusammenhängen, daß Denver in einem Haus wohnt, das er verdammt günstig von Waterson gekauft hat. Aber damit will ich nichts gesagt haben. Damit Sie mich nur nicht falsch verstehen!«
»Sagen Sie, wie spricht man eigentlich über Waterson und das Sanatorium?« fragte Mike Rander rundheraus.
»Na, prima«, antwortete der Mann hinter dem Bartresen spontan. Dabei lächelte er abfällig. »Waterson ist eine Kapazität. Aber das müssen Sie doch auch wissen, oder? Und er nimmt nur Patienten auf, die Kies mitbringen.«
»Darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen?« erkundigte sich Sue Weston.
»Nur immer raus damit, ich bin nicht zimperlich!«
»Wie hoch ist eigentlich die Todesrate des Sanatoriums?«
»Also, da bin ich überfragt«, sagte der Mann hinter dem Bartresen schnell und ausweichend, »aber fragen Sie doch mal den alten Archie! Archie Linwood. Er hat das einzige Begräbnisinstitut hier bei uns.«
*
Es war fast dunkel geworden.
Parker war bereits wieder unterwegs. Er war mit seinem jungen Herrn übereingekommen, daß Rander seinen Besuch bei Archie Linwood noch mal wiederholen sollte. Der erste Besuch hatte sich als Fehlschlag erwiesen, der Leichenbestatter war nicht anwesend gewesen.
Im Grunde war Parker sehr davon angetan, daß er sich allein bewegen konnte. Die Begleitung Mike Randers und Sue Westons hätte er zu diesem Zeitpunkt als ausgesprochen störend empfunden.
Der Butler merkte übrigens schon nach knapp fünf Minuten, daß er hartnäckig verfolgt wurde. Und zwar auf eine recht geschickte Art und Weise. Hinter seinem Wagen rollte ein kleiner Lastwagen mit offener Ladepritsche. Dieses Gefährt, das völlig unauffällig aussah, ließ sich einmal zurückfallen, holte dann wieder auf und fiel wieder zurück. Normalerweise hätte der Butler solch einem Wagen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Nach den Vorfällen der vergangenen Stunden aber hatte er auf höchste Alarmbereitschaft geschaltet.
Parker nutzte die Anwesenheit seiner Verfolger geschickt aus. Wahrscheinlich vermuteten sie, daß er sich hinaus zu zwei gewissen Pflegern begeben würde, die man im ausgebrannten Autowrack vermißt hatte. Man hoffte wohl, er würde sie, die Verfolger, auf dem direkten Weg zu ihnen führen.
Woran Parker nicht im Traum dachte.
Er ließ sein hochbeiniges Monstrum in gemessenem Tempo über die asphaltierte Straße rollen und hielt auf das Gebiet der Hügel, Tannen und Fichten zu. Die Straße stieg stetig an, aber sie bot keine Schwierigkeiten.
Dann war der kleine Lastwagen plötzlich hinter ihm verschwunden. Sollte er sich getäuscht haben? Hatte er es gar nicht mit Verfolgern aus dem Sanatorium zu tun gehabt?
Nun, Parker merkte sehr schnell, woher der Wind wehte.
Wahrscheinlich durch Sprechfunkkontakte gesteuert, erschien hinter ihm jetzt ein grauer Ford, der wohl die Rolle des Verfolgers übernommen hatte. Und wahrscheinlich war damit zu rechnen, daß auch dieser Ford noch mal ausgetauscht wurde. Parker erinnerte sich der beiden Pfleger, die in seinen Augen nichts anderes waren als Profis. Und Profis wußten sehr gut, wie man eine Verfolgung durchführte. Hinzu kamen die sicher besseren Ortskenntnisse der Verfolger. Sie konnten Abkürzungen und Seitenwege benutzen, die Parker nicht bekannt waren.
Als Parker den Waldbereich und die Hügel erreicht hatte, ging er zu Aktionen über. Ihm kam es darauf an, die Verfolger festzunageln im wahrsten Sinne des Wortes.
Doch er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Auftrag der Burschen lautete mit Sicherheit auf Mord. Sie wollten diesen Auftrag so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Im Rückspiegel stellte Parker fest, daß der Ford sehr schnell wurde und aufholte. Möglicherweise wurden jetzt im Wagen sogar gewisse Schußwaffen zum Gefecht klargemacht. Vielleicht hatte man die Absicht, seinen Wagen in ein Sieb zu verwandeln.
Parker ließ sich auf keine Risiken ein. Er wußte, wie er solchen Gefahren entging. Seine Trickkiste war immerhin gut gefüllt. Er wartete ab, bis der Ford sich näher an seinen Wagen herangeschoben hatte.
Und dann passierte es!
Das Seitenfenster des Beifahrers wurde heruntergekurbelt. Im geöffneten Fenster erschien der Oberkörper eines Mannes, dessen Gesicht fast völlig hinter einem hochgebundenen Halstuch verschwand.
Dieser Mann hielt eine Maschinenpistole in der Hand, die er sofort fleißig benutzte.
Die erste Geschoßgarbe lag zu kurz und fuhr in den Asphalt der Straße. Die Geschosse blieben teils stecken, teils jaulten sie als Abpraller oder Querschläger unkontrolliert durch die Dunkelheit.
Daraufhin hatte Parker keine Bedenken mehr, einen gewissen Kipphebel auf seinem Spezial-Armaturenbrett umzulegen.
Worauf sich böse Dinge ereigneten.
Die wohlabgemessene Dosis Schmieröl sprühte aus einer Düse, die unter Parkers Wagenheck angebracht war, hinunter auf die Straße. Und wegen der schlechten Sichtverhältnisse konnte dieser Vorgang von den Verfolgern bestimmt nicht wahrgenommen werden.
Wie sich zeigen sollte.
Die Reifen des Ford fanden plötzlich keinen Halt mehr, sie drehten durch und spielten verrückt. Wie der Wagen, zu dem die vier Pneus gehörten.
Der Ford drehte sich prompt und kam aus der gedachten Fahrtrichtung. Er wirbelte herum, als würde er von einer Riesenfaust wie ein Kreisel bewegt und sauste anschließend zielsicher auf die nahe Böschung der Straße.
Parker hielt an und stieg aus. Er kannte den Schmiereffekt der Öldüse. Er rechnete fest damit, daß die Verfolgung bereits beendet war.
Er täuschte sich keineswegs.
Der Fahrer des Ford war sicher nicht schlecht. Er kurbelte den Wagen herum und versuchte ihn auf der Straße zu halten, doch gegen den Schmierfilm hatte er einfach keine Chance.
Parker beugte sich ein wenig vor, als der Ford plötzlich von der Straße verschwand. Fast gleichzeitig dazu war das Knirschen und Reißen von Blech zu hören, das Splittern von Glas.
Sehr viel konnte eigentlich nicht passiert sein, denn das Tempo der beiden Wagen war nicht sonderlich hoch gewesen.
Parker legte sich seinen Universal-Regenschirm korrekt über den linken Unterarm und schritt würdevoll hinüber zu der Stelle, wo er den Ford vermutete.
Dazu nahm er allerdings einen kleinen Umweg in Kauf. Er hielt es für richtig, die Straße zu verlassen. Er wußte aus Erfahrung, daß Vollprofis harte und zähe Burschen waren, die sich selbst von einem leichten Auto-Unfall nicht gerade aus der Fassung bringen ließen.
*
Archie Linwood war ein kleines, mageres Männchen mit feierlichen Bewegungen. Archie Linwood trug einen dunklen Anzug und eine schwarze Krawatte. Er schien stets im Dienst zu sein.
Er kam hinter einem pyramidenförmig geschnittenen Lorbeerbaum hervor und verbeugte sich tief. Wahrscheinlich rechnete er mit Kundschaft.
»Mein Beileid«, sagte er tatsächlich, »mein tief empfundenes Beileid für das harte Geschick, das Sie getroffen hat. Überlassen Sie alles mir und meinem Institut! Wir sollten uns nur vielleicht über die Wünsche und Kosten unterhalten.«
»Sie sind Mister Linwood?« erkundigte sich Rander und verbiß sich ein Lächeln. Er war etwas irritiert, weil Sue Weston hinter ihm gluckste. Ein sicheres Zeichen dafür, daß sie ihren Lachkrampf kaum noch tarnen konnte.
»Archibald Linwood«, stellte der Inhaber des Begräbnisinstituts sich vor, »das erste und einzige Haus am Platz. Darf man erfahren, wen Sie zu beklagen haben?«
»Übernehmen Sie auch Fälle aus dem Sanatorium?« fragte Rander, ohne Linwoods Frage zu beantworten.
»Ich bin sozusagen darauf spezialisiert«, behauptete das Männlein in Schwarz, »ich nehme an, daß Doc Waterson Sie geschickt hat?«
»Nicht direkt.«
»Das dachte ich mir, sonst hätte er mich sicher schon informiert. Rasch tritt der Tod den Menschen an. Sie haben einen Angehörigen zu beklagen?«
»Die Sterberate im Sanatorium scheint ungewöhnlich hoch zu sein«, schaltete sich jetzt Sue schnell ein. Auch sie ging einer direkten Antwort aus dem Weg.
»Aber nein! Auf keinen Fall!« Linwood hob protestierend die kurzen Arme, »aber in einem Sanatorium sterben halt Menschen, gerade in einem Sanatorium wie das Doc Watersons.«
»Wieso?« fragte Rander knapp.
»Nun, welche Menschen, bedauernswerte Menschen natürlich, bringt man zu ihm. Menschliche Wracks, die vom Alkohol und von Rauschgiften gezeichnet sind. Menschen, die sich selbst fast schon zu Grunde gerichtet haben. Ich würde es anders herum sagen, es ist erstaunlich, wie hoch die Erfolgsrate Watersons ist. Unfaßbar, wie viele Menschen er heilt!«
»So kann man es natürlich auch sehen.«
»Ich möchte fast glauben, daß Sie gar nicht wegen eines Trauerfalls gekommen sind.«
»Sie haben es erfaßt«, sagte Rander, »hoffentlich fällt das Sanatorium nicht schon sehr bald als Ihr Kunde aus. Und hoffentlich können Sie dann eine weiße Weste vorweisen, wenn die vielen Fragen gestellt werden!«
Bevor Linwood etwas erwidern konnte, drehten Rander und Sue Weston sich um und verließen die Aufbahrungshalle, in der es übrigens penetrant nach Weihrauch und Räucherkerzen roch.
*
Es waren sogar zwei sehr zähe Burschen.
Sie hatten das Hineinrutschen in den Straßengraben und den Zusammenstoß mit zwei Fichten erstaunlich gut überstanden. Sie befanden sich sogar bei bester Gesundheit. Und sie warteten nur darauf, doch noch ans Ziel ihrer Absichten zu kommen.
Dazu hatten sie sich taktisch sehr geschickt aufgebaut. Sie hatten sich getrennt und lauerten auf Parkers Ankunft. Ihnen war natürlich klar, daß die Öllache, auf der sie mit ihrem Wagen ausgerutscht waren, von Parker stammte. Und ebenso klar war ihnen, daß dieser Parker sich früher oder später blicken lassen würde, um die Früchte seines Tricks abzuernten.
Um wen es sich handelte, konnte Parker von seinem Standort aus nicht erkennen. Er sah nur zwei kleine Lichtpunkte, die auf brennende Zigaretten schließen ließen. Die beiden Männer vor ihm in der Dunkelheit bekämpften damit ihren Schock. Und sie hielten die brennenden Zigaretten durchaus richtig in ihren Händen, allerdings hatten sie übersehen, daß Parker einen weiten Halbkreis beschrieben hatte und jetzt praktisch hinter ihnen stand. Die Zigaretten in den Händen konnten von ihm also sehr genau wahrgenommen werden.
Parker hätte jetzt durchaus eine normale Schußwaffe verwenden können. Immerhin hatte man versucht, ihm die Geschoßgarbe einer Maschinenpistole auf den Pelz zu brennen. Doch vornehm, wie der Butler nun mal war, verzichtete er auf solche Grausamkeiten. Er verließ sich auch schon aus Gründen der Geräuschentfaltung lieber auf seine Spezialwaffen.
Ihm standen zwei Geschoßarten und zwei Waffen zur Verfügung. Da war einmal das mit Preßluft betriebene Blasrohr im Stock seines Universal-Regenschirms. Und da war auch seine Zwille, die unter der Bezeichnung Gabelschleuder vielleicht bekannter war.
Parker entschied sich für die Gabelschleuder, sprich Zwille. Er brauchte einen Momentaneffekt, um es mit seinen Worten auszudrücken. Nach dem Ein- und Aufschlag des Geschosses mußte sein Opfer sofort und ohne Zögern in die Knie gehen. Verwandte er hingegen das Blasrohr mit den buntgefiederten Pfeilen, dann bestand immerhin die Möglichkeit, daß sein Opfer sich noch ein paar Schritte davonstehlen konnte. Und Parker hatte keine Lust, nach seiner Aktion noch zusätzlich nach seinen Opfern Zu suchen.
Er setzte die Gabelschleuder zusammen und öffnete seine Pillendose, die etwa so groß war wie eine Tabatiere. Er entschied sich für Vollgeschosse, also Tonmurmeln ohne Spezialfüllung. Sie waren etwa erbsengroß und hart gebrannt, diese kleinen Geschosse aus Ton. Ihre Wirksamkeit hatte sich in der Vergangenheit schon mehr als einmal erwiesen.
Parker strammte die beiden Gummistränge, nachdem er das Tongeschoß in die Lederschlaufe der Zwille gelegt hatte. Dann visierte er einen der glühenden Punkte an und rechnete sich aus, wo ungefähr der Hinterkopf seines ersten Opfers sein mußte.
Schuß!
Die Tonmurmel zischte kaum hörbar durch die Nacht und landete auf dem Schädel des ersten Mannes.
Dieser Mann blieb zuerst noch stehen. Etwa für zwei Zehntelsekunden. Dann ging er allerdings in die Knie und stürzte zu Boden.
Der zweite Mann hatte selbstverständlich etwas gemerkt. Seine Zigarette fiel zu Boden. Ein paar Funken stäubten hoch, die sehr schnell ausgedrückt wurden. Dann erkannte der Butler einen vagen Schatten, der auf das erste Opfer zuglitt.
Nun galt es, sehr schnell zu sein.
Und Parker war schnell!
Die zweite Tonmurmel zischte los und verfehlte ihr Ziel. Wo sie getroffen hatte, ließ sich im Augenblick nicht feststellen, doch das zweite Opfer vollführte aus dem Stand heraus sofort einen gekonnten Turniertanz und zog sich dann sehr schnell und entschlossen zurück.
Der Mann handelte prompt nach der allseits bekannten Devise: »Vorwärts, Freunde, es geht zurück!«
*
Darauf hatte Josuah Parker nur gewartet.
Er stand goldrichtig, denn der zweite Mann kam genau auf ihn zu. Er hielt überhaupt nichts von der Möglichkeit, seinem Partner etwa Hilfe angedeihen zu lassen. Er dachte in einem erschreckenden Maße nur an sich. Was ihm nicht gut bekam.
Als der Mann den Butler passierte, oder genauer gesagt, den Baum, hinter dem Parker sich aufgebaut hatte, da tippte Parker ihm höflich und diskret mit dem Universal-Regenschirm auf die linke Schulter.
Der Mann fuhr blitzschnell herum und ging sofort zum Gegenangriff vor. Auch darin zeigte es sich, daß die beiden Verfolger ihr Handwerk verstanden.
Doch dieses Handwerk wurde von Butler Parker noch wesentlich besser gemeistert.
Parker ließ den bleigefütterten Bambusgriff hochschnellen. Der traf genau die Kinnspitze und brachte das Nervensystem des Mannes völlig durcheinander. Es gab einen totalen Kurzschluß in den diversen Partien. Der Mann verdrehte die Augen, stieß einen unterdrückten Kickser aus und sackte dann zu Boden. Dabei verlor er übrigens seine Maschinenpistole, die er bisher nicht aus der Hand gelegt hatte.
Nach dem Intermezzo verwandelte sich Parker in eine Art Lastenträger. Er schleppte die beiden Männer – nacheinander, versteht sich – tiefer in den Bergwald hinein und kümmerte sich intensiv um sie. Sie sollten sich, wenn sie wieder zu sich kamen, über nichts zu beklagen haben.
*
Es ging auf 22.00 Uhr zu, als Parker vor der Mauer des Sanatoriums erschien.
Er hatte seinen hochbeinigen Wagen weit zurückgelassen. Es ging ihm darum, unangemeldet auf das besagte Grundstück zu kommen. Er wollte Kontakt mit einem gewissen Clive Muscat aufnehmen.
Routiniert und geschmeidig nahm Parker die Mauer. Die Glasscherben auf der Krone genierten ihn überhaupt nicht. Er hatte entsprechende Vorsorge getroffen und trug dicke Lederhandschuhe. Diese Handschuhe wollte er auch für den Fall einsetzen, daß sich auf dem Gelände bissige Vierbeiner herumtrieben, die auf den Mann dressiert waren.
Diese erwarteten Vierbeiner ließen sich aber erfreulicherweise überhaupt nicht sehen.
Parker lustwandelte gemessen durch den weiten Park zu den Bungalows, in denen die Kranken untergebracht waren. Nur hinter wenigen Fenstern brannte noch Licht. Und diese Lichter befanden sich wahrscheinlich in Räumen, in denen sich das Pflege- und Aufsichtspersonal aufhielt.
Als er den ersten Bungalow erreicht hatte, suchte der Butler sich ein passendes Fleckchen und kleidete sich um. Er hoffte, auch wirklich an alles gedacht zu haben.
*
Die beiden Männer aus dem grauen Ford waren inzwischen wieder zu sich gekommen.
Sie fühlten sich nicht besonders, was nicht nur mit ihren Kopf- und Kieferschmerzen Zusammenhängen konnte. Es lag wohl mehr daran, daß Parker sie sehr geschickt um einen Baum geschlossen hatte.
Dazu hatte er nach alter Väter Sitte und nach seinem Patentrezept zwei Handschellen geopfert. Diese beiden Handschellen verbanden die vier Handgelenke der Männer unlösbar miteinander. Um freizukommen, mußten sie schon mit ihren Zähnen den mannsdicken Fichtenstamm durchknabbern. Und damit war wohl kaum zu rechnen.
Die beiden Männer waren selbstverständlich die Pfleger und Vollprofis, die Parkers Weg schon mal gekreuzt hatten. Sie hatten inzwischen eingesehen, daß sie ohne fremde Hilfe nicht wieder freikamen. Sie fühlten sich sehr einsam und verlassen. Sie standen irgendwo im tiefen und dichten Baumwald und hörten um sich herum nur die typischen und unheimlichen Geräusche der Nacht.
Da war erst mal das Waldkäuzchen, das auf sie aufmerksam geworden war. Dieses Käuzchen fühlte sich durch die beiden Vollprofis verunsichert. Es saß im Geäst einer Tanne und ging mit sich zu Rat, ob es einen versuchsweisen Tiefflug und darauffolgenden Angriff versuchen sollte. Noch hatte es sich nicht entschlossen.
Ein Fuchs bellte in der Nähe. Er hatte das Käuzchen bisher noch nicht entdeckt und fühlte sich als Herr der nächtlichen Situation. Dieser Fuchs, übrigens ein ausgekochter Bursche seiner Gattung mit bereits sehr großer Erfahrung, dieser Fuchs also hatte schon herausgefunden, daß die beiden Gestalten mit dem widerlichen, menschlichen Geruch ihm nichts anzuhaben vermochten. Er hoffte, sie bald anknabbern zu können.
Weit oben im Bergwald fiepte ein Reh und dicht neben den beiden Vollprofis raschelten zwei Haselmäuse durch das trockene Gras.
Die beiden Männer, die sich ungemein wehrlos vorkamen, die noch dazu aus der Stadt stammten, litten Höllenqualen. Und der Mann mit der Stirnglatze schrie leise auf, als das Käuzchen dicht vor seinem Gesicht vorbeistrich und sich dann auf die beiden Haselmäuse stürzte. Das Käuzchen hatte sie erspäht und seine Pläne kurzfristig umgeändert.
»Was ist denn?« knurrte der Profi mit der Hakennase. Er gab sich ruppig, um seine Angst zu überspielen.
»Da – da war gerade so ein komischer Vogel«, erwiderte Lern, der Mann mit der Stirnglatze. »Irgend so ein Biest.«
»Na und?« Lefty, der Mann mit der Hakennase, tat überlegen.
»Wenn das nun ’ne Eule war!« fragte Lern zögernd, »diese Biester kratzen einem doch glatt die Augen aus!«
»Genau das wäre richtig für dich, du Flasche!« Lefty war böse.
»Und wieso?«
»Wieso hast du dich überrumpeln lassen von diesem komischen Butler?«
»Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, wie?« Lern wurde nun seinerseits böse, »konntest du denn nicht aufpassen? Wem verdanken wir denn den Mister hier?«
Die beiden Partner Lern und Lefty machten sich daran, das Schuldproblem ausgiebig zu diskutieren. Irgendwie mußten und wollten sie sich ja die Zeit vertreiben. Die Diskussion über diesen strittigen Punkt erbrachte natürlich kein Ergebnis. Nach etwa 34 Minuten schwiegen sie erschöpft.
»Fest steht auf jeden Fall, daß wir das dem Boß zu verdanken haben«, sagte Lefty schließlich, um das drückende und unheimliche Schweigen zu überbrücken, »dieser Idiot hätte doch wissen müssen, wer dieser komische Butler ist.«
»Stimmt«, räumte Lern ein, »er hätte uns wenigstens warnen können.«
»Wenn ich den Burschen in die Finger bekomme, mache ich Hackfleisch aus ihm!«
»Aus’m Boß?« Lern grinste.
»Aus diesem Parker, du Pflaume«, korrigierte Lefty schnell, »und was den Boß betrifft, so sollten wir uns ’nen neuen Vertragspartner suchen.«
»Keine schlechte Idee«, pflichtete Lern ihm bei, »falls wir hier noch mal loskommen. Ob wir’s mal mit Rufen versuchen?«
Sie gerieten wieder aneinander und stritten sich, um dann wieder über ihre persönlichen Probleme zu sprechen. Sie hatten ja sehr viel Zeit. Und das Tondrahtgerät über ihnen in den Zweigen war wirklich lang genug, um alle Details aufzuzeichnen.
Parker hatte es zurückgelassen. Er verzichtete gern auf eingehende Verhöre, falls seine Gesprächspartner von sich aus und ungeniert redeten.
*
Josuah Parker befand sich um diese Zeit im Vorraum zu einem der langgestreckten Bungalows. Höchst erfreut nahm er zur Kenntnis, daß sich an der Wand vor der Verbindungstür zum eigentlichen Korridor eine Namensliste befand, die die Belegung der Zimmer nachwies. Für jedes Krankenzimmer waren auch die Namen der Personen aufgezeichnet, die darin wohnten. Eine bessere Orientierung hätte Parker sich überhaupt nicht vorstellen können.
Er fand, wonach er suchte.
Laut Namensliste wohnte Clive Muscat in Zimmer 134. Muscat war der Freund des verstorbenen Michael Moberly, hatte sich Parker unter anderem auch als Robin Hood vorgestellt und dann später mit einem Tuch aus seinem Bungalowfenster gewinkt.
Diesem jungen Mann wollte Parker unbedingt einen Besuch abstatten. Er hoffte auf Informationen und Details. Und insgeheim, daß er gerade jetzt nicht überrascht wurde.
Die Dinge ließen sich gut an.
Parker war als Butler nicht mehr zu erkennen. Er hatte es aus Gründen der Tarnung vorgezogen, sich einen weißen Ärztekittel überzustreifen. Regenschirm und schwarze Melone hatte er notgedrungen vor dem Bungalow zurücklassen müssen. Ein Arzt mit Regenschirm und Melone hätte ja zumindest einiges Aufsehen erregt.
Parker drückte die Tür zum Korridor auf und schritt auf den Raum zu, der laut Zimmerliste für die Nachtwache reserviert war. Unter der Tür schimmerte Licht nach draußen in den kaum erhellten Gang.
Parker legte diskret sein Ohr gegen die Türfüllung. Er hörte leise Tanzmusik, die aus einem Radio kam, hin und wieder ein paar Wortfetzen, dann Schritte, die sich aber nicht der Tür näherten.
Um sich noch besser zu informieren, verschmähte der Butler es nicht, auch einen kurzen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen. Er entdeckte zwei Pfleger in weißen Kitteln, die einen völlig gelangweilten Eindruck machten. Sie ahnten überhaupt nicht, daß sie belauert wurden.
Parker, der an Komplikationen nicht interessiert war, holte aus seiner Hosentasche einen kleinen Stahlzylinder, der nicht größer war als eine Kohlensäurepatrone, wie man sie für Heimsiphons verwendet. Er führte einen kleinen Schlauch in das Schlüsselloch ein und achtete darauf, daß dieser Schlauch nicht von innen gesehen werden konnte. Dann drehte er das kleine Ventilrad auf und ließ das Schlafgas in den Aufenthaltsraum strömen.
Es war unsichtbar, geruchlos und hochwirksam.
Als Parker nach etwa einer Minute ungeniert die Tür öffnete, schliefen die beiden Pfleger bereits tief und fest. Einer von ihnen kniete vor einem schmalen Bett. Sein Oberkörper ruhte entspannt auf der weißen Matratze. Der zweite Pfleger hing lässig in einem Sessel und schnarchte erstaunlich.
Parker untersuchte die beiden Männer, die er bisher noch nie gesehen hatte, sicherheitshalber nach Waffen. Er fand nur zwei Stahlruten, die in Metallhülsen steckten und beim Zuschlägen teleskopartig hervorschnellten.
Ein immerhin etwas ungewöhnliches Mittel, um unruhige Patienten zu besänftigen! Schon allein diese beiden Stahlruten sagten sehr viel über den Geist aus, der in diesem Sanatorium herrschen mußte.
Parker öffnete das Fenster und trug die beiden Pfleger hinüber an die Fensterbank. Dann kippte er sie ziemlich ungeniert nach draußen und schloß das Fenster. Bei einem Kontrollgang brauchte man seiner Meinung nach nicht unbedingt und sofort über die beiden schlafenden Pfleger zu stolpern.
*
Die Tür zu Clive Muscats Zimmer hatte selbstverständlich keine Klinke, und sie besaß zwei Schlösser, die recht kompliziert aussahen.
Parker ließ sich jedoch nicht entmutigen.
Er hatte schließlich sein Spezialbesteck mitgenommen und wußte damit umzugehen. Er brauchte etwa vier Minuten, bis die beiden Schlösser sich ergaben. Ein deutliches Zeichen dafür, wie gut die Schlösser waren. Normalerweise hätte der Butler nur die Hälfte der Zeit benötigt.
Mit einem Zusatzgerät, das die fehlende Klinke ersetzte, öffnete Parker dann die Tür und drückte sie vorsichtig auf.
Clive Muscat mußte Parkers Manipulationen an der Tür gehört haben.
Er stand in einer Ecke des recht sparsam eingerichteten Zimmers und machte einen ängstlichen Eindruck. Als er jedoch Parker erkannte, ging ein gewisses Strahlen über sein Gesicht.
»Ich hatte gehofft, daß Sie es sein würden«, sagte er und kam dann schnell auf den Butler zu.
»Dann dürfte ich das Zeichen mit dem Handtuch richtig gedeutet haben«, sagte Parker und nickte zufrieden. »Ich hoffe, Mr. Muscat, Sie haben mir einige Informationen anzubieten.«
»Und ob!« sagte Muscat und hatte plötzlich einen kurzläufigen Revolver in der Hand, dessen Mündung er auf den Butler richtete.
»Nehmen Sie bloß schnell die kleinen Patschhändchen hoch, Parker, oder ich werde nervös und kümmere mich nicht mehr weiter um meinen Zeigefinger!«
*
»Ob ihm etwas passiert ist?« fragte Sue Weston unruhig. Sie hielt sich in Mike Randers Hotelzimmer auf und wanderte unruhig vor dem Fenster auf und ab.
»Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen dürfen«, sagte Rander ärgerlich, »aber er hat mich wieder mal eingewickelt!«
»Mr. Parker müßte sich doch jetzt bereits im Sanatorium befinden«, redete Sue weiter.
»Wenn etwas passiert, wird er sich mit seinem Piepser melden«, meinte Rander und deutete auf ein Transistorradio, das auf einem kleinen Wandtisch stand. Dieses Gerät war durchaus in der Lage, normale Radiomusik zu liefern.
Durch Umschaltung aber ging es auf eine ganz bestimmte Frequenz. Dann wartete der Lautsprecher des Empfängers nur darauf, auf den Sender Parkers ansprechen zu dürfen.
Sprechfunk war nicht möglich, aber das Alarmpiepsen, von Parker ausgelöst, reichte voll und ganz, um Hilfsaktionen auszulösen. Geräte dieser Art kannte Sue von den großen Krankenhäusern her, in denen Ärzte ihr Empfangsgerät in der Kitteltasche trugen. Damit konnten sie von der Hauszentrale überall erreicht werden.
»Und wenn Mr. Parker keine Zeit mehr gefunden hat, Alarm zu schlagen?« gab Sue zu bedenken.
»Malert Sie nur nicht den Teufel an die Wand, Sue!« Rander drückte seine Zigarette plötzlich energisch im Aschenbecher aus, »aber Sie haben recht, Sue. Wir sollten uns auf die Beine machen und uns näher an das Sanatorium heranschieben. Für den Fall des Falles können wir dann sofort eingreifen!«
Rander und Sue Weston hatten es jetzt sehr eilig, das Hotelzimmer zu verlassen. Irgendeine Aktion war für sie immer noch erträglicher gewesen als das geduldige Warten.
Weder Rander noch Sue ahnten zu dieser Zeit, daß die Falle für sie bereits weit geöffnet war. Sie brauchten nur noch hineinzumarschieren.
*
Parker war nicht sonderlich zufrieden. Das hing wahrscheinlich mit der Zwangsjacke zusammen, in die man ihn gesteckt hatte. Seine Arme waren derart verschnürt, daß er sie kaum einen Zentimeter bewegen konnte. Er saß in einer Art Behandlungsstuhl, dessen Lederriemen ihn zusätzlich stramm festhielten.
»Ausgezeichnet, Muscat«, lobte Dr. Waterson den jungen Mann, der Parker geschickt hereingelegt hatte, »aber Sie können jetzt wieder gehen.«
Muscat grinste den Butler triumphierend an. Dann wandte er sich um und verließ den saalartigen Raum, an den sich ein großer Keller mit eingebautem Swimming-pool anschloß.
Beherrschender Mittelpunkt war die Guillotine, die der Butler schon mal gesehen und gar nicht bewundert hatte.
»Ich muß gestehen und einräumen, Doc Waterson, daß ich Sie total unterschätzt habe«, erklärte Parker, als er mit dem Boß des Sanatoriums allein war.
»Das, ist auch schon ganz anderen Personen passiert«, erwiderte Waterson lächelnd, »jeder erlebt halt sein persönliches Cannae, nicht wahr?«
»Sehr treffend ausgedrückt«, gab Parker höflich zurück, »ich muß wohl unterstellen, daß Muscat eine Marionette in Ihren Händen war und ist.«
»Natürlich, Parker. Sehr brauchbar, der Junge, wenn man ihn nur richtig behandelt. Man braucht ihn nur auf schmale Kost zu setzen, und schon wird er zu einem loyalen Mitarbeiter.«
»Mit der schmalen Kost meinen Sie wahrscheinlich irgendwelche Narkotika oder Rauschgifte?«
»Sie haben es erfaßt«, sagte Waterson und lächelte freundlich, »man muß seine Patienten eben genau kennen.«
»Wobei wir bereits beim Thema sein dürften, Doc …« Parker schien vergessen zu haben, in welch einer Lage er sich befand. Er plauderte in einer Art und Weise, als sei er in seinen Aktionen überhaupt nicht behindert.
»Sie wollen wissen, was hier im Sanatorium eigentlich gespielt wird, nicht wahr?«
»Wären Sie so freundlich, mir das aufzusetzen, was man im Volksmund ein Licht nennt?«
»Ob es sich für Sie überhaupt noch lohnt, ist eine andere Frage«, entgegnete der Chef des Sanatoriums, »aber gut, ich werde Sie informieren, Parker. Ich befasse mich mit gewissen Familienproblemen.«
»Sie werden verstehen, daß ich mir darunter kaum etwas vorstellen kann.«
»Strengen Sie sich doch mal ein wenig an, Parker! Enttäuschen Sie mich nicht. Ich halte Sie für einen durchaus intelligenten Menschen.«
»Nun denn«, sagte Parker, »darf ich annehmen, daß Sie gewisse Erbfolgen korrigieren?«
»Sehr gut!« lobte Doktor Waterson.
»Mit anderen Worten, Sie kurieren Familienmitglieder zu Tode, die man von natürlichen Erbfolgen ausschalten will?«
»Den Nagel auf den Kopf getroffen, Parker! Zuerst war das nicht so, aber im Lauf der Zeit ergab sich das.«
»Ich begreife verständlicherweise nicht, woher Sie ihre Kunden bekommen.«
»Diskrete Mundpropaganda … Andeutungen … Vage Vermutungen … Sie ahnen ja nicht, wie sehr man mich bestürmt, Patienten zu übernehmen.«
»Wobei Sie in der Auswahl natürlich sehr vorsichtig sind.«
»Darauf können Sie sich verlassen, Parker. Hier im Sanatorium haben wir selbstverständlich in der Masse nur normale Patienten, die sich aus besten Kreisen zusammensetzen.«
»Wie im Falle Muscat?«
»Richtig, Parker. Muscat ist dafür ein typischer Fall. Die Angehörigen reicher Klienten, die sich meine Pflegesätze gerade leisten können, möchten ihre Lieben in einem Privatsanatorium sehen und nicht in einem Gefängnis oder einer staatlichen Heilanstalt. Muscat würde zum Beispiel seit Monaten in einem Gefängnis sitzen, wenn wir ihm nicht geistige Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt hätten. Sie haben es ja von ihm selbst gehört. Hier fühlt er sich wohler. Freiwillig würde er niemals gehen!«
»Ich darf Ihren Worten entnehmen, Mister Waterson, daß Sie eine vorschnelle Beendigung Ihrer einträglichen Geschäfte kaum befürchten?«
»Natürlich nicht. Die Abgänge …«
»… Womit Sie die Toten meinen …«
»Richtig, die Abgänge gehen im medizinischen Sinn völlig in Ordnung. Sie wissen ja selbst, daß wir keine Autopsien zu befürchten brauchen.«
»Michael Moberly!« Parker begnügte sich mit diesem kurzen Stichwort.
»Okay, Parker. Michael Moberly … Akutes Kreislaufversagen … Kollaps!«
»Warum mußte dieser junge Mann eigentlich sterben?«
»Sie fragen doch jetzt wohl nach der inoffiziellen Lesart, nicht wahr?« Doc Waterson gab sich nach wie vor ungemein verbindlich. Und sehr offen dazu. Er schien wohl nicht daran zu glauben, daß Parker ihm noch mal gefährlich werden könnte.
»Ich meine in der Tat die inoffizielle Lesart … Er muß sich also, wenn ich es so ausdrücken darf, Ihren Unwillen zugezogen haben, nicht wahr?«
»Mike Moberly wollte Schwierigkeiten machen. Der Junge schnappte Gespräche auf, die für seine Ohren in keiner Weise bestimmt waren. Und er versuchte, sein Wissen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich verweise auch auf die Briefe, die er wohl an seine Eltern schrieb.«
»Darum mußte er an akutem Kreislaufversagen sterben?«
»Ich hielt es für alle Teile so für besser!«
»Dann bleibt für meine bescheidene Wenigkeit noch die Frage, wieso Sie die Eltern des Jungen dazu brachten, auf weitere Untersuchungen zu verzichten.«
»Was versprechen Sie sich eigentlich von Ihrer Neugier?« erkundigte sich Waterson plötzlich. Waren ihm im letzten Augenblick doch noch Bedenken gekommen?
»Meine Gegner haben mich stets interessiert«, gab der Butler zurück. Dann spielte er sehr hoch, als er fortfuhr: »Wenn Sie allerdings Befürchtungen hegen, ich könnte mein Wissen irgendwann gegen Sie verwenden, dann sollten Sie wohl besser nicht weiterreden!«
»Dazu werden Sie keine Gelegenheit mehr haben«, sagte Waterson und lächelte amüsiert, »ich habe eine kleine Überraschung für Sie bereit, Parker?«
»Darf man neugierig sein?«
»Aber natürlich!« Waterson schmunzelte, »ich hoffe, Sie werden doch an unserem Hausball teilnehmen. Gerade auf Sie wartet eine Pantomime, die Sie nie vergessen werden. Wir werden diesen Hausball unter das Motto Französische Revolution stellen. Falls Sie ausreichend Phantasie besitzen, Parker, werden Sie sich schon jetzt gewisse Details leicht vorstellen können!«
*
»Das sieht ja nach einer tollen Festivität aus«, meinte Mike Rander, als er auf dem Baumast saß und hinüber zu den Gebäuden des Sanatoriums sehen konnte.
»Was, bitte?« Sue Weston, die unten stand, hatte den jungen Anwalt nicht ganz verstanden.
»Waterson scheint so etwas wie eine Riesenparty zu geben«, rief Rander leise, »alles in Licht getaucht …«
Er kletterte zurück auf den Boden und klopfte sich die Kleidung ab.
»Hat das irgend etwas zu bedeuten?« fragte Sue. Sie hörte jetzt die Musik, die leise vom Sanatorium bis herüber zu ihrem Standort drang.
»Keine Ahnung«, gab Rander achselzuckend zurück, »aber wenn ich an Parker denke, habe ich kein gutes Gefühl.«
»Wieso?«
»Watersons Patienten geben sich manchmal ziemlich hemmungslos«, sagte Rander, »ich erinnere Sie an die Vorfälle, die Parker und ich Ihnen erzählt haben!«
»Wenn Sie mich fragen, Mister Rander, so sollten wir ins Sanatorium gehen.«
»Offiziell, etwa?«
»Vielleicht, aber wir könnten ja auch über die Mauer steigen und uns unter die Masken mischen. Irgendein Kostüm werden wir uns schon beschaffen. Hat Waterson nicht gesagt, daß er einen eigenen Kostümfundus hat?«
»Keine schlechte Idee!« Rander nagte nachdenklich an seiner Unterlippe. »Ich glaube, Sue, wir sollten es riskieren.«
Sue Weston war Feuer und Flamme. Sie brannte förmlich darauf, an dem Maskenfest teilzunehmen. Sie versprach sich davon neue Eindrücke. Worin sie sich nicht getäuscht haben sollte, wie sich bald zeigte.
»Aber dann uneingeladen«, schlug Rander vor, »Waterson braucht nicht zu wissen, wie nahe wir ihm auf den Pelz rücken.«
Es war eine Kleinigkeit für Sue Weston und Mike Rander, die Mauer zu nehmen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sie auf der anderen Seite waren. Sie vergewisserten sich, daß sie nicht bemerkt worden waren. Dann gingen sie vorsichtig auf die Gebäude des Sanatoriums zu.
*
Waterson sah zufrieden auf das Treiben seiner Patienten, die sich prächtig fühlten.
Sie alle waren wieder in Kostüm und Maske und füllten diese Rollen bestens aus.
Kleopatra schritt aufreizend durch die Menge und suchte nach Cäsar.
Hannibal schwang sein Kurzschwert und schien einigen Ärger mit Napoleon zu haben, der sich seinerseits mit Ludwig XV. angelegt hatte.
In einer Ecke des kleinen Saales stand Robespierre auf einem Stuhl und hielt eine flammende Revolutionsrede an sein andächtig lauschendes Volk. Und ein gewisser Robin Hood stellte einer attraktiven Neandertalerin nach.
Waterson, der sich in Gagliostro, den großen Magier und Scharlatan verwandelt hatte, schritt freundlich grüßend durch die Menge seiner kostümierten Patienten und näherte sich einem Gardesoldat ohne Gewehr, der schnell auf ihn zukam.
*
»Sie kommen«, meldete der Gardesoldat im Kostüm der russischen Kaiserin.
»Nicht aus den Augen lassen«, befahl Waterson, »ich möchte wissen, was sie wollen. Stellen Sie fest, ob sie allein sind, oder ob sie Kontakt zu außenstehenden Personen halten!«
Cagliostro schlenderte weiter. Sem Ziel war jetzt Robespierre, der seine flammende Ansprache beendet hatte.
»Bürger Robespierre«, sagte Waterson feierlich, »die Revolution ist stolz auf euch, aber sie verlangt nach Opfern!«
»Verräter sind überall«, gab Robespierre von sich. Seine Augen glühten fanatisch.
»Und Verräter müssen sterben«, stellte Waterson fest.
»Unter der Guillotine«, fügte Robespierre hinzu.
»Ich kenne einen Verräter, Bürger Robespierre«, stichelte Waterson, »ein Mann, der gegen die Republik konspiriert.«
»Wo?«
»Ich werde ihn Euch präsentieren. Kommt!«
*
Parker war kein Houdini.
Ihm standen leider nicht die Tricks zur Verfügung, die der berühmte Entfesselungskünstler angewandt hatte. Und mit einer Zwangsjacke wußte Parker schon gar nichts anzufangen. Ob es ihm paßte oder nicht, er saß eisern fest. Er hatte keine Chance, sich selbst zu befreien.
Zudem fehlte ihm auch die Zeit dazu, denn Waterson kam zurück in den großen Vorraum zum Keller-Swimming-pool. In Watersons Begleitung befand sich ein Mann, den der Butler sofort als Robespierre identifizierte.
Robespierre – selbstverständlich ein Gemütskranker – baute sich vor Parker auf.
»Dieser Mann verrät das Volk«, behauptete Cagliostro, alias Dr. Waterson, »dieser Mann muß sterben!«
»Gerechtigkeit für einen Angeklagten«, sagte Parker schnell und sah Robespierre fest in die glühenden, fanatischen Augen, »seit wann urteilt Robespierre ohne die Gegenargumente gehört zu haben?«
»Redet!« sagte Robespierre und beugte sich etwas vor.
»Cagliostro ist ein Scharlatan.« Parker deutete mit dem Kopf andeutungsweise auf Waterson, »gerade Ihr, Bürger Robespierre, kennt die Geschichte. Ihr müßt doch wissen, wie sehr er mit der herrschenden Klasse paktierte und sich auf Kosten des Volkes bereicherte!«
Gewiß, das, was Parker da von sich gab, hielt den Tatsachen nicht stand, aber Parker fühlte instinktiv, daß er mit dem Kranken reden mußte. Er mußte ihn als Robespierre respektieren, sonst hatte er bereits verloren.
»Was habt Ihr dazu zu sagen?« wollte Robespierre von Cagliostro wissen.
»Dieser Feind des Volkes lügt«, sagte Waterson, »was zu verstehen ist, er sollte von der Guillotine zur Wahrheit gezwungen werden. Das Volk braucht ein Exempel. Verräter müssen sterben!«
»Ich werde mit dem Konvent reden«, sagte Robespierre ausweichend, um dann schnell den Raum zu verlassen. Die Aussicht, mit der Guillotine spielen zu können, erschien ihm verlockend. Er wollte keine Gegenargumente hören, die ihm diesen Spaß vielleicht genommen hätten.
»Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, daß das Messer der Guillotine echt ist«, erklärte Waterson und lächelte den Butler kühl an.
»Natürlich nicht«, entgegnete der Butler, »ich frage mich nur, wie Sie diesen Mord der Polizei gegenüber erklären wollen.«
»Aber ich bitte Sie, Parker!« Waterson schüttelte leicht und verweisend den Kopf, »kann man denn arme und geistesgestörte Kranke für ihre Taten verantwortlich machen?«
»Falls meine Leiche je gefunden werden sollte …«
»Das kommt natürlich noch hinzu. Vielleicht werde ich sie auch verschwinden lassen. Sehen Sie, Parker, man muß improvisieren können. Sie haben natürlich eine echte und letzte Chance!«
»Ich ahnte, daß Sie mich mit solch einer Chance noch konfrontieren würden, Mister Waterson.«
»Dann werden Sie auch wissen, was ich von Ihnen erwarte.«
»In der Tat, Doktor. Sie möchten in Erfahrung bringen, wo Ihre diversen vier Mitarbeiter sich zur Zeit befinden, nicht wahr?«
»Allerdings. Was haben Sie mit Hank, Steve, Lern und Lefty gemacht?«
»Sie befinden sich an einem sicheren Ort, wie Sie verstehen werden, Mister Waterson. Sie werden zur richtigen Zeit aussagen, und zwar der Polizei gegenüber.«
»Sie wollen den jetzigen Aufenthaltsort also nicht preisgeben, Mister Parker?«
»Ich muß gestehen, daß ich nicht an die Echtheit Ihrer Versicherung hinsichtlich meines eventuellen Weiterlebens glaube.«
»Das ist ein Risiko, das Sie allem tragen müssen. Sie werden sich auf meine Worte verlassen müssen.«
»Eben das fällt mir außerordentlich schwer, Waterson.«
»Nun, Sie müssen nicht«, sagte Waterson lächelnd, »diese Information werde ich mit Sicherheit auch von Mister Rander oder Miß Weston bekommen.«
Statt zu antworten, sah Parker den Chef der Heilanstalt fragend an.
»Ihr Chef und Miß Weston befinden sich bereits hier im Sanatorium«, sagte Waterson genußvoll, »ich habe sie die ganze Zeit über beobachten lassen. Ich habe nichts dagegen, daß sie sich an meinem Maskenfest beteiligen. Wer freiwillig zu mir kommt, den brauche ich nicht mit Gewalt holen zu lassen!«
»Ein ausgesprochen tiefsinniger Ausspruch«, sagte Josuah Parker höflich, »ich muß gestehen, daß ich Sie wahrscheinlich sehr unterschätzt habe.«
»Ihr Pech, daß Sie das jetzt nicht mehr korrigieren können«, meinte Waterson. Er wandte sich ab und verließ den Raum. Er ließ einen Butler zurück, der sich hoffnungslos verloren vorkam.
*
»Nun, Sue, was schlagen Sie vor?« fragte Mike Rander etwa um die gleiche Zeit.
Er und seine Sekretärin befanden sich im Kostümfundus des Sanatoriums und waren dabei, sich für das Maskentreiben einzukleiden. Rander schritt die lange Reihe der Kostüme ab, die auf Garderobenständern hingen.
»Wie wäre es denn mit Philipp II?«
»Zu steif! Ich möchte mich bewegen können«, erwiderte Rander.
»Und das hier. Heinrich VIII?«
»Dann schon lieber als …« Rander kam nicht mehr dazu, seinen Wunsch zu äußern. Er hatte plötzlich hinter sich leise und schnelle Schritte gehört.
Blitzschnell wandte er sich um und sah sich zwei stämmigen Henkersknechten gegenüber, deren Gesichter unter spitzen Kapuzen mit Sehschlitzen verborgen waren.
Sie machten einen sehr entschlossenen Eindruck, als sie sich gleichzeitig auf ihn warfen. Sie besorgten das mit sehr viel Routine und Kraft.
Rander wehrte sich verzweifelt. Mit seinem rechten Fuß prüfte er die Bauchmuskulatur des einen Henkers, und mit seiner linken Faust tastete er nach der Kinnlade des anderen Gegners.
Die beiden Kerle zeigten sich kurzfristig beeindruckt und verschwanden zwischen den Garderobenständern. Rander rief laut und warnend nach Sue Weston, um dann nach ihr zu suchen.
Leider kam er nicht sehr weit.
Seine Füße verfingen sich in dem Reifrock einer Hofdame. Er stürzte und landete auf dem Boden. Und als er sich schnell wieder erheben wollte, da waren die beiden Henkersknechte schon wieder zur Stelle und wurden handgreiflich.
Jetzt tasteten sie mit ihren Fäusten nach seinem Sonnengeflecht und Genick. Das Ende vom Lied war, daß Rander groggy zu Boden ging und für eine gewisse Zeit nicht mehr mitspielen konnte.
Die beiden Männer ließen ihn erst mal liegen. Sie hatten den zusätzlichen Auftrag erhalten, auch eine junge, sehr attraktive Frau zu stellen. Dieser Aufgabe wollten sie sich mit besonderem Interesse widmen.
Sie suchten verzweifelt nach der jungen Dame, doch sie blieb verschwunden. Sie mußte sich während des Kampfgetümmels sehr leise und geschickt abgesetzt haben, denn Sue war einfach nicht mehr vorhanden.
Die beiden Henkersknechte stellten also ihre Suche ein und kümmerten sich wieder um Mike Rander.
Auftragsgemäß nahmen sie ihm die Kostümwünsche ab. Es dauerte höchstens zehn Minuten, bis sie Rander in das von Waterson geforderte Kostüm gesteckt hatten.
Als Rander erwachte, fühlte er sich in der Hofkleidung eines französischen Aristokraten, der darauf wartete, von den Sansculotten einen Kopf kürzer gemacht zu werden.
*
»So allein?«
Parker hörte eine Stimme hinter sich, die weich wie Samt klang.
Mühsam nahm er den Kopf etwas herum. Er war überrascht, als er Kleopatra erkannte, die sich vorsichtig an ihn heranschob. Sie lächelte verführerisch.
Kleopatra sah ungemein reizvoll aus, und sie konnte vielleicht die Rettung bringen.
»Ich begrüße Euch, Königin«, sagte Parker, »wären meine Hände frei, könnte ich Euch anders huldigen!«
»Seid Ihr Cäsar?« fragte sie verlangend.
»Nicht direkt«, erwiderte Parker, der auf den Ton und die Diktion Kleopatras notgedrungen und geschmeidig einging, »aber ich könnte Euch zu ihm führen.«
»Wer seid Ihr, Fremder?« verlangte Kleopatra zu wissen.
»Ein Bote aus Rom, den man mit List gefangen hat«, erklärte der Butler.
»Ein Bote aus Rom? Wollt Ihr Cäsar zurückholen vor den Senat?«
»Mitnichten, Königin«, sagte Parker schnell. Er hatte nicht geglaubt, daß diese Kleopatra sich in Geschichte auskannte, »genau das Gegenteil ist der Fall, Königin. Ich bringe gute Nachrichten.«
»Und Ihr wißt, wo ich Cäsar finden kann?«
»Mein Wort sei darauf verpfändet!«
»Dann werde ich Euch losbinden, Sklave«, sagte die Königin, wogegen Parker absolut nichts einzuwenden hatte.
»Ich bitte darum.« Parker wartete darauf, daß Kleopatra sich betätigte. Doch zu seiner Enttäuschung kam die reizvolle Königin nicht mehr dazu, denn sie wurde gestört und auch zur Ordnung gerufen.
Zwei Henkersknechte erschienen auf der Bildfläche. Und sie sprangen mit Kleopatra nicht gerade höflich um. Sie verabreichten ihr zwei derbe Ohrfeigen und scheuchten sie aus dem Raum.
»Hallo, Parker!« rief Rander seinem Butler zu. Er befand sich nämlich in Begleitung der beiden Knechte.
»Ich erlaube mir, Ihren Gruß zu erwidern«, sagte Parker höflich, als sein junger Herr seitlich neben ihm erschien. »Wie ich sehe, hat man Sie bereits in ein Kostüm gekleidet, das zur Guillotine paßt!«
»Und du bist auch gleich an der Reihe!« Einer der beiden Henkersknechte baute sich grinsend vor Parker auf. Er hatte seine Spitzmaske hochgeschoben und zeigte ein breites, grobes Gesicht.
»Und was, bitte, schwebt Ihnen vor?« erkundigte sich Parker.
»Laß dich überraschen, Alterchen!« sagte der zweite Henkersknecht, »ihr werdet auf jeden Fall stilvoll in den Korb springen. Dafür sorgt schon der Chef!«
»Doc Waterson, nicht wahr?«
»Das dürfte sich ja inzwischen rumgesprochen haben«, meinte der erste Knecht, »los, Beeilung! Robespierre wird seine Anklage bald beendet haben. Das Volk wartet auf zwei Köpfe!«
Rander tauschte mit Parker einen schnellen Blick. Dieser besagte, daß Sue Weston mitgekommen, aber vorerst entwischt war. Vielleicht war sie bereits auf dem Weg, um Hilfe zu holen. Aber vielleicht hatte man sie inzwischen auch schon erwischt.
*
»Sie muß noch im Haus sein«, sagte Waterson in Kostüm und Maske Cagliostros. Waterson machte einen wütenden Eindruck. Daß Sue Weston entwischt war, paßte ihm nicht. Sie stellte plötzlich eine Gefahr für seine Absichten und Pläne dar.
»Worauf wartet ihr noch? Sucht sie!« fuhr Waterson die beiden Sansculotten an, die abwartend vor ihm standen, »sie darf uns nicht entwischen, sonst platzt hier alles.«
Die beiden Sansculotten preschten davon und mischten sich unter das bunt kostümierte Volk. Sie hielten Ausschau nach einer etwas über mittelgroßen, schlanken und sehr attraktiven Frau, die ihrer Ansicht nach noch Zivilkleidung trug. Solch eine Frau konnte sich doch unmöglich lange verborgen halten. Sie kamen vorerst nicht auf den Gedanken, daß eine gewisse Sue Weston inzwischen in einem reizvollen Kostüm steckte.
Waterson wandte sich wieder Robespierre zu, der von seinen Zuhörern gerade lautstark gefeiert wurde, Er hatte den Kopf eines Verräters gefordert und ihn vom Volk zugebilligt bekommen. Nun wollte man diesen Kopf rollen sehen.
An der Spitze seiner aufgeputschten Massen bahnte er sich seinen Weg durch die übrigen Masken und Kostüme. Es kümmerte ihn kaum, daß ihm nicht alle folgten.
Robespierre wurde etwas irritiert, als Kleopatra sich ihm in den Weg warf und ihn zu küssen versuchte. Er schüttelte die Königin unwillig ab und drückte sie in die starken und willigen Arme Hannibals, der sich sofort für diese Frau erwärmte.
Waterson hielt sich zurück.
Eben noch voll perverser Lust an dem tödlichen Spiel, das er inszeniert hatte, kamen ihm jetzt ernste Bedenken, das Guillotinespiel wie geplant abrollen zu lassen. Diese Sue Weston war auf dem besten Weg, seine Pläne zu stören. Sie mußte so schnell wie möglich gefunden werden.
Normalerweise konnte sie den Steinbau, in dem das Maskenfest stattfand, nicht verlassen. Alle Türen waren fest geschlossen, die Fenster ohnehin vergittert. Sie mußte sich also im Haus befinden, aber wo?
Die Massen samt Robespierre verschwanden bereits auf der Kellertreppe nach unten. Waren sie überhaupt noch zu stoppen? Hatte Waterson soviel Macht, seine Kranken zur Ordnung zu bringen?
Er zweifelte ehrlich daran.
*
»Sie haben eine verblüffende Ähnlichkeit mit Ludwig XVI«, sagte Rander zu seinem Butler, den man geschickt umgekleidet hatte.
»Diese Ähnlichkeit, Sir, möchte ich allerdings nicht bis zum bitteren Ende beibehalten«, erwiderte Parker und sah den beiden Henkersknechten zu, die hinüber zur Guillotine gingen.
»Will Waterson uns wirklich umbringen?«
»Ich fürchte, Sir, daß auch er geistig nicht mehr so recht intakt ist«, gab der Butler zurück.
»Bleibt Sue …«
»Darauf, Sir, würde ich nicht so sehr bauen. Hoffentlich gelingt es Miß Weston, wenigstens das zu retten, was ich ihre Haut nennen möchte!«
»Sie wird uns nicht im Stich lassen!«
»Sir, Sie und meine Wenigkeit scheinen Besuch zu bekommen.«
»Robin Hood!« Rander sah zur Seite. Es handelte sich tatsächlich um den edlen Räuber aus den englischen Wäldern, der mit Pfeilköcher und Bogen auf der Bildfläche erschien.
Robin Hood, mit Clive Muscat identisch, sah hinüber zu den Henkersknechten, die mit dem Fallbeil beschäftigt waren. Dann glitt er schnell und geschmeidig auf Rander und Parker zu.
»Hau bloß ab!« rief einer der Knechte ihm zu.
»Man wird sich doch noch die beiden Verräter ansehen dürfen«, schmollte Robin Hood und baute sich seitlich neben Parker auf. Dann flüsterte er leise weiter, »hier, ein Messer! Mehr kann ich nicht tun …«
Während er noch redete, schob er Parker ein kleines Messer mit feststehender Klinge in die Hände. Dann tänzelte er zurück und ging auf die Guillotine zu.
Der zweite Henkersknecht drohte ihm wütend mit der geballten Faust, worauf Robin Hood auflachte und zurück zur Tür lief.
Parker, der erfreulicherweise nicht mehr in einer Zwangsjacke steckte, sah den oft zitierten Silberschimmer am sprichwörtlichen Horizont.
Warum Muscat, der ihn doch offensichtlich hereingelegt hatte, ihm ein Messer zusteckte, konnte später geklärt werden. Jetzt ging es erst mal darum, so schnell wie möglich etwas für die Gesundheit zu tun. Und dazu gehörte, die Hände und Füße freizubekommen.
Aber war es dazu nicht schon zu spät?
Von der Tür her waren plötzlich laute Stimmen, dann revolutionärer Gesang zu hören.
Das Volk nahte, um zur Sache zu kommen.
*
Die beiden Sansculotten waren nach wie vor auf der Suche nach Sue Weston.
Sie hatten sich das französische Volk genau angesehen, das jetzt nach unten in den Keller verschwunden war. Nun machten sie sich daran, die übrigen Maskenballteilnehmer zu beobachten.
Sie blieben beeindruckt stehen, als sie eine ungewöhnliche Frau erspähten.
Es handelte sich um eine Salome, die gerade mit einer Art Tarzan tanzte.
Diese Frau kam ihnen irgendwie unbekannt vor. Und das hing ganz einwandfrei mit dem Körperbau der Salome zusammen. Sie war etwas über mittelgroß, sehr schlank und besaß dennoch alle erforderlichen Rundungen, die ein Männerherz höher schlagen lassen. Sie trug im Grund nur ein paar Schleier, die von diesen Formen kaum etwas verbargen.
Die beiden Sansculotten nickten sich zu und pirschten sich an Salome heran.
Die Verkleidete war auf die beiden Sansculotten aufmerksam geworden und schien Tarzan etwas zuzuflüstern. Dann schmiegte sie sich noch enger und intensiver an den Mann aus dem Dschungel und legte ihren rechten Arm um seinen muskulösen Hals.
Die beiden Sansculotten waren sich ihrer Sache sicher. Sie kamen schnell näher und bauten sich vor dem Paar so auf, daß es das Tanzen einstellen mußte.
»Moment mal«, sagte der erste Sansculotte und tippte Tarzan auf die nackte Schulter.
Genau das aber hätte er besser nicht getan.
Tarzan, vielleicht etwas dicklicher als der Tarzan, den man aus einschlägigen Filmen kennt, Tarzan also wirbelte herum und knallte dem Sansculotten einen harten Schwinger unter das Kinn.
Der Mann aus dem Volk verdrehte die Augen und setzte sich prompt auf seine vier Buchstaben.
»Wunderbar!« jauchzte Salome und strahlte Tarzan anerkennend an.
Der zweite Sansculotte sah sich vor. Er war gewarnt und wollte nach Tarzan treten, doch er verfehlte sein Ziel. Salome griff sehr schnell und energisch zu. Sie erfaßte sein Fußgelenk und zog das daran hängende Bein ruckartig hoch.
Worauf der zweite Sansculotte ebenfalls zu Boden ging und zwar mit dem Kopf voran.
Das Parkett dröhnte diskret, als der Mann sich mit seinem gesamten Körpergewicht auf dem Boden breitmachte. Dann blieb er regungslos liegen.
»Soll ich sie umbringen?« erkundigte sich Tarzan bei Salome. Er meinte die beiden Männer, die zu seinen Füßen auf dem Boden lagen.
»Später vielleicht«, erwiderte Salome, »warum sehen wir uns nicht die Hinrichtung an, Tarzan?«
*
Cagliostro stand schon an der Treppe, als er auf Salome aufmerksam wurde.
Waterson, in der Maske und im Kostüm des genialen Scharlatans, hatte praktisch im letzten Moment kapiert, was Salome und Tarzan da gerade gemeinsam praktiziert hatten.
Er wußte sofort, daß sich hinter den Schleiern der Salome nur eine gewisse Sue Weston verborgen halten konnte. Er ging schnell zurück in den oberen Saal und hielt auf Salome zu, doch sie war plötzlich nicht mehr zu sehen. Sie hatte sich unter das tanzende Volk gemischt und schien ihm aus dem Weg gegangen zu sein.
Waterson suchte gereizt nach ihr. Er stieß zwangsläufig auf die beiden Sansculotten, die gerade aus ihrer Ohnmacht erwachten und einen leicht verwirrten Eindruck machten.
»Ihr Idioten!« fauchte er sie an, »los, hoch! Das war sie! Sie kann nicht weit sein.«
Die beiden Sansculotten machten sich auf die Beine und trabten los. Cagliostro, alias Waterson, schob sich in das tanzende Volk und spürte plötzlich zwei starke Hände, die sich um seinen speckigen Hals legten.
Waterson warf sich sofort herum.
Er sah sich Tarzan gegenüber, dessen Augen wütend glitzerten.
»Was willst du hier, Fettsack?« fauchte Tarzan.
»Er will mich rauben!« beschwerte sich Salome, die neben Tarzan erschien.
»Nur über meine Leiche«, behauptete Tarzan.
Salome schmiegte sich reichlich lasziv an den Mann aus dem Dschungel. Und da sie nicht gerade vollständig bekleidet war, verspürte der sonst in Filmen so steril wirkende Tarzan ein angenehmes Kribbeln auf seiner Haut.
»Schaff ihn weg, Tarzan!« girrte Salome, »sperr’ ihn irgendwo ein!«
»Sind Sie wahnsinnig, Malvis?« schrie Waterson. Malvis war der wirkliche Vorname des Patienten, der jetzt den Tarzan spielte, »ich werde dich in die Einzelzelle sperren lassen, du Idiot!«
»Er nennt dich Idiot …« sagte Salome in fassungslosem Ton, »er nimmt dich nicht ernst, Tarzan!«
Nun hatte Salome, alias Sue Weston, den Arzt des Hauses offensichtlich unterschätzt. Waterson mochte zwar dick sein, aber er war stark und kannte sich in mehr oder weniger gemeinen Tricks recht gut aus. Er stieß mit dem Knie zu, worauf Tarzan heulte.
Er gab Cagliostro frei und rieb sich seinen schmerzenden Unterleib. Waterson nutzte die Chance und knallte Tarzan die Rechte in die Magenpartie.
Tarzan schrie auf und weinte dann.
Er verwandelte sich in einen kleinen, etwas verfettet aussehenden Jungen und rieb sich die Augen.
»Geh auf den Zimmer, Malvis!« sagte Waterson in einem etwas milderen Tonfall, »ich werde gleich nachkommen und dich behandeln. Geh jetzt!«
Tarzan nickte und schlich davon.
Als Cagliostro sich nach Salome umsah, war sie bereits verschwunden. Sie hatte es vorgezogen, die Nähe Watersons zu meiden.
Waterson zerbiß einen Fluch zwischen seinen Zähnen, wie es in einschlägigen Romanen so treffend heißt. Dann boxte er sich rücksichtslos einen Weg durch die tanzende Menge und suchte weiter nach Salome.
Er hatte vor, ihr nicht nur die wenigen durchsichtigen Schleier vom Körper zu reißen. Ihm gingen noch ganz andere Dinge durch den Kopf.
*
Robespierre stand auf dem Blutgerüst neben der betriebsfertigen Guillotine und schaute auf die tobende Menge. Mit einer knappen und herrischen Handbewegung verschaffte er sich Ruhe.
Er deutete auf Parker und Rander. Das heißt, er deutete eigentlich auf Ludwig XVI. und auf einen jungen Adeligen, deren Hände gebunden waren.
»Bürger«, schrie Robespierre eifrig, »ich verlange den Kopf dieser beiden Renegaten. Ich verlange den Kopf dieser Verräter. Und wer seinen eigenen Kopf verlieren will, der soll vortreten und diese beiden Schurken verteidigen!«
»Vielleicht war er mal Anwalt«, sagte Rander spöttisch zu Parker.
»Wie sieht’s mit Ihren Händen aus, Parker?«
»Ich muß bedauern, Sir«, erwiderte der Butler in der Maskerade des unglücklichen Ludwig, »ich habe unterwegs das Messer verloren!«
»Scheint kein guter Abend zu werden«, bemerkte Rander, der seine Enttäuschung verbergen wollte.
»Bürger Capet, seid Ihr bereit?« Robespierre wandte sich an Ludwig, wobei er ihn stilgerecht als Bürger Capet anredete, wie Ludwig nach seiner Festnahme durch das Volk nur noch genannt wurde.
»Ich verlange einen Geistlichen«, sagte Parker schnell und sehr laut. »Ihn kann und darf das Volk mir nicht verweigern.«
Robespierre war beeindruckt. Und etwas verlegen dazu.
»Ihr wollt einen Geistlichen?«
»Das ist mein Wunsch!«
»Abgelehnt!« schrie Robespierre, »außerdem haben wir keinen!«
»Ich bestehe darauf, daß die historische Genauigkeit eingehalten wird«, rief Parker mit ungewöhnlich lauter Stimme zum Volk hinunter, obwohl er im Augenblick nicht wußte, ob der unglückliche Ludwig seinerzeit geistlichen Beistand gehabt hatte.
»Den Kopf … Den Kopf!« rief in diesem Augenblick von der Treppe her eine laute und volle Stimme. »Worauf warten wir noch? Den Kopf … Den Kopf!«
Es war Cagliostro, der den Kopf so eindringlich forderte. Waterson wollte gewisse Dinge endlich hinter sich bringen, war Sue Weston nun gefunden oder nicht.
»Henker! An die Arbeit!« kommandierte Robespierre und nickte den beiden Knechten zu, die kraftvoll Zugriffen und Parker zur Wippe schleppten.
Es wurde still im Raum.
Man hörte nur die Schritte der beiden Männer, die den unglücklichen Ludwig zur Guillotine schleppten. Die Bretter des Blutgerüstes knirschten und quietschten.
*
Sue Weston wollte sich gerade nach unten stehlen, als sie von harten und starken Händen erfaßt wurde.
Sie wehrte sich wie eine Wildkatze und trat verzweifelt um sich. Doch gegen die Griffe der beiden Sansculotten kam sie nicht an. Diesmal wollten die Angestellten Watersons sie nicht mehr entwischen lassen.
Sue versuchte es mit einigen Judotricks, aber sie handelte sich nur ein paar deftige Ohrfeigen ein. Gegen diese Muskelpakete hatte sie keine Chance.
Die beiden Sansculotten nahmen sich einige Frechheiten heraus, die mit Sues leichter Kleidung zusammenhingen. Sie schienen es darauf abgesehen zu haben, Randers Sekretärin aus ihren dünnen Schleiern herauszuschälen. Was nicht sonderlich schwer war, wie sich bereits zeigte. Den Oberkörper Sues hatten sie bereits von lästigen Kleidungsstücken befreit. Und jetzt drängten sie Salome in eine Zimmerecke, um ihr Werk zu vollenden.
Doch sie hatten Robin Hood übersehen.
Der edle Räuber aus dem Wald tauchte hinter ihnen auf. Er hatte Pfeil, Köcher und Bogen abgelegt. Er hielt in jeder Hand eine ganz reguläre Blumenvase.
Und diese Vasen zertrümmerte er fachgerecht auf den Hinterköpfen der beiden zudringlichen Sansculotten.
Die Männer gingen prompt zu Boden und vergaßen ihre Absichten.
Salome wandte sich zu Robin Hood um.
»Ich bin Clive Muscat«, sagte Robin Hood schnell, »keine Angst … Schnell nach unten … Sie wollen mit der Hinrichtung beginnen.«
Sue reagierte automatisch.
Sie nickte und rannte nach unten.
Da sich einige stark flatternde Schleier in den Füßen eines Sansculotten verfangen hatten, riß sie sich wütend los, worauf bis auf einen Schleier sämtliche übrigen Hüllen zurückblieben.
Sue achtete nicht darauf.
Es war ihr gleichgültig, wie sie aussah und was sie trug. Hauptsache, sie konnte das Schreckliche, das dort unten im Keller geschehen sollte, noch abwenden.
*
Parker ließ sich scheinbar willenlos vor die Wippe der Guillotine führen. Er schien sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. Aber selbstverständlich dachte er nicht daran, sich ohne weiteres um einen Kopf kürzer machen zu lassen. Er wußte, daß ihm danach ein wichtiger Körperteil fehlen würde.
Die beiden Henkersknechte griffen bereits nach den Lederriemen, um Parker auf der Wippe festzuschnallen. Sie taten das schnell und routiniert.
Robespierre stand mit verschränkten Armen seitlich neben der Guillotine und schaute aufmerksam zu.
Im Saal knisterte es förmlich vor Spannung.
Rander sah beschwörend zu Parker hinüber, der sich nach wie vor nicht rührte. Dem Anwalt kam plötzlich der schreckliche Verdacht, Parker habe sich zum erstenmal seit ihrer Zusammenarbeit mit seinem Schicksal abgefunden.
»Für die Freiheit des Volkes!« schrie Robespierre, als die beiden Henkersknechte den Butler dicht vor die Wippe drängten.
»Für das Volk!« jauchzte in diesem Moment eine offensichtlich animierte Frauenstimme. Worauf sich alle, selbst die Knechte auf dem Blutgerüst, zu der Stimme umdrehten.
Was sie zu sehen bekamen, lohnte sich durchaus.
Salome tanzte mit weitausholenden Schritten und lasziven Bewegungen in den Saal hinein. Plötzlich erklang dazu auch über die Saallautsprecher die entsprechende Musik.
Salome stellte eine berufsmäßige Stripperin glatt in den Schatten.
Sie bog ihren Körper in schlangenförmigen Bewegungen, sparte nicht mit entsprechend einladenden Gesten und sorgte innerhalb weniger Sekunden für eine erotische Schwüle, die man fast körperlich spürte.
Das eben noch aufgebrachte Volk ließ sich ausgesprochen willig ablenken. Es genoß die Darbietungen der Salome, die mit ihrem letzten Schleier kämpfte und sich nicht entschließen konnte, auch ihn fallen zu lassen. Sie deutete das zwar wiederholt an, aber sie zögerte diesen Zeitpunkt gekonnt hinaus.
Cagliostro war wütend.
Er spürte den allgemeinen Umschwung. Er wußte, wer diese Salome war. Und er räumte insgeheim ein, daß sie sich genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht hatte.
Waterson hütete sich, diesen Tanz durch einen lauten Befehl zu stören. Er ahnte, daß man ihn dann wohl in der Luft zerreißen würde. Das Volk hatte sein Schauspiel und würde es sich bestimmt nicht nehmen lassen.
Salome war eine Könnerin.
Das mußte auch Parker zugeben, der dicht vor der Wippe stand, auf die man ihn noch nicht festgeschnallt hatte. Die beiden Henkersknechte sahen fasziniert auf die Tänzerin und rissen sich jetzt ihre Kapuzen von den Köpfen. Sie waren offensichtlich ins Schwitzen geraten.
Salome hatte sich inzwischen an Cagliostro herangearbeitet und konzentrierte sich auf diesen Scharlatan, der sie wütend musterte.
Sie wand sich wie eine Schlange, girrte verlockend und drängte ihre nackten Brüste gegen ihn. Dann schnellte sie sich zurück und widmete sich wieder anderen Opfern.
Rander hatte die Lippen fest zusammengepreßt.
So hatte er seine reizende Sekretärin noch nie gesehen oder erlebt. Er fand Sue wunderbar. Sie hatte bereits alle Anwesenden in ihren Bann geschlagen.
Und sie hatte sich verausgabt, wie sich bald zeigen sollte.
Sue Weston blieb wieder vor Cagliostro stehen und fiel dann in einer Geste der Ergebenheit vor ihm zusammen.
»Zur Sache … Zur Sache!« brüllte Cagliostro schnell und deutete hinüber auf das Blutgerüst.
Sofort sprang Salome wieder auf und ließ den letzten und einzigen Schleier flattern.
Sie war jetzt völlig nackt und bot ihren makellosen Körper dem staunenden Volk.
Cagliostro merkte, daß seine Aufforderung nicht gehört worden war.
Ja, er hatte plötzlich alle Hände voll zu tun, um sich Salome vom Hals zu halten. Die Tanzende umgirrte ihn und warf sich ihm buchstäblich an den Hals.
Cagliostro verspürte plötzlich einen harten Schlag im Genick und wurde unsicher auf den Beinen.
Salome hatte ihm diesen Schlag durchaus gekonnt verpaßt, zumal sie ihn in ihren Tanz eingebaut hatte.
Cagliostro ging in die Knie.
Was Sue Weston zusätzlich nutzte. Sie trat ihm in die linke Kniekehle und sorgte dafür, daß der massige Doktor zu Boden fiel.
Triumphierend umtanzte sie ihn, Und immer dann, wenn Cagliostro sich erheben wollte, verpaßte sie ihm einen Fußtritt, der als solcher kaum zu erkennen war. Sie schien ihn jedesmal nur spielerisch zu berühren.
Parker nutzte die allgemeine Spannung, um seine Befreiung vorzubereiten.
Da man seine Beine losgebunden hatte, damit man ihn sach- und fachgerecht auf die Wippe schnallen konnte, benutzte er seinen linken Fuß dazu, die Wippe zurück in die Ausgangsposition zu drücken. Sie befand sich jetzt wieder in waagerechter Lage.
»Schluß jetzt!« brüllte Cagliostro, der sich endlich erhoben hatte, »laßt die Köpfe rollen!«
Die Henkersknechte schauten irritiert auf Parker. Der Butler deutete mit dem Kopf auf die Wippe.
»Die Wippe«, sagte er schnell, »dort … seht doch!«
Sie beugten sich vor, um besser sehen zu können.
Genau in diesem Moment trat Parker mit dem rechten Fuß hart und schnell auf die Wippe, die sofort nach oben schnellte und … gegen die Stirn der beiden Männer knallte.
Sie waren förmlich zurückgeworfen, torkelten verwirrt auf dem Blutgerüst herum und … kamen in die gefährliche Nähe des Gerüstrandes.
Parker war ihnen nachgeeilt und beförderte sie mit schnellen Fußtritten nach unten.
Die Henkersknechte warfen die Arme haltsuchend in die Höhe, bevor sie ihre Luftreise antraten.
»Es lebe die glorreiche Revolution«, brüllte Parker, bevor er das Blutgerüst verließ.
*
Cagliostro boxte sich durch die schreiende Menge. Sein Ziel war das Blutgerüst mit der Guillotine. Doch er hatte es schwer, nach dort zu kommen. Die anwesenden Masken rannten und schrien durcheinander, ein kleines, mittelschweres Chaos schien ausgebrochen zu sein.
Robespierre sah sich um seinen Ludwig betrogen.
Also wollte er sich an dem jungen französischen Adeligen schadlos halten. Er warf sich förmlich auf Mike Rander und zerrte ihn zur Guillotine.
Was Rander sich selbstverständlich nicht gefallen ließ.
Der junge Anwalt, dessen Beine frei waren, nutzte sie sehr geschickt und bedenkenlos. Robespierre wurde zwar an seinem Vorhaben gehindert, aber er war sehr stark und schaffte es, Rander an die Wippe heranzubekommen.
»Den Kopf … Den Kopf!« brüllte Cagliostro mit mächtiger Stimme. Er wollte das Volk wieder auf das Blutgerüst konzentrieren, was ihm fast gelang.
Robespierre knallte Rander förmlich gegen die hochstehende Wippe.
Die ersten Teilnehmer an der öffentlichen Hinrichtung nahmen die Schreie Cagliostros auf und verlangten ebenfalls nach einem Kopf. Watersons Taktik schien ihre Früchte zu tragen.
Salome arbeitete sich wütend durch die Menge nach vorn. Sie wollte Rander zu Hilfe kommen, doch sie hatte Schwierigkeiten mit einem gewissen Cäsar, der ihr Gesäß tätscheln wollte.
Womit ein gewisser Hannibal wieder nicht einverstanden war. Er trat Cäsar genußvoll in die Kehrseite und wehrte gleichzeitig Napoleon ab, der Salome wohl nach St. Helena entführen wollte.
Sue war verzweifelt.
Es ging um Sekunden, wie sie genau sah.
Rander wurde von Robespierre bereits auf der Wippe festgebunden.
Parker wurde von den beiden auf das Blutgerüst zurückgekehrten Henkersknechten ergriffen. Sie knallten ihn auf den Bretterboden und lieferten sich eine harte Schlacht.
Salome hatte Cäsar hinter sich gelassen, doch sie hatte die Rechnung ohne Kleopatra gemacht.
Kleopatra war eifersüchtig.
Mit Händen, die an Krallen erinnerten, warf sich die ägyptische Königin auf Salome. Sie hatte die deutlich erkennbare Absicht, Sue das Gesicht zu zerkratzen.
Cagliostro hatte sich seitlich an die Wand gedrückt und starrte hinauf zur Guillotine.
Robespierre schien es geschafft zu haben.
Rander klebte förmlich an der Wippe, die jetzt nur noch hinunter gekippt zu werden brauchte. Dann konnte das Fallbeil seine Arbeit tun.
Doch plötzlich blieb Robespierre wie erstarrt stehen. Zwischen seinen Schulterblättern erschien der Schaft eines Pfeils.
Robespierre ließ sich von einem heftigen Zittern erfassen, das seinen Körper durchschüttelte. Dann brach er – wie vom sprichwörtlichen Blitz getroffen – haltlos in sich zusammen.
»Nieder mit den Henkersknechten«, brüllte Robin Hood von der Treppe her in den Saal, »Freiheit für die Unterdrückten!«
Der edle Räuber legte gerade einen zweiten Pfeil auf die Sehne seines großen Bogens und … ließ ihn in den Saal zischen.
Was Cagliostro gar nicht sonderlich schätzte, wie sich zeigte.
Doc Waterson brüllte auf und betrachtete verwirrt und irgendwie auch angeekelt den Pfeil, der sich in seinem rechten Oberarm eingenistet hatte.
»Liebe statt Krieg«, jauchzte Sue Weston, die sich endlich bis zum Blutgerüst durchgekämpft hatte. Sie stieg zur Guillotine hoch und befaßte sich mit den Henkersknechten, die sich auf sie stürzen wollten.
Cäsar und Napoleon verwickelten die beiden Kerle in einen echten Nahkampf, an dem sich Hannibal nach einigem Zögern beteiligte. Salome aber baute sich mit ihrem nackten Körper in einer äußerst verführerischen Pose neben der Guillotine auf und warf Handküsse in die Menge.
»Liebe statt Krieg«, rief sie erneut und trat gleichzeitig einem Henkersknecht gegen das Knie, als dieser Mann sich vom Schauplatz entfernen wollte.
Dann warf Sue sich halb auf Rander und küßte ihn ostentativ.
Womit der Friede sich ausbreitete.
Ein sehr eindeutiger Friede übrigens, wie sich schnell zeigte. Sues Beispiel wurde allenthalben nachempfunden. Innerhalb weniger Sekunden verwandelte das aufgebrachte Volk sich in eine friedliche und liebende Lämmerherde.
*
Sheriff Denver war sehr kleinlaut geworden.
Er stand im Besuchszimmer des Sanatoriums und hatte sich von Robin Hood gerade einen Spezialausweis zeigen lassen.
»Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« fragte er schließlich, »ich hätte wissen müssen, daß Sie FBI-Mann sind!«
»Das war mir zu gefährlich, Denver«, sagte Robin Hood, alias Walt Stiles, »vielleicht wäre dann durchgesickert, wer ich bin!«
»Und warum diese böse Überraschung für meine bescheidene Person?« wollte Josuah Parker von dem FBI-Agenten wissen. Der Mann trug noch immer sein Robin-Hood-Kostüm.
»Ich brauchte die letzten Beweise, daß Waterson die Patienten für seine Zwecke ausnutzte«, erwiderte Stiles, »ich mußte meine Rolle durchspielen. Sie sehen, es ging ja noch mal alles gut!«
»Dank Ihnen, Sue!« Rander wandte sich an seine Sekretärin, die zu seinem Leidwesen nicht mehr im Kostüm der Salome war.
»Mir hat dieser blutige Spaß gereicht«, sagte Sue und schüttelte sich, »Waterson wollte wirklich Köpfe rollen lassen!«
»Und ob«, schaltete sich Stiles wieder ein, »die Schuld hätte er dann seinen Patienten in die Schuhe geschoben. Falls dieser Doppelmord überhaupt ans Tageslicht gekommen wäre.«
»Mir können Sie gar nichts«, sagte Sheriff Denver gereizt, »ich habe nur meine Pflicht getan.«
»Natürlich.« Stiles winkte lässig ab. »Ob Sie sie wirklich nur getan haben, wird die Untersuchung ergeben. Sie haben sich auf jeden Fall zu sehr von Waterson einwickeln lassen.«
»Das muß man mir erst mal beweisen!« reagierte Denver und stampfte wütend aus dem Zimmer.
»Steckte er mit Waterson unter einer Decke?« fragte Rander, sich an Stiles wendend.
»Er war zumindest korrumpiert und hat sich zu schnell einwickeln lassen«, entschied Stiles, »warten wir ab, was Waterson zu diesem Punkt sagen wird. Er ist völlig unten durch und wird sicher aussagen und versuchen, die Schuld auf andere zu schieben.«
»Dagegen werden ein paar Leute etwas einzuwenden haben«, meinte Rander, »Sie oder Ihre Leute können vier Mitarbeiter Watersons abholen. Mister Parker war so freundlich, sie aus dem Verkehr zu ziehen.«
»Vielen Dank, nachträglich«, sagte Stiles und lächelte den Butler an, »Sie haben mir sehr geholfen …«
»Sie allerdings auch. Ihre Bogentechnik ist bemerkenswert, wie ich feststellen konnte.«
»Bleibt jetzt die Frage, warum die Moberlys so plötzlich zurück nach Hause fuhren«, sagte Sue, »das begreife ich immer noch nicht. Zuerst wollten sie doch unbedingt, daß der Tod ihres Jungen geklärt wurde!«
»Ich habe das arrangiert«, sagte Stiles lächelnd, »über meine Mitarbeiter. Die Hartnäckigkeit der Moberlys störte meine Arbeit. Ich mußte Waterson wieder in Sicherheit wiegen. Und ich hoffte auch, daß Sie geblieben sind. Allein hätte ich es wohl nie geschafft.«
»Wir ebenfalls nicht«, sagte Rander und blickte auf Parker und Sue, »ich bin froh, daß dieser Waterson ausgeschaltet ist. Aber was wird jetzt aus den wirklichen Patienten?«
»Die wird ein staatliches Haus übernehmen«, erklärte Stiles, »mit der Einschränkung allerdings, daß Maskenfeste à la Waterson wohl nicht mehr stattfinden werden.«
*
Als Rander, Parker und Sue Weston das Hauptgebäude des Sanatoriums verlassen wollten, kreuzte Kleopatra den Weg.
Sie sah giftig auf Sue. Sie erinnerte sich wohl noch sehr intensiv an eine gewisse Salome.
Hinter einer Gittertür standen Cäsar, Hannibal und Napoleon. Sie winkten Sue zu und wandten sich traurig ab, um sich dann gleich wieder zu streiten.
»Irgendwie erinnert mich das alles an einen Alptraum«, sagte Sue.
»Und doch war es eigentlich aufregend schön«, sagte Rander versonnen.
»Meinen Sie jetzt den Tanz der Salome, Sir?« erkundigte sich Josuah Parker gemessen und höflich bei seinem jungen Herrn. »Oder dachten Sie mehr an die gesamte Situation?«
»Raten Sie mal«, gab Rander lächelnd zurück und übersah freundlichst, daß Sues Gesicht von einer leichten Röte überzogen wurde.
- E N D E -