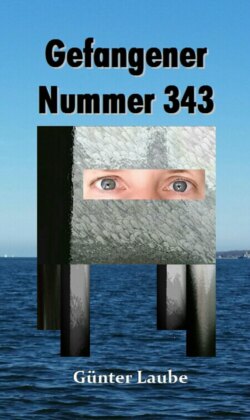Читать книгу Gefangener Nummer 343 - Günter Laube - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Das Gefängnis
Оглавление»Sie sollten nicht hier sein, das ist kein Ort für eine Frau!«
Der Empfang durch den Direktor des neuen Hochsicherheitsgefängnisses war mehr als distanziert. Die Atmosphäre war kühl, ja frostig.
»Das ist eine Frage der Perspektive«, entgegnete ich und streckte ihm meine Hand entgegen. »Sophia Fernández«, stellte ich mich vor, »vielen Dank, dass Sie mich empfangen!«
Ich hatte mich bemüht, keine Ironie in meine letzten Worte zu legen, und es schien mir gelungen zu sein. Einem prüfenden Blick folgte ein kräftiger Händedruck. »Kenneth Thompson«, sagte er dann ohne eine Miene zu verziehen.
Wir standen in einer Art Innenhof, auf dem Dach eines Gebäudes, das, wie ich wusste, auf vier mächtigen Pfeilern auf einem künstlich verstärkten Atoll im Pazifik ruhte.
Die Vereinten Nationen hatten dieses Großprojekt vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um die gefährlichsten und mächtigsten verurteilten Verbrecher der Welt, die in manchen Ländern die Todesstrafe zu erwarten hatten, an einem sicheren Ort zu verwahren. Lebenslänglich. Zur Rettung ihrer Seele und Abkehr von der Tötung von Menschen, wie es in einem offiziellen Dokument hieß. Tatsächlich waren die meisten Insassen Mörder, nur in einigen wenigen Ausnahmefällen hatten die zuständigen Gerichte entschieden, dass ein normales Gefängnis nicht ausbruchsicher genug war, um die Gefangenen, die zwar keinen Mord aber dennoch ein schwerwiegendes Verbrechen begangen hatten, längere Zeit in ihren Heimatstaaten in Gewahrsam zu behalten. Eine Verurteilung musste vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag erfolgen, nur in Ausnahmefällen konnte eine Verurteilung auch durch ein Bundesgericht oder eine vergleichbare Institution der fünf ständigen Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates vorgenommen werden.
Auf der Suche nach einem geeigneten Ort war man auf ein Atoll der Marshallinseln gestoßen, dass infolge des Klimawandels seit einigen Jahren zum Teil unter Wasser lag. Die Inselgruppe im Pazifik, zwischen Hawaii und Papua-Neuguinea, zählt zu Mikronesien und schien auf Grund seiner geographischen Lage, der klimatischen Bedingungen und der politischen und historischen Gegebenheiten als idealer Standort in mehrfacher Hinsicht. Die im sechzehnten Jahrhundert von Spaniern entdeckte Inselgruppe befand sich im Laufe der Geschichte sowohl unter deutscher wie japanischer Verwaltung, bevor die USA nach dem Zweiten Weltkrieg als Treuhänder im Auftrag der Vereinten Nationen die Herrschaft übernahmen, die sie auch nach 1990, dem offiziellen Ende der Treuhandverwaltung, de facto nach wie vor inne haben. So wäre zivilisiertes Leben auf den Inseln ohne Unterstützung seitens der Amerikaner undenkbar, die auf dem zur Inselgruppe gehörenden Bikini-Atoll in der Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts zahlreiche Kernwaffentests durchführten und noch heute einen Raketenstützpunkt auf dem Kwajalein-Atoll betreiben.
Entsprechend ist in diesem Gebiet seit jeher viel Militär stationiert, vor allem amerikanisches. Neben der von jeglichem Festlandgebiet der Erde weit entfernten Lage einer der ausschlaggebenden Punkte bei der Wahl des Ortes. Auf einem Seegebiet von der Größe Frankreichs plus Spaniens fanden sich noch zum Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts über eintausendzweihundert Inseln, die insgesamt eine Landfläche vergleichbar der Größe von Washington D. C., der Hauptstadt der USA, ausmachten. Doch die Fläche und damit die Bewohnbarkeit der Inseln und Atolle schrumpfte im Zuge der Klimaveränderung, so dass schließlich nur noch wenige Inseln bewohnt blieben. Die verbliebenen Einheimischen arbeiten zum Großteil für die US-Armee, betreiben Fischfang und Ackerbau. Dem seit Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts einsetzenden Tourismus-Boom wurde im Zuge der Konzipierung des Gefängnisses ein jähes Ende bereitet, das komplette Gebiet wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt.
Nach sechsjähriger Bauzeit war dieses Gebäude in Form eines Würfels vor vier Jahren feierlich eröffnet worden. Während der Eröffnungszeremonie, an der neben hochrangigen UN-Vertretern auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnahmen, waren Filme über Sicherheitsüberprüfungen, die sowohl militärische Elite-Einheiten wie auch internationale Firmen durchgeführt hatten, gezeigt worden; sie sollten den Geldgebern verdeutlichen, dass dank ihrer Unterstützung tatsächlich das absolute Gefängnis entstanden war.
»Ausbruch unmöglich, Flucht unmöglich«, war das Motto der Veranstaltung, und dieses Motto hatte in den vergangenen Jahren an Nachhaltigkeit gewonnen. Es war in vier Jahren nicht ein einziger Fluchtversuch unternommen worden, geschweige denn gelungen.
Dabei waren hier mittlerweile über dreihundert Gefangene untergebracht. Meine Aufgabe war es nun, im Auftrag des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen die Verhältnisse vor Ort zu überprüfen. In jeglicher Hinsicht. Es sollte ein Bericht erstellt werden, der nach fünfjähriger Inbetriebnahme des Gefängnisses den beteiligten Staaten präsentiert werden sollte.
Thompson war der erste Direktor, laut seiner Akte hatte er zuvor im Pentagon gearbeitet. Er war siebenundfünfzig Jahre alt, konnte auf eine recht erfolgreiche militärische Laufbahn in der US-Army, in der er es bis zum Lieutenant Colonel gebracht hatte, zurückblicken und war vor fünfzehn Jahren ins Pentagon versetzt worden. Dort begann seine zweite Karriere, als Zivilist und im Grunde als Politiker. Die Leitung dieses Gefängnisses war die Krönung seiner Laufbahn, und als Direktor war er mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet, die sich auch auf das Militär erstreckten.
»Bitte folgen sie mir!«, sagte er und drehte sich um.
Ich folgte ihm. Etwa zwanzig Meter von der Hubschrauberlandefläche entfernt war eine Öffnung im Boden. Als ich näherkam, sah ich zehn kreisförmig angeordnete Stufen, über die man zu einer Plattform gelangte. In deren Mitte war eine Wendeltreppe, die nach unten führte. Beim Abstieg zählte ich zweiundzwanzig Stufen.
Die Sicherheitsüberprüfungen hatten ergeben, dass dies tatsächlich der einzige Ausgang war, der einzige Weg nach oben. Die Wände des Gefängnisses waren praktisch unzerstörbar, weder Chemikalien, Säuren oder Salzwasser konnten größeren Schaden anrichten. Um ein Loch in die Außenwand zu sprengen, würde man mindestens eine Panzerfaust benötigen.
Während er eine Tür mit einer Chipkarte öffnete, sagte er: »Wir sind jetzt in der neunten Etage, dem Verwaltungstrakt. Hier habe ich mein Büro, und ebenso befindet sich hier ein Raum für die Diensthabenden, das sind immer vier Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten. Die ärztliche Station, drei Labore, eine Bibliothek und einige weitere Räume befinden sich ebenfalls auf dieser Etage, zum Beispiel das Büro des ärztlichen Direktors sowie entsprechende Behandlungsräume und eine kleine Apotheke. In der achten Etage sind die Kantinen für Häftlinge und Personal sowie eine Sporthalle für das Personal, die Etagen eins bis sieben beherbergen unsere Insassen. Für den Rest ihres Lebens. Aber das alles dürfte Ihnen ja wahrscheinlich bereits bekannt sein.«
»Ja, aber in der Praxis wirkt es doch leicht anders, als wenn man es auf dem Papier liest oder in Filmen oder auf Fotos sieht«, erwiderte ich. Mir war ein bisschen mulmig zumute. Noch nie in meinem Leben war mir bewusst geworden, dass ich so abhängig von anderen Menschen war.
Ohne einen Hubschrauber war ich in diesem Gebäude gefangen. Es war nur durch die Luft erreichbar, von dem Oberdeck, das von einer dreieinhalb Meter hohen, glatten Wand eingerahmt war, hinter der es einhundert Meter in die Tiefe ging. Ins Wasser. In den Pazifik.
»Das System ist perfekt, das Gefängnis ist perfekt! Zu uns kommen nur solche, die es verdient haben«, sagte er im Brustton der Überzeugung. »Ausbruch unmöglich, Flucht unmöglich.«
Ich glaubte ihm aufs Wort. Die Überprüfungen seitens mehrerer Fachleute hatten dem Gefängnis gewissermaßen einen Status zuerkannt, der in der Branche einzigartig war. Der Bericht, der von einem ehemaligen Direktor eines US-amerikanischen Bundesgefängnisses verfasst worden war, war mir noch am besten in Erinnerung, da er im Gegensatz zu den anderen Berichten mit einer gehörigen Portion Sarkasmus endete. Sinngemäß lautete sein Fazit: »Hätte ich die Möglichkeiten gehabt, die hier im Auftrag der UN geschaffen worden sind, dann wäre mir kein Häftling entkommen. Es gibt nur einen Ausgang nach draußen, auf eine Plattform, die von einer dreieinhalb Meter hohen Mauer umgeben ist. Ohne Hilfe oder Hilfsmittel ist es undenkbar, dort hinüber zu gelangen. Man würde es aber auch gar nicht wollen, denn jenseits der Mauer wartet ein hundert Meter tiefer Abgrund. Sollte man diese Mauer dennoch bewältigen und auch den Hundert-Meter-Sprung in den Pazifik überleben, würde man sich in einem angenehm temperierten Wasser wiederfinden, über sich das Gefängnis, von dem aus man nicht verfolgt würde, da mit Sicherheit kein Wachtposten hinterherspringen würde. Der Flüchtling könnte dann also eigentlich entspannt zu der nicht allzu weit entfernten Insel schwimmen, wären da nicht die Meeresbewohner des größten Ozeans der Welt, die ihn unter Umständen als Zwischenmahlzeit betrachten könnten, und die Soldaten, die ihn auf der Insel erwarten würden, nur um ihn anschließend wieder in das Gefängnis zurück zu bringen. Per Helikopter. Der Häftling müsste also vor seiner Flucht über die Mauer dafür sorgen, dass er nach seinem Sprung von einem Boot aufgelesen werden könnte, mit dem er – nirgendwohin fahren würde, denn das gesamte Gebiet ist Militärisches Sperrgebiet. Jedes Schiff, jedes Flugzeug, jedes U-Boot, das unangemeldet in das Gebiet eindringen würde, würde sofort mehrere Kampfjets auf den Plan rufen, die von dem nächstgelegenen Militärstützpunkt auf einer Insel oder einem Flugzeugträger starten würden. In einem Umkreis von hundert Meilen um das Gefängnis sind die Piloten berechtigt, jedes Flugzeug entweder abzudrängen oder abzuschießen. Wer also nicht über eine kleine Privatarmee mit einem Wasserflugzeug, einem Schiff oder einem U-Boot verfügt, mit dem er schneller ist als ein Jet, sollte das Etablissement nicht unplanmäßig verlassen. Das Klima ist immerhin recht angenehm, auch in dem Gebäude, das Essen ist überdurchschnittlich gut, für das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden ist ebenfalls gesorgt, und draußen wartet nur der Tod.«
Wir waren derweil über den Flur gegangen und standen vor einer Tür, die Thompson öffnete. »Ich werde Sie jetzt mit einigen weiteren Mitarbeitern bekannt machen.«
In dem Büro standen zwei Männer an einer Wand, an der eine Seekarte angebracht war. Bei unserem Eintritt drehten sie sich um.
Vor meiner Abfahrt in New York hatte ich zur Vorbereitung die Akten aller Mitarbeiter gelesen und kannte daher die biographischen Daten. Da auch Fotos in den Akten waren, wusste ich sofort, wen ich vor mir hatte.
»Darf ich vorstellen«, sagte der Direktor, »Professor Walter Baranowski, Leiter der medizinischen Abteilung, und Doktor Lars Sörensen, sein Stellvertreter und engster Mitarbeiter. Beide sind so lange hier wie ich. Wir waren sozusagen die ersten Bewohner des Hauses. Meine Herren, darf ich vorstellen ..., Doktor Sophia Fernández. Sie wird unser Domizil im Laufe der nächsten Woche einer eingehenden Betrachtung unterziehen ..., im Auftrag des Sicherheitsrates.«
Der Professor kam auf mich zu. Ein ruhiger Blick, dann gab er mir die Hand. »Guten Tag!«
»Guten Tag!«
»Guten Tag!«, sagte auch sein Kollege Doktor Sörensen und gab mir ebenfalls die Hand.
»Guten Tag!«
Baranowski betrachtete mich noch immer mit ruhigem Blick, dann sagte er: »Ich wurde von dem Direktor bereits gestern informiert, dass Sie kommen würden. Wenn Sie Fragen zu unserer Forschung und unserer Arbeit haben, können Sie sich gern an mich wenden.«
»Danke sehr, das werde ich.«
»Sind Sie auch Ärztin?«, fragte Sörensen.
»Nein ..., Rechtspsychologin. Mein Studium beinhaltete allerdings ein praktisches Jahr an einer Universitätsklinik, und dabei hatte ich in einem Semester sogar die Gelegenheit, in der Rechtsmedizin in Berlin und in Paris zu arbeiten, so dass ich mit den medizinischen Grundlagen halbwegs vertraut bin.«
»Eine faszinierende Kombination«, stellte der Professor fest. »Das Studium war aber auch nicht in sieben Jahren zu schaffen.«
»Nein, ich habe neun Jahre gebraucht ..., aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe seit fünf Jahren wohl so eine Art Traumjob. Für die Vereinten Nationen durch die Welt zu reisen und dabei mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen zu arbeiten und die verschiedensten Situationen zu erleben ...«
»Ja ..., klingt interessant«, meinte Sörensen. »Aber wenn Sie so viel unterwegs sind, dann sprechen Sie auch viele Sprachen?«
»Ja ..., da musste ich zum Glück nicht mehr viel lernen. Ich bin gewissermaßen dreisprachig aufgewachsen, meine Mutter ist Spanierin, mein Vater Franzose, und in der Schule hatte ich ab der ersten Klasse Englisch. Sprachen zu lernen und zu sprechen war nie ein Problem für mich, und im Laufe meines Lebens kamen noch einige andere hinzu. Die unterschiedlichen Gesetze und deren Auslegung in den verschiedenen Ländern der Welt zu verstehen ist da weitaus schwieriger.«
»Von der menschlichen Psyche einmal abgesehen«, sagte Baranowski. Ich wusste, dass er nicht nur Arzt und Universitätsprofessor der Medizin war, sondern auch Psychologe und Psychotherapeut. Er hatte vor zwanzig Jahren in Kriegsgebieten gearbeitet, und war in der praktischen Arbeit ebenso erfahren wie in der Theorie im Lehrsaal. Nicht ohne Grund war er mit der Leitung der medizinischen Abteilung beauftragt worden.
»Das ist richtig. Die Menschen unterscheiden sich innerlich mehr als äußerlich.«
»Wo waren Sie zuletzt?«, erkundigte sich Sörensen.
»Ich war jetzt längere Zeit in New York ..., das war wohl in gewisser Weise mein Glück, denn so war ich sofort verfügbar. Eigentlich hätte mein Chef einen Kollegen hierher schicken wollen, doch der musste kurzfristig zu einem anderen Einsatzort.«
»Wohin?«
Ich wertete es als Reflex und hielt die Frage insofern für ganz natürlich. Da ich ihm jedoch nicht sagen durfte, worum es bei dem Einsatz ging, begegnete ich Sörensen mit einer ebenso direkten und – wie ich hoffte – leicht humorvollen Antwort: »Das ist ..., sagen wir, Geheimsache. Wir ermitteln nicht immer so offen, wie ich es hier bei Ihnen tue. Ich denke, Sie werden das verstehen.«
»Aber selbstverständlich ..., es war nur Neugierde«, bekannte er.
Bevor eine peinliche Pause entstehen konnte, erkundigte sich Baranowski: »Gibt es ein spezielles Thema in medizinischer Hinsicht, dass Sie für Ihren Bericht untersuchen wollen, Miss Fernández?«
»Wieder eine direkte Frage«, dachte ich. »Aber diesmal ist es kein Reflex, sondern wohl überlegt.« Ich sah dem Mediziner ruhig in die Augen. »Ja, ich möchte sicherstellen, dass es hier keine Menschenversuche oder etwas Derartiges gibt.«
Die drei Männer wechselten einen Blick.
»Das klingt ja dramatisch. Was haben Sie gedacht, was Sie hier finden würden?« Doktor Sörensen schien nicht erfreut zu sein über die Frage. »Glauben Sie, dass wir hier an den Gefangenen herum experimentieren?«
»Meine Anwesenheit ist keine Glaubenssache, sondern hat schlicht mit Erkenntnis zu tun. Es war auch nicht meine Idee ..., obwohl das Thema mir selbstverständlich am Herzen liegt ..., aber die Punkte, die ich hier während meines Aufenthaltes zu klären habe, sind Vorgaben seitens des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.«
Es setzte eine fast hörbare Stille ein. Doch sie währte nur kurz.
»Diesen Punkt können Sie als erledigt betrachten«, erklärte der Professor mit Nachdruck.
Thompson nickte bekräftigend, und Sörensen erklärte mir: »Wir sind hier im Gegenteil daran interessiert, nach dem Ursprung des Lebens zu suchen ..., den Menschen noch besser zu verstehen. Doch darüber wird Ihnen sicherlich Professor Nilsson Genaueres erzählen. Er ist der wissenschaftliche Leiter der Forschungsabteilung und hat sein Büro auf der Insel. Er ist auch der älteste Wissenschaftler vor Ort ..., es ist seine letzte Station vor dem Ruhestand. Wir anderen sind alle etwas jünger ..., na ja die meisten jedenfalls.«
Ein spöttisches Grinsen galt Baranowski, der, wie ich wusste, auch schon fast sechzig Jahre alt war.
»Wer solche Mitarbeiter hat, braucht keine Feinde«, seufzte Baranowski, doch ich merkte, dass er es nicht ernst meinte. »Wenn ich da sehe, wenn so eine junge Frau wie Sie daher kommt ...«
»Ich stehe in der Mitte des Lebens«, erklärte ich. »Ich bin noch jung genug, um neue Impulse zu geben, aber auch erfahren genug, um ...«
Jemand klopfte an die Tür, öffnete sie und trat ein. Ein junger Mann stand im Büro, hinter ihm sah ich noch eine Gestalt, doch blieb der erste stehen, als er uns sah. »Oh, Entschuldigung!«
»Kein Problem!«, sagte Thompson, »kommen Sie ruhig herein ..., dann kann ich Sie bekannt machen.«
Der Angesprochene kam näher, gefolgt von einem weiteren jungen Mann.
»Maik Broders und Björn Altmann ..., Doktor Sophia Fernández von den Vereinten Nationen«, stellte Thompson uns einander vor.
Wir gaben uns die Hand. »Hallo, angenehm.«
Ich wusste nicht, wie viel die beiden wissen durften und überließ daher dem Direktor die weitere Vorstellung: »Miss Fernández ist zu uns geschickt worden, um mal nach dem Rechten zu sehen. Und um zu prüfen, ob das Geld sinnvoll eingesetzt ist.« Er gestattete sich ein Lächeln.
Die Männer lachten.
»Und vielleicht ist sie auch da, um Ihre Forschungsarbeiten ein wenig unter die Lupe zu nehmen.«
»Wirklich?« Björn sah mich neugierig an.
»Halb so wild«, wiegelte ich ab. »Ich bin Rechtspsychologin, keine Naturwissenschaftlerin.«
»Das macht nichts«, betonte Maik. »Sie können gerne an unseren und meinen Forschungen teilhaben.«
Thompson stöhnte gespielt und mit leicht gequälter Miene. »Er kann es einfach nicht lassen. Kaum ist eine Frau im Raum ..., ts ts ...«
»Die Jugend von heute!«, seufzte Baranowski wieder mit einer Portion Ironie.
So manchen anderen hätten diese Bemerkungen sicherlich in Verlegenheit gebracht. Nicht jedoch Maik. Er wirkte womöglich noch selbstsicherer, als er mit einem Lächeln fragte: »Ich hoffe, Sie haben das nicht als blöde Anmache aufgefasst?«
Ich hatte auch die Akten von Maik Broders und Björn Altmann studiert. Sie waren Studenten und neunundzwanzig beziehungsweise vierundzwanzig Jahre alt. »Keineswegs«, gab ich zurück. »Junge, Junge«, dachte ich, »ich bin doch nicht um die halbe Welt geflogen, um hier eine Affäre mit einem sechs Jahre jüngeren Mann zu beginnen!« Obwohl ich mir eingestehen musste, dass er durchaus attraktiv war, groß, athletisch, dunkelblonde Haare, braun gebrannt – man hätte ihn auch beim Surfen vor Hawaii oder Kalifornien antreffen können. Theoretisch.
Björn unterbrach das Intermezzo. »Komm, wir gehen«, sagte er zu Maik. »Wir sehen uns!«
»Ja, bis bald«, meinte Maik und sah in die Runde. Doch er hatte eindeutig mich damit gemeint.
»Bye«, sagte ich.
Als die beiden gegangen waren, ergriff Doktor Sörensen das Wort: »Sie sind noch jung ..., keine dreißig Jahre alt. Das erklärt vielleicht ...«
»Sie brauchen sie nicht zu entschuldigen«, unterbrach ich ihn. »Es ist doch nichts passiert. Sie waren eben nur überrascht, eine Frau hier zu sehen.«
»Ja ..., und es war keine unangenehme Überraschung«, murmelte Thompson.
»Genau. Und die anderen Wissenschaftler werden Sie sicherlich auch noch kennen lernen.« Baranowski gab uns Gelegenheit, unsere Erkundungstour fortzusetzen.
Thompson und ich verabschiedeten uns von den beiden Ärzten und verließen den Raum. Er zeigte mir die Küche und die Kantine, machte mich mit dem Personal jedoch nicht bekannt. »Es handelt sich überwiegend um Einheimische, die auf der anderen Seite der Insel leben. Diejenigen, die nicht hier arbeiten, betreiben Fischfang, befinden sich aber natürlich genauso unter Beobachtung. Wie Sie wissen, ist ja eine Einheit vom United States Marine Corps auf der Insel stationiert. Denen entgeht nichts.«
»Ja. Das habe ich schon vor meinem Abflug gelesen.«
Wir gingen weiter. »Nun ..., dann kommen wir jetzt zum Schluss der Tour. Da kann ich Sie noch mit Pater Enrico bekannt machen. Vor zwei Jahren kamen die Vertreter der UN auf den Gedanken, dass es sinnvoll wäre, einen kirchlichen Vertreter hier vor Ort zu haben ..., einen Gottesmann, oder wie auch immer man das nennen soll. Pater Enrico ist nach Gesprächen mit dem Vatikan ausgewählt worden. Hier ist sein Zimmer.«
Wir blieben stehen, Thompson klopfte und trat ein.
Das Zimmer war halb so groß wie das der Ärzte, wirkte jedoch größer, da es ein Eckzimmer war und insofern von zwei Seiten Tageslicht herein schien. Der Pater saß an einem dunklen Schreibtisch und erhob sich bei unserem Eintritt. Er war so alt wie ich, wie ich wusste, fünfunddreißig. »Eine ganz andere Biographie«, dachte ich.
»Pater Enrico ..., ich möchte nicht lange stören ..., ich darf Ihnen Sophia Fernández vorstellen. Sie stattet uns einen kleinen Besuch ab, um sich die Verhältnisse aus nächster Nähe anzuschauen. Ihre Eindrücke fließen in einen Bericht ein, den später der Sicherheitsrat erhält.«
Wir gaben uns die Hand.
»Guten Tag!«
»Guten Tag!«
Thompson war an der Tür stehen geblieben. »Die meisten Insassen sind Angehörige des christlichen Glaubensbekenntnisses. Daher war dieser Schritt gewissermaßen eine logische Konsequenz.«
»Ich verstehe.«
»Wie lange werden Ihre Untersuchungen denn dauern?«, fragte der Geistliche.
»Eine Woche ..., vielleicht länger.«
»Dann werden wir bestimmt noch Gelegenheit erhalten, uns auszutauschen.«
»Das denke ich auch.«
Wir abschiedeten uns von Pater Enrico und gingen in Thompsons Büro. »Jetzt werde ich Ihnen noch die Wachmannschaft vorstellen, die diese Woche Dienst hat. Einige von ihnen haben Sie bei Ihrer Ankunft vermutlich schon gesehen.«
Er betätigte einen Knopf auf seinem Schreibtisch, und eine halbe Minute später standen vier Soldaten in schwarzen Kampfanzügen im Raum.
»Meine Herren! Ich möchte Ihnen Doktor Sophia Fernández vorstellen. Sie inspiziert unser Gefängnis und arbeitet an einem Bericht für den Sicherheitsrat. Die Dauer ihres Aufenthaltes ist zunächst für eine Woche vorgesehen, kann im Bedarfsfall aber um eine weitere verlängert werden. Ich erwarte, dass Sie ihr jede Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigt!«
»Jawohl, Sir!«, tönte es wie aus einem Mund.
Der Direktor wandte sich an mich. »Sie wissen ja, wie es hier abläuft. Die Herren Smith, Kowalski, Novak und Philips haben diese Woche in diesem Bereich Dienst. Sofern Sie etwas benötigen, und ich gerade nicht erreichbar sein sollte, können Sie sich gerne an sie wenden.«
»Danke sehr.«
Ein bisschen Stolz klang in seiner Stimme mit, als er noch hinzufügte: »Die Männer sind ebenfalls seit Beginn hier ..., wir sind zusammen angekommen. Es ist eine gute Truppe, quer durch die Nationalitäten, und wir haben alle ein und dasselbe Motto.«
Ich mochte ihn fragend anblicken, denn er blickte nun seinerseits auffordernd zu den Soldaten hinüber.
Der, den er als Smith vorgestellt hatte, trat einen Schritt vor. »Ausbruch unmöglich, Flucht unmöglich.«
Thompson mochte meine Miene falsch deuten, vielleicht wollte er mich aber auch nur vollends von den Gegebenheiten überzeugen. »Smith und Kowalski werden Sie auf einem weiteren Rundgang begleiten, dann können Sie sich selbst überzeugen. Dafür sind Sie ja schließlich hier, nicht wahr?«
Ich nickte nur.
Er sah mich eindringlich an. »Aber bringen Sie mir die Männer nicht durcheinander!«
»Ich werde es versuchen«, gab ich zurück.
Smith machte eine auffordernde Handbewegung. »Bitte sehr, hier entlang!«
Der andere, Kowalski, ging voran und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Ich ging hindurch, Smith direkt hinter mir. Ich vermutete einen Amerikaner in ihm, doch hütete ich mich, ihn darauf anzusprechen. Vor meiner Abfahrt war mir klar gemacht worden, dass das Sicherheitspersonal strikte Anweisung hatte, nichts über sich und die persönlichen Verhältnisse zu erzählen, und dass ich dies respektieren möge. Die Soldaten sprachen über sich nicht einmal gegenüber den anderen. Lediglich der Direktor hatte eine namentliche Übersicht über alle, sowohl Sträflinge wie Wachpersonal.
Insgesamt waren es vier Soldaten, die der Direktor je nach den aktuellen Erfordernissen flexibel einsetzen konnte. Die beiden anderen würden jetzt wieder in den Bereitschaftsraum zurück kehren. Das Wachpersonal auf den sieben Stationen hatte seinen eigenen Rhythmus. Jede Etage war gleich aufgebaut: Außen waren die Zellen, im Innenbereich, getrennt durch einen Gang, ein Komplex, der neben dem Treppenhaus, einer Sporthalle, den Duschen und einem Fahrstuhl einen großen Raum beherbergte, in dem die jeweilige Wachmannschaft untergebracht war. Dieser Raum beinhaltete eine Kommandozentrale, in der alle Bilder der Überwachungskameras des jeweiligen Stockwerks auf entsprechend vielen Monitoren rund um die Uhr gezeigt wurden, einen Aufenthaltsraum und einen Ruheraum. Nach meinen Informationen bestand eine Wachmannschaft aus einundzwanzig Soldaten, die sich in drei Gruppen teilten – in acht-Stunden-Schichten.
Auf dem Weg nach unten referierte Kowalski: »Der Bau besteht aus einem neu entwickelten Material, einer Mischung aus Stahlbeton und Glas, Licht-durchlässig, sofern von uns gewünscht, absolut witterungsbeständig und nahezu unzerstörbar. Und das bei einer extrem geringen Dicke.«
Er war zweifelsohne Pole, sprach jedoch ein sehr gutes Englisch. Er war einen halben Kopf größer als Smith, schätzungsweise zwei Meter groß, slawischer Typus.
Wir waren inzwischen im fünften Stock angekommen.
Kowalski öffnete die Tür mit seiner Karte und hielt sie auf. »Bitte sehr! Hier können Sie sich einmal in Ruhe eine Zelle ansehen. Hier ist noch niemand.«
»Danke.«
Wir gingen zu einer Zelle, Kowalski öffnete die Tür mit seiner Karte, und wir gingen hinein. Ich hatte die Pläne schon in meinem Büro in New York studiert, und es machte jetzt vor Ort keinen überragend anderen Eindruck als in meiner Vorstellung existierte. Jede Etage des Würfels war drei Meter hoch, die Höhe der Zwischendecken betrug zwei, die unterste drei und die oberste sechseinhalb Meter. Auf einer Grundfläche von zwei mal drei Metern waren in jeder Zelle ein Bett, ein Waschbecken und eine Toilette untergebracht. Die Wände schienen tatsächlich aus einer Art Glas oder durchsichtigem Metall zu bestehen. Versuchsweise schlug ich gegen eine Wand. Es fühlte sich härter an als Beton.
»Ausbruch zwecklos.« Smith lachte. »Ohne die Karte kommen Sie hier nicht raus, höchstens mit einem Presslufthammer.«
»Okay, ich bin überzeugt.«
Ich sah nach oben.
»In der Decke befinden sich Sensoren ..., um zum Beispiel Feueralarm auszulösen ..., und um ein eventuell gerade ausbrechendes Feuer direkt löschen zu können, sind dort auch mehrere Strahler installiert, deren Kapazität hinreichend ist, um die ganze Zelle binnen einer Minute unter Wasser zu setzen. In den Decken des Gebäudes verlaufen diverse Leitungen ..., Strom, Wasser, und alles was die Technik so braucht. Und der größte Ozean der Welt liefert das Löschwasser. Ein Feueralarm ist hier allerdings noch nie vorgekommen. Aber wir sind für alle Fälle gerüstet.«
»Das glaube ich.«
»In den Decken gibt es auch Videokameras. Jede Zelle wird überwacht ...«, erklärte Kowalski, »damit ist nicht nur ein Ausbruch unmöglich, sondern es wird auch jedes ungewöhnliche Ereignis ..., wie eben ein Feuer, sofort bemerkt. Denn das Wachpersonal ist vierundzwanzig Stunden am Tag, rund um die Uhr, dabei. Bei allem, was die Gefangenen tun. Es ist eine doppelte Absicherung, elektronisch und durch Menschen.«
»Aber gehen wir doch weiter«, meinte Smith und ging zurück zum Treppenhaus. Er öffnete die Tür und ließ uns hindurch. Kowalski ging wieder voran.
»Bisher waren alle Zellen leer, die obersten drei Etagen, also Stockwerk fünf bis sieben, sind noch nicht belegt. Jetzt geht es aber los. In der vierten Etage sind fünfundfünfzig Zellen belegt, das entspricht insgesamt also dreihundertachtundachtzig Gefangenen. Das Treppenhaus ist in der Mitte des Gebäudes und von den Zellen aus nicht einsehbar. Bitte bleiben Sie dennoch hinter mir, öffnen keine Tür und treten nicht auf einen der Flure.«
»Warum?«
Smith packte mich von hinten am Arm. »Weil wir es sagen, verstanden?«
Kowalski sah ihn an, und Smith ließ meinen Arm los.
»Folgen Sie mir, bitte« sagte der Pole und ging weiter die nächste Treppe hinab. »Viele der Gefangenen sind schon seit Monaten, ja Jahren hier, und haben in dieser Zeit keine Frau gesehen. Es wäre unverantwortlich, wenn herauskommen sollte, dass sich eine Frau in diesem Gefängnis befindet ...«
»An diesem Ort ...«, murmelte ich.
»Sehr richtig. Jetzt wissen Sie, was der Direktor meinte. Es dient nicht nur Ihrer eigenen Sicherheit, sondern auch der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit.«
»Aber ein Ausbruch ist doch unmöglich ..., wie sollten ich oder die innere Sicherheit dann gefährdet sein?« Ich biss mir fast auf die Zunge, manchmal war ich einfach zu unbedacht.
Ich merkte die Folgen sofort. Smith packte wieder meinen Arm. »Wir wollen hier drin keine Aufstände erleben. Ich bin Militärpolizist und habe schon einiges schlichten müssen, Aber die Verhältnisse hier sind noch einmal ganz anderer Natur, als wenn sich zwei Typen im Suff die Birne weich kloppen. Hier sitzen Mörder und Vergewaltiger, die schlimmsten Verbrecher, für die die normalen Gefängnisse nicht ausreichend sind, da sie über die entsprechenden Mittel und Ressourcen verfügen ...«
Er brach ab und ließ meinen Arm los. Hatte er zuviel gesagt?
»In anderen Gefängnissen kann man versuchen, die Wärter zu bestechen oder zu erpressen«, setzte Kowalski die Erläuterung fort. »Das wird hier kaum funktionieren, da jeder der hier eingesetzten Soldaten weiß, wie es um die Sache steht. Hier überwacht jeder jeden, und der Direktor hat immer alles im Blick. Es sind überall Kameras angebracht, jeder Quadratzentimeter dieses Gebäudes wird überwacht, jede Zelle, jedes Treppenhaus, jeder Flur, jeder Raum.«
»Auch das Büro des Direktors?«, entfuhr es mir.
Smith lachte. So allmählich schien er sich an mein Temperament zu gewöhnen. Kowalski schmunzelte. »Ja, auch das. Der Direktor ist nicht der einzige, der alle Bilder sehen kann. Die Wachmannschaft jeder Etage hat die entsprechenden Bilder vor sich, und in der neunten Etage gibt es eine Wachmannschaft für alle sieben Etagen mit entsprechend vielen Monitoren. Die überwachen ebenfalls alles, auch den Direktor.«
»Außerdem gibt es eine Live-Schaltung rüber zur Insel. Dort sitzt ein Kommando ..., Soldaten vom United States Marine Corps, US-Marines, wenn Ihnen das etwas sagt ..., das nicht nur die ankommenden Flugzeuge, sprich unsere Gäste und so weiter, in Empfang nimmt, sondern auch überwacht, dass hier alles in Ordnung ist«, ergänzte Smith.
Ich erinnerte mich an meine Ankunft wenige Stunden zuvor. Der Flug von New York nach Los Angeles und von dort mit einem Militärflugzeug auf die Insel, von der ich per Helikopter hierher befördert wurde. Bei der Landung hatte ich einige amerikanische Soldaten gesehen, zwei hatten mir beim Gepäck geholfen und mir die Örtlichkeiten gezeigt und erläutert. Auch das Haus, in dem ich während meines Aufenthaltes untergebracht war. Allein. Es gehörte zu einem Komplex, der von den Wissenschaftlern genutzt wurde, die zu Forschungszwecken auf der Insel waren. Die beiden Soldaten hatten mir ein paar allgemeine Instruktionen mit auf den Weg gegeben und mir gesagt, wenn ich etwas benötigen würde, sollte ich das Telefon im Haus benutzen. Ich wäre sofort mit der Zentrale verbunden, und von dort würden dann die weiteren Schritte in die Wege geleitet werden. Dann hatten sie mir noch den Hubschrauberlandeplatz gezeigt und mich mit John, dem Piloten bekannt gemacht, bevor sie sich wieder in ihren Bereich der Insel zurückgezogen hatten.
»Und sollte etwas nicht in Ordnung sein, setzen die sich in Bewegung. Sie haben vier Hubschrauber, die permanent einsatzbereit sind, und sie sind darauf trainiert, ebenfalls sofort einsatzbereit zu sein«, fuhr Kowalski fort. »Im Fall der Fälle sind die in fünf Minuten hier, sie können per Funkbefehl die Tür vom Oberdeck öffnen und sind im Ernstfall in der Lage, vollausgerüstet jeden Widerstand zu brechen.«
»Mit vollausgerüstet meinen Sie, dass die Waffen haben, oder?«
»Schlaues Mädchen«, lachte Smith. »Natürlich! Das komplette Programm. Da ist jeder Widerstand zwecklos. Wenn man nicht zufällig Superman ist, hat man nur die Wahl zwischen erschossen werden und sich gefangen nehmen lassen.«
Ich wusste, dass das Wachpersonal im Gefängnis lediglich mit Gewehren mit Gummigeschossen, Elektroschockgeräten und Pistolen mit Betäubungsmunition ausgerüstet war. Jegliches Risiko war somit ausgeschlossen, dass etwa eine Wache einen Gefangenen erschoss oder sich mehrere Gefangene Zugang zu einem Waffenarsenal verschaffen konnten, mit dem sie ernsthaft in der Lage wären, größeren Schaden anzurichten.
Schließlich waren wir in der ersten Etage angelangt.
»Die, die hier sitzen, sind am längsten unsere Gäste. Seit die Einrichtung eingeweiht wurde ..., also vor etwa vier Jahren kamen die ersten. Und dann ging es zügig weiter«, sagte Smith. »Und jetzt gehen wir nach ganz unten.«
Er öffnete eine Tür mit einer anderen Karte als der bisherigen und ging voran. Über eine weitere Treppe gelangten wir in den Keller, ins Stockwerk Null.
Kowalski betätigte einen Lichtschalter.
Über die Hälfte der Grundfläche wurde durch den Technischen Bereich eingenommen. Ich hörte ein leises Summen.
»Das stammt von den Generatoren«, erklärte Kowalski, der offenbar meinen Gesichtsausdruck gedeutet hatte. »Wir sind hier komplett autark, dank der neuesten Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie und der Produktion von Frischwasser, können wir theoretisch monatelang unabhängig von der Außenwelt leben.«
»Als wären wir auf einem anderen Planeten«, fügte Smith hinzu.
»An allen Wänden des Gefängnisses sind Solarzellen angebracht, wir produzieren hier mehr Strom als wir benötigen. Dadurch kann auch die Forschungsstation betrieben werden, sowohl hier im Gebäude als auch auf der Insel.«
»Und die Abwässer?«
»Schadstoffe werden in einem recht aufwendigen Verfahren gefiltert und gelangen schließlich ins Meer, sofern sie biologisch abbaubar sind. Andere Schadstoffe werden gesammelt, dann auf der Insel zwischengelagert und einmal im Quartal von einer Frachtmaschine abgeholt. Aber die Maschine ist praktisch nie ausgelastet ..., wir produzieren äußerst wenig Schadstoffe. Das liegt auch an den eingesetzten Materialien.«
»Das ist Aufgabe der Wissenschaftler ..., und ich glaube, sie machen einen guten Job. Zu Hause habe ich jedenfalls erheblich mehr Müll produziert als hier, allein durch Verpackungsmaterial.«
»Okay ..., ich bin überzeugt. Das Geld scheint gut investiert zu sein ..., und die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern eine sinnvolle Sache.«
»Ja ..., und durch deren Arbeit hat sich auch eine Idee in die Tat umgesetzt, die wahrscheinlich einzigartig ist. Dadurch wird das Gefängnis noch ausbruchsicherer, denn die Gefangenen haben mittlerweile gar keine Lust mehr zu fliehen.«
»Inwiefern?«
Er deutete nach links. In der Mitte der freien Grundfläche war durch Glas – Panzerglas, wie ich später erfuhr – eine Art Schacht abgetrennt. »Der geht bis hinauf in die achte Etage«, erklärte Kowalski. »Damit sorgen wir dafür, dass bei den Gefangenen erst gar keine Fluchtgedanken aufkommen.«
»Mit diesem Schacht? Sperren Sie diejenigen, die fliehen wollen, da ein? Da passt doch kein Mensch rein!«
»Nein! Es dient lediglich als ..., Durchgangsstation für etwas Besonderes.«
Smith und Kowalski wechselten einen Blick, der mir nicht entging.
»Sie haben meine volle Aufmerksamkeit«, erklärte ich und sah die beiden auffordernd an.
»Zeigen wir es ihr«, meinte Kowalski.
»Das volle Programm?«, fragte Smith.
»Warum nicht? Es wird ja auch nach oben übertragen ..., ist mal wieder eine Abwechslung und gleichzeitig Mahnung ..., auch für die Neuen.«
»Okay.«
»Was wollen Sie mir zeigen?«
Er nahm einige Einstellungen an einem Tablet vor. »Passen Sie gut auf ..., sehen Sie nach unten.«
Ich sah nach unten. Der Boden war dunkel, doch das musste eine Täuschung sein, denn auf einmal wurde er durchsichtig, und ich konnte das Meer unter uns sehen. Gleichzeitig wurde es an den Wänden lebendig, einige Bildschirme wurden sichtbar. Offenbar waren Kameras an den Pfeilern im unteren Bereich montiert, denn sie lieferten ein Bild aus nächster Nähe der Wasseroberfläche.
»Die Show kann losgehen«, sagte Smith und drückte auf einen Punkt an seinem Tablet.
Zunächst geschah nichts, doch dann hörte ich ein Geräusch. Ich konnte es allerdings nicht einordnen. »Was ist das?«
»Werden Sie gleich sehen«, meinte Kowalski. »Beobachten Sie den Schacht und das Wasser!«
Ich tat, wie mir geheißen, und da kam auch schon etwas durch den Schacht von oben herunter, das hinunter ins Meer fiel. Abfälle. Küchenabfälle, wie ich auf die Schnelle sehen konnte.
Und dann begann der eigentliche Showteil: Haie!
Gebannt starrte ich abwechselnd durch den Boden nach unten und auf die Fernsehbildschirme in der Wand. Es war ein bizarres Schauspiel, was sich da, vierzig Meter unter unseren Füßen, abspielte. Mehrere Haie stritten sich um die Abfälle, die ins Meer gespült worden waren.
Kowalski lachte. Er merkte, dass ihnen der Überraschungseffekt gelungen war. »Das sind unsere Haustiere. Wir haben sie gewissermaßen dressiert und darauf trainiert, alles, was aus diesem Gebäude ins Wasser fällt, als Futter zu betrachten. Das sind zwar nur Küchenabfälle ..., aber die Fische sind nicht wählerisch.«
»Die Wissenschaftler haben hier schon zig Haiarten entdeckt ..., und natürlich auch jede Menge andere Fische, Bonitos beispielsweise, die wir ab und zu auch zu essen bekommen«, ergänzte Smith.
Das Treiben im Wasser hatte mich völlig in seinen Bann gezogen. Ich konnte meinen Blick nur schwer wieder abwenden.
»Und? Was sagen Sie?«
Ich sagte zunächst gar nichts, war sprachlos.
»Dieses Schauspiel wird jedem Gefangenen bei seiner Einlieferung gezeigt. Es wirkt natürlich umso besser, je mehr und größere Haie hier auftauchen und mitmischen. Ich habe mir sagen lassen, dass die meisten Burschen da unten Ammenhaie und Blauhaie sind, aber auch Tigerhaie tauchen hier durchaus auf ..., und manchmal sogar ein Weißer Hai. Damit wird jeder Gedanke an einen Fluchtversuch im Keim erstickt, denn etwas derart Offensichtliches akzeptieren die meisten Leute. Stillschweigend.«
»Ich glaube, ich verstehe«, sagte ich dann. »Es ist auf Psychologie gebaut. Die Gefangenen müssten zunächst eine dreieinhalb Meter hohe Mauer überwinden, ohne von den Wachtposten gestört zu werden.«
»Was noch denkbar wäre«, schmunzelte Kowalski. »Es ist schließlich ein großes Areal, auch das Oberdeck. Wenn sich drei oder vier zusammentun und schnell sind, könnten ein oder zwei die Mauer überwinden, bevor ein Wachtposten sie daran hindern könnte.«
»Okay ..., ja ..., aber dann kommt der Sprung ins Wasser. Ein Sprung über einhundert Meter ins Wasser. Kann man den überhaupt überleben?«
»Von hundert schafft es einer«, sagte Kowalski. »Aber da sprechen wir noch nicht über den Zustand im Detail. Ist er ohne Prellungen, Schürfwunden und Knochenbrüche davongekommen? Oder hat er einen Arm oder ein Bein gebrochen?«
»Aber die alles entscheidende Frage lautet: Wie lange hat er, bis der erste Hai da ist? Zehn Sekunden? Eine halbe Minute? Eine Minute? Und wie lange dauert sein Todeskampf? Wird er langsam oder ...«
»Danke, Mister Smith ..., ich habe genug Fantasie«, unterbrach ich den Erzähler. »Nur ein Wahnsinniger würde den Sprung wagen.«
»Nein. Nicht einmal ein Wahnsinniger würde ihn wagen«, widersprach Kowalski. »Denn jeder weiß, wie es hier aussieht. Die Bilder, die Sie hier sehen, werden auch in allen Etagen auf den Wänden gezeigt. Jeder Gefangene bekommt die Show frei Haus geliefert, sobald Neue ankommen. Oder auch mal zwischendurch. So wie jetzt.«
»Okay. Das ist ..., beeindruckend. Da gibt es wahrscheinlich auch kaum Streitereien, oder?«
»Kaum. In der Tat. Und wenn doch ..., dann gibt es hier das Loch.«
»Das Loch?«
»Kommen Sie!«
Wir gingen an die nördliche Seite des Würfels, und fast wäre ich gegen eine Wand aus Glas gestoßen.
»Hier gibt es Zellen, drei mal drei mal drei Meter groß. Hier landet man, wenn man die Regeln gebrochen hat oder für Ärger sorgt. Und nachts denkt man, man ist im Vorhof zur Hölle.«
»Wieso?«
»Gehen Sie hinein, wir zeigen es Ihnen.«
Etwas verunsichert sah ich die beiden an.
»Keine Angst ..., Ihnen passiert nichts!«
»Okay ...« Ich ging in eine der Zellen. Sie schlossen die Glastür hinter mir. Elektronisch. Es gab kein Schloss, keine Scharniere. Um etwas genaueres zu erkennen, war es zu dunkel in diesem Teil des Raumes.
»Und jetzt?« Ich setzte mich auf den Boden.
Statt einer Antwort hatte Smith wieder das Tablet bedient, und das Resultat erfuhr ich sofort: Der Boden bewegte sich und glitt zur Seite. Fast zu Tode erschrocken, sprang ich auf – um festzustellen, dass unter meinen Füßen ein Gitter sichtbar wurde, auf dem ich nun stand. Aber ganz plötzlich war die Lage eine andere. Die Luft, der Ton, ich konnte das Meer unter mir jetzt nicht nur sehen, sondern auch hören, riechen und schmecken.
Ein Summen verriet mir, dass der Boden wieder geschlossen wurde. Kowalski öffnete die Tür. »Da Sie ja Fantasie haben, werden Sie sich unschwer vorstellen können, dass man hier nur äußerst ungern eine ganze Nacht verbringt ...«
»Denn im Hinterkopf spielt immer der Gedanke eine Rolle, was wäre, wenn der Boden plötzlich ganz weg wäre und man ins Meer stürzen würde. In eine Meute hungriger Haie«, fügte Smith hinzu.
»Alles klar, und wieder ein bisschen Psychologie. Da haben Sie natürlich auch ein wirksames Mittel ..., bestimmt nachhaltiger als alle anderen Methoden.«
»So ist es. Mit denjenigen, die hier eine Nacht durchgemacht haben, haben wir keine Probleme mehr gehabt. Sie waren ganz brav danach.«
»Waren es denn schon viele?«
»Weniger als fünf. So etwas spricht sich schnell herum.«
Die Gefängnisbesichtigungstour war damit beendet, und wir gingen wieder nach oben, ins Büro des Direktors. Der verabschiedete mich mit einem freundlichen »Wir sehen uns morgen!« und ging in die Sporthalle. Das machte er jeden Tag, hatte er mir erklärt.
Darauf beschloss ich, dass ich für heute genug erfahren hatte und zur Insel zurück fliegen könnte. Kowalski sorgte für meinen Transport, und wenig später hatte ich mein Quartier bezogen. Ein Haus, eingerichtet für vier Personen. Ich war jedoch der einzige Bewohner. Mein Gepäck stand noch im Flur, und ich hatte mich gerade ein wenig eingerichtet, als jemand an die Tür klopfte und rief: »Miss Fernández? Hier ist Maik ..., Maik Broders! Sind Sie hier?«
Ich war gerade in meinem Schlafraum, schob den Koffer in die Ecke und ging in den Flur. Ich öffnete die Tür und ließ ihn herein.
»Ich wollte Sie nicht überfallen«, erklärte er, »aber wir treffen uns gleich zum Abendessen. Wenn Sie mögen, kommen Sie doch dazu!«
»Wer ist denn wir?«
»Oh ..., wir ..., damit meine ich das Forscherteam ..., die Wissenschaftler, die hier auf der Insel sind. Die Soldaten haben ihre eigenen Zeiten und Abläufe ..., und die Einheimischen ebenfalls. Wir sind da etwas freier. «
»Okay ..., danke. Ich komme gern.«
Ich schloss die Tür von außen und folgte ihm in eine der großen Baracken.
Hier waren bereits alle versammelt, Björn, den ich bereits kennen gelernt hatte, begrüßte mich mit einem Kopfnicken, und Maik stellte mir die anderen vor: »Hier haben wir das blaue Team von Professor Nilsson. Zu ihm gehören Doktor Emerson aus Brasilien, Harry aus Australien, Edwin aus den USA und Björn. Zum gelben Team um Professor McKinney gehören Doktor Rossi aus Italien, Stephen aus den USA, Jakob aus Kanada und Maurice aus Frankreich. Und zum roten Team von Professor Takahara gehören Doktor Silveira aus Portugal, Roberto aus Spanien, Daniel aus den USA und ich.«
»Hallo! Angenehm. Sophia Fernández, ich inspiziere das Gefängnis im Auftrag der UN«, stellte ich mich vor.
»Hallo und willkommen im größten Ozean der Welt, dem größten Lebensraum der Erde!«, riefen mir alle entgegen. Dann wurde gegessen.
Nach dem Essen fragte ich Maik: »Was hat es denn mit dem roten, gelben und blauen Team auf sich?«
»Och ..., das ist ganz wertneutral. Wir haben uns nur Farben ausgedacht ..., das ist eine Art interner Code. Bekanntermaßen kann man aus den drei Farben ja alle weiteren mischen, und wir denken, dass wir mit den beteiligten Disziplinen, die hier vertreten sind, auch das Geheimnis lösen werden ..., das Geheimnis des Lebens.«
»Ja ..., wir sind hier dem Geheimnis des Lebens auf der Spur. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Rätsel bald lösen werden. Wo sonst erlebt man so hervorragende Bedingungen?«, mischte sich Professor Nilsson ein, der uns gegenüber saß.
»Genau!«, pflichtete sein Kollege McKinney ihm bei. »Wer wollte nicht dem Geheimnis des Lebens auf die Spur kommen? Unsere Existenz geht uns alle an ..., das lässt selbst die Häftlinge nicht kalt. Einige arbeiten sehr engagiert mit, andere weniger enthusiastisch, aber dennoch konstant. So arbeiten die Gefangenen für die Wissenschaft. Sie übernehmen Recherchearbeiten in der Bibliothek, arbeiten im technischen Bereich an verschiedenen Projekten oder unterstützen uns bei unseren Untersuchungen im Labor. Natürlich stets in Anwesenheit von Soldaten. Vielleicht hofft auch der eine oder andere, dass seine Probe aus dem Meer ein bisschen Gold enthält.« Er gestattete sich ein Lächeln. »Doch wie dem auch sei, die Gefangenen sollen nicht einfach nur die Zeit hier absitzen und auf ihr Ende warten, sie wollen es auch nicht. Jedenfalls eine große Anzahl von ihnen. Andere gehen natürlich auch lieber nur in die Sporthalle.«
»Viel mehr haben die hier ja auch nicht. Sport, Bücherei und Arbeit ..., mit uns«, murmelte Maik. Doch wir hatten ihn verstanden.
»Ja ..., aber genau das gehört zum Programm ..., sie sollen Geist, Seele und Körper in einer gewissen Harmonie entwickeln. Neueste Untersuchungen haben gezeigt, dass seelisch ausgeglichene Menschen weniger Verbrechen begehen.«
»Aber die, die hier gefangen sind, werden nie wieder ein Verbrechen begehen«, wagte ich einzuwenden.
»Es sei denn, es gibt doch eine Wiedergeburt ..., an die ja immerhin nicht wenige Menschen, beispielsweise Buddhisten und Hinduisten, glauben«, sagte Björn, der neben Maik saß.
»Tja ..., unser altes Thema!«, sagte Professor Takahara. »Durch meine Geburt bin ich Angehöriger des Buddhismus, ohne etwas dafür getan zu haben. Durch meine Ausbildung, mein Studium und meine Arbeit bin ich Wissenschaftler. Ich konnte im Grunde nicht anders, bei den Gegebenheiten. Japan besteht aus vier Hauptinseln und über dreitausend kleineren Inseln und ist eines der Länder mit den meisten Erdbeben. Es gibt über zweihundert Vulkane, von denen vierzig noch aktiv sind. Es ist also nicht immer so einfach, ruhig und besonnen zu sein ..., oder zu leben. Und die Lebensumstände werfen Fragen auf, insbesondere die geologischen. Aber auch die paläo-anthropologischen: Also, was geschieht mit einem Organismus, wenn er stirbt?«
»Er zerfällt ..., löst sich in seine Bestandteile auf ..., zerstiebt in seine Atome. Und letzten Endes bauen sich daraus wieder neue Moleküle und Zellen auf. Wir alle, die ganze Erde, das ganze Universum, alles besteht aus Atomen«, meinte McKinney.
»Oder aus Protonen, Elektronen und Neutronen, mit denen man so hervorragende Bomben bauen kann«, meinte der Japaner.
»Und die wiederum aus noch kleineren Elementarteilchen, die nur hypothetisch im Labor nachgewiesen werden können. Aber die grundlegende Frage ist doch, was geschieht mit dem menschlichen Geist ..., und was mit der Seele, wenn der Mensch tot ist? Gibt es eine Art Weiterleben nach dem Tod?«, fragte Harry.
Völlig unverhofft war ich da in eine wissenschaftliche Debatte hinein geraten. Ich fühlte mich etwas unwohl. Das war dem wissenschaftlichen Leiter, Professor Nilsson, nicht entgangen. Er erhob sich und trat zu mir. »Ich mache einen kleinen Spaziergang. Wollen Sie mich ein Stück begleiten?«
Ich willigte sofort ein. »Gern.«
Er schlug den Weg zum Ufer ein, von dem aus man das Gefängnis sehen konnte. Den ganzen Weg über blieb er still, und auch ich hatte nicht das Verlangen, die Ruhe, die bereits über der Insel lag, zu stören. Am Ufer angekommen, blickten wir eine Weile auf das Meer hinaus. Das Gefängnis bot einen seltsamen Anblick dar, die ganze Szene wirkte surreal. »Wie aus einer anderen Welt«, dachte ich.
Ich blickte zu den Sternen empor, dann wieder auf das Meer. Nilsson war meinem Blick gefolgt. »Ein Mensch besteht zu über drei Vierteln aus Wasser. Auch die Oberfläche der Erde besteht zu rund drei Vierteln aus Wasser ..., eigentlich müsste der Planet nicht Erde heißen, sondern ...«
»Wasser!«
»Sehr richtig. Wasser ist die Quelle des Lebens. Es befindet sich in unseren Zellen ..., es hält uns am Leben ..., wir verlieren täglich Wasser und nehmen ebenso wieder welches zu uns. Wenn Sie keines trinken, werden Sie müde, unkonzentriert, die Muskeln werden nicht mehr mit den notwendigen Nährstoffen versorgt, das Gehirn auch nicht, sie bekommen Kopfschmerzen und schließlich ...«
»Exitus«, sagte ich leise.
»Richtig. Ohne Essen, ohne feste Nahrung, kann ein Mensch längere Zeit überleben ..., mehrere Wochen. Ohne Wasser maximal vier Tage.«
»Vier Tage«, wiederholte ich.
Wieder blieb es eine Weile still zwischen uns, keiner sprach ein Wort, wir lauschten dem Meeresrauschen.
Während wir wieder auf das Meer hinausblickten, suchte ich nach einem Einstieg für ein weiteres Gespräch. Ich wusste, dass Nilsson Evolutionsbiologe war und im Laufe seines Lebens viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten hatte. Und dass die Anzahl der Spötter und Neider groß, die seiner Bewunderer aber noch größer war. Er hatte in über zwölf Ländern gewirkt, und als er gefragt worden war, ob er die Leitung dieser Forschungsabteilung übernehmen wollte, hatte er nach nur einem Tag Bedenkzeit zugestimmt. »Warum haben Sie damals diesen Job angenommen, ..., vor vier Jahren?«
Er sah mich nachdenklich an. Nach einer Weile antwortete er: »Ich wollte schon als Kind Wissenschaftler werden. Damals wusste ich natürlich noch nicht, was das bedeutet. Aber ich wollte den Dingen auf den Grund gehen, und ich habe als Teenager unheimlich viel gelesen. Dabei war ein Buch, das von der Erforschung der Weltmeere handelte, die bereits Ende des Neunzehnten Jahrhunderts begann, als britische Wissenschaftler in den Siebziger Jahren mit einem umgebauten Kriegsschiff, der Challenger, dreieinhalb Jahre lang durch alle drei Ozeane fuhren und viele Proben aus diesem größten aller Lebensräume in ihrem Labor untersuchen konnten. Zu den Ergebnissen zählten die Messung der Wassertemperatur in Abhängigkeit von der Wassertiefe sowie auch direkte Wasserproben. Dabei konnten sie nachweisen, dass auch in der Tiefsee Leben existiert ..., sie fanden insgesamt über viertausend Arten von Lebewesen! Das hat mich unheimlich fasziniert, und ich glaube, das war der Grund für meinen Berufswunsch, den ich später dann auch in die Tat umgesetzt habe. Biogeochemische Prozesse, marine Geosysteme und hydrothermale Systeme sind meine Welt. Ich habe in den vergangenen fünfunddreißig Jahren in vielen Ländern auf allen fünf Kontinenten gearbeitet und geforscht. Dabei habe ich Menschen kennen gelernt, denen ich zutiefst verbunden bin, große Geister, wenn man so will. Seit einigen Jahren bin ich mir sicher, dass das Leben in der Tiefsee entstanden ist. Und so konnte ich nicht anders als dem Ruf hierher zu folgen ..., es war wie meine Bestimmung ..., Schicksal.«
»Die Meinung, dass das Leben im Meer entstanden ist, ist recht populär und wird auch von vielen anderen Wissenschaftlern vertreten. Ich habe während meines Studiums davon gehört, und das ist bereits zehn Jahre her.«
»So alt sind Sie doch noch gar nicht.«
»Danke für das Kompliment.«
Ich sah ihn an. Er lächelte. Doch dann kam er wieder auf das Thema, sein Thema zu sprechen. Ich hatte offenbar den richtigen Einstieg gefunden.
»Es gibt Prozesse in der chemischen Industrie, die, wie wir vermuten, auch in uralten Zeiten auf der Erde stattgefunden haben ..., und zwar in der Tiefsee. In Tiefseeschloten. Dort können organische Moleküle aus anorganischen Stoffen ..., den einfachsten Bausteinen der Materie, wenn Sie so wollen ..., erzeugt werden. Wir sprechen dabei von einer hydrothermalen organischen Synthese ..., Minerale lösen sich bei entsprechend hohem Druck in heißem Wasser auf, und die freigesetzten Atome können neue Bindungen eingehen.«
»Klingt ja fast wie eine Partnerschaft.«
»Nun ja ..., die Evolution ..., das Leben, hat schließlich irgendwie begonnen, nicht?«
»Und Sie meinen, es hat in der Tiefsee begonnen?«
»Ja, im Meer ..., im Ozean, waren schon immer die Elemente vorhanden, die man brauchte. Neben Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff auch Stickstoff, Sulfide und Phosphate sowie einige Metalle, zum Beispiel Eisen, Nickel oder Zink. Und alle diese Stoffe gibt es reichlich in der Nähe von hydrothermalen Quellen. Dort herrschen ganz andere Bedingungen, die wir heutzutage im Labor simulieren können. Wie gesagt, allein schon der Wasserdruck ist enorm. Und die Welt dort unten hat für das Leben noch einen entscheidenden Vorteil: Es ist in gewisser Weise geschützt.«
»Geschützt? Wovor?«
»Nun ja ..., die junge Erde war nicht gerade ein lebensfreundlicher Ort. Es gab bedeutende Wetterphänomene, Stürme, Überschwemmungen, Feuersbrünste, Meteoriteneinschläge. Die Sonne war zeitweise von Wolken aus Asche und Staub verdeckt.«
»Klingt wie im Science-Fiction-Film. Endzeit.«
»Durchaus. Aber es ist die Vergangenheit. An der Erdoberfläche zu leben wäre damals kein Vergnügen gewesen.«
»Geschweige denn ein Ort, damit das Leben entstehen und sich erhalten konnte.«
»Korrekt. In der Tiefsee waren alle beteiligten Elemente, Komponenten in Sicherheit. Gewissermaßen gut behütet ..., oder bewacht.«
»Klingt wie unser Gefängnis!«, lachte ich.
»Ist aber gar nicht so abwegig. Denn der Mensch ist schließlich das höchstentwickelte Lebewesen auf diesem Planeten.«
»Und wo entstanden dann schließlich die ersten Menschen? Nicht in der Tiefsee, oder?«
Er sah mir an, das ich scherzte. »Hm ..., ich höre da einen leicht ironischen Unterton.«
»Nun ja, ich habe zwar Fantasie ..., aber mir solche Vorgänge über einen Zeitraum von Millionen von Jahren vorzustellen, übersteigt meinen Horizont.«
»Darum forschen wir ja. Darum wird überhaupt geforscht. Damit wir es besser verstehen ..., und vielleicht einmal tatsächlich einen Beweis finden.«
»Welche Beweise gibt es denn bisher?«
»Alle bisher gefundenen wirklich alten Überreste von Hominiden wurden in Afrika entdeckt. Die ältesten sind bis zu sieben Millionen Jahre alt und unsere Spezies ungefähr zweieinhalb Millionen Jahre. Allerdings waren das eher noch Affen als Menschen. Sie hatten noch nicht ein so hochentwickeltes Gehirn ..., von anderen Dingen einmal abgesehen. Aber im Laufe der Evolution hat sich das dann zu der heutigen Beschaffenheit entwickelt.«
»Hm.«
»Was meinen Sie?«
»Nichts. Ich überlege nur.«
»Tja ..., das ist etwas, was ich schon mein ganzes Leben lang tue. Und jetzt bin ich hier.«
Er schien etwas schwermütig zu werden. Ich störte ihn nicht in seinen Betrachtungen.
»Wollen wir wieder zurück gehen? Es ist ja auch schon spät geworden«, schlug er nach einer Weile vor.
»Oh ja ..., auf jeden Fall!«
Wir gingen schweigend zurück zu der Baracke.
Dort angekommen hörten wir, dass die Wissenschaftler noch immer in der Debatte begriffen waren. Soeben sprach Doktor Emerson: »Ohne das Meer wäre das alles Nichts! Die tiefsten Gräben, die höchsten Berge, finden sich in den Ozeanen. Und der größte ..., oder tiefste ..., Tiefseegraben der Welt ist der Marianengraben ..., mit über elftausend Metern. Und der wiederum liegt im größten Ozean der Welt, dem Pazifik. Er ist halb so groß wie alle Ozeane zusammen, größer als alle Landgebiete der Erde ..., womit er über ein Drittel der Erdoberfläche bedeckt ..., und im Durchschnitt vier Kilometer tief. Er beherbergt zahlreiche aktive Vulkane ..., vielleicht ist Ihnen der Feuerring des Pazifiks ein Begriff?«
»Ja ..., da habe ich schon von gehört«, antwortete Björn. Offenbar gab es hier eine Weiterbildung zu vorgerückter Stunde.
»Kein Wunder, ohne Vulkane gäbe es Hawaii nicht. Man stelle sich vor ..., kein Surfen, kein Hula-Hula ...,«, fiel Maik ein.
»Hee, es ist wieder eine Dame anwesend ..., benimm dich!«, hielt Björn dagegen.
Bevor sich Unmut breit machen konnte, erläuterte Professor McKinney: »Insgesamt gibt es drei Ozeane, den Atlantischen, den Indischen und den Pazifischen, mit einem Wasservolumen von eins Komma vier Milliarden Kubikkilometern.«
»Das braucht eine Weile zum Trockenlegen«, scherzte ich.
»Ha ha ..., es kommt ja eher etwas dazu«, lachte Nilsson. »Die Pole schmelzen seit dem Zwanzigsten Jahrhundert beständig, der Himalaya und andere Gebirge ebenfalls. Der Wasserspiegel steigt. Denken Sie nur an das Gefängnis ..., also an dessen Untergrund. Das war vor einer Generation noch eine bewohnte Insel mittlerer Größe.«
»Wie arbeiten Sie denn im Untergrund?«, fragte ich. Es sollte wieder ein Scherz sein, doch wurde meine Frage ernsthaft aufgefasst.
»Wir nutzen Hai-Käfige, sonst könnten wir unter Wasser oder im Wasser gar nicht arbeiten«, erklärte Doktor Rossi. »Haie sind zwar prinzipiell Einzelgänger ..., da jagt jeder für sich allein ..., aber wo einer ist, ist der nächste meist nicht weit entfernt.«
»Klingt ziemlich egoistisch.«
»Ha ha ..., ja so ist das im Tierreich. Die sind nicht so gestrickt wie wir Menschen!«
»Jedenfalls nicht alle. Es gibt solche und solche Tiere. Aber da sie alle Bewohner dieses Ozeans sind, müssen wir entweder mit Haikäfigen arbeiten ..., oder unser Goldstück einsetzen ..., ein Mini-Tauch-U-Boot für zwei Personen. Theoretisch könnten wir damit in den Marianengraben fahren ..., und zwar an den tiefsten Punkt des Ozeans. Aber da das Boot noch in der Erprobungsphase ist, belassen wir es vorerst bei tausend Metern. Das ist auch schon eine deutliche Belastung«, ergänzte McKinney.
»Denn der Wasserdruck steigt mit zunehmender Tiefe, gleichzeitig sinkt die Temperatur. Dennoch gibt es eine beispiellose Vielzahl von Lebewesen dort unten.« Jakob schien tief beeindruckt.
»Zum Beispiel Kraken ..., die sich nicht nur bei Kapitän Nemo, sondern in allen Seemannsgeschichten finden«, fügte Maurice hinzu. Er wollte wohl noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte zum besten geben.
»Na danke, da werde ich bestimmt gut schlafen heute«, scherzte ich.
»Sehr gern«, gab der Franzose lächelnd zurück.
»Ist halb so wild ..., wir schmecken nicht besonders ..., und als natürlicher Feind werden wir auch nicht wahrgenommen. Dafür sind wir zu klein. Man muss nur aufpassen, dass es zu keinem Unfall kommt ..., dass meinetwegen ein Pottwal den Weg kreuzt oder so«, wiegelte McKinney ab.
»Gilt da nicht rechts vor links?«
Diesmal kam mein Witz wieder an, es gab Gelächter in der Runde.
Mit belustigter Miene sagte Maurice daraufhin: »Verkehrsregeln gibt es da unten keine. Pottwale tauchen fast anderthalb Stunden und bis zu dreitausend Meter tief. Doch die sind nicht das Problem, auch nicht der Druck, die Dunkelheit oder die Temperatur. Das kriegen wir alles bewältigt mit unserem Tauchboot ..., es ist extra für solche Zwecke gebaut.«
Ich mochte etwas ratlos wirken, was kein Wunder war, hatte ich mich mit Tauchbooten doch noch nie beschäftigt, So sah sich Professor McKinney offenbar genötigt, ins Detail zu gehen: »Wenn wir von der Tiefsee sprechen, dann meinen wir Wasserschichten, die für normale Taucher nicht zu erreichen sind. Vierzig Meter sind beispielsweise für Sporttaucher kein Problem, und bis zu einer Tiefe von fünfhundert Metern können Menschen in Druckanzügen gelangen. Meeresschildkröten erreichen die dreifache Tiefe, anderthalb Kilometer, das ist für Menschen nicht mehr leistbar. Und Pottwale erreichen noch einmal das Doppelte, das ist schon sehr beachtlich. Die Titanic, die 1912 im Nordatlantik gesunken ist, liegt übrigens in dreitausendachthundert Metern Tiefe. Nur, damit Sie mal einen Vergleich haben. Unser Tauchboot ..., wir müssten korrekterweise eigentlich Tiefsee-U-Boot sagen ..., unterscheidet sich nun wiederum ganz wesentlich von den anderen, normalen U-Booten, wie sie das Militär verwendet. Die können Tiefen von sechshundert bis tausend Metern erreichen, manche auch ein bisschen mehr. Doch bemannte Tiefsee-U-Boote können bis zu sechstausend Meter und tiefer tauchen, und zahlreiche Nationen verfügen mittlerweile über entsprechende Boote. Frankreich, Japan, China und natürlich Russland und die USA beispielsweise. Der tiefste Punkt liegt im Marianengraben, rund elf Kilometer unter der Wasseroberfläche. Bisher sind nur wenige Menschen so tief getaucht, die ersten waren Jacques Piccard und Don Walsh 1960 mit ihrem Tauchboot “Trieste”.«
»Okay ...«
»Unser Tauchboot ist sieben Meter lang, drei Meter breit und wiegt voll ausgerüstet zwölf Tonnen. Damit können wir drei Tage unter Wasser bleiben. Die Fenster bestehen aus Acryglas und sind extra für derartige Einsätze konzipiert. Mit den entsprechenden Kameras und Scheinwerfern können wir auch unter Wasser sehen.«
»Ja ..., die Zeit braucht ihr auch, bei dem Schneckentempo«, lästerte Roberto.
»Fußgängertempo wolltest du wohl sagen«, gab Maurice zurück und grinste dabei. »Außerdem soll man nichts übereilen ..., schau dir die Wale an! Die haben die Ruhe weg.«
»Denken Sie sich nichts dabei ..., die beiden meinen es nicht so. Es ist nur Spaß«, erklärte McKinney.
»Ach so! Na, auf jeden Fall danke ich für die Fortbildung! Aber wo liegt denn nun eigentlich das Problem für das Tauchboot, wenn weder Druck, noch Temperatur, Licht oder Pottwale eine Gefahr darstellen?«
Maurice sah mich mit einem spitzbübischen Grinsen an. »Es ist schlicht die Tatsache, dass der Pazifik so riesig ist. Aber was sage ich? Wollen Sie mal mitfahren?«
Ich hatte etwas Derartiges kommen sehen und antwortete prompt: »Gern. Wann?«
Ich sah nur verblüffte Gesichter und musste laut lachen. Genau diese Reaktion hatte ich erwartet. Und natürlich auch provoziert.
McKinney fing sich als Erster. »In drei Tagen werde ich wahrscheinlich eine Testfahrt um die Insel herum machen, und am Wochenende steht eine größere Tour auf dem Plan. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen ..., und sich mal ein anderes Reich ansehen.«
»Okay ..., vielen Dank. Wenn mein Zeitplan das hergibt, bin ich dabei!«
»Sehr gern. So richtig interessant wird es eigentlich erst ab einer Wassertiefe von zehn oder zwanzig Metern ..., bis zu zweihundert Metern. Das ist das Revier von den bekanntesten Meeresbewohnern ..., Walen und Delphinen, Seehunden, Robben, und natürlich zahlreichen Fischschwärmen. Und von Haien. Das sind ganz elegante Burschen. Sie haben doch durch unsere Erzählungen keine Angst bekommen, oder?«
»Angst? Vor Haien? Nicht, solange irgend etwas Festes zwischen uns ist.«
Die Männer lachten. »Keine Sorge, das Boot ist bissfest. «
Maik prostete mir zu und lächelte. Ich hob mein Glas und prostete zurück. »Auf die Abenteuerfahrt mit Kapitän Nemo ...«, rief er.
McKinney protestierte. »Ich habe weder so einen Bart, noch bin ich so alt.«
Diesmal konterte Maik nicht, sondern sah mich mit einem Augenzwinkern an. »Flirtet er mit mir? Hier? Vor allen Leuten?«
Während ich noch überlegte, sah auch Maurice mich mit einem eigenartigen Gesichtsausdruck an. »Finde ich gut, dass Sie mitfahren wollen. Das ist wirklich sehenswert. Mal sehen, wie es Ihnen gefällt. Pottwale sind schlicht Giganten und die größten Raubtiere der Welt. Sie sind bis zu zwanzig Meter lang, können bis zu vierzig Tonnen wiegen und haben keine natürlichen Feinde ..., abgesehen vielleicht von Riesenkalmaren. Die werden bis zu zweiundzwanzig Meter lang und sind die größten und höchstentwickelten wirbellosen Tiere der Welt.«
Es schien, als ob ihm meine Entscheidung Respekt eingeflößt hätte. Gleichzeitig hatte allerdings auch er einen Blick in den Augen, der mir sagte, dass er wohl sehr gerne eine Abenteuerfahrt mit mir unternehmen würde. Es war fast so etwas wie eine Konkurrenzsituation zwischen ihm und Maik entstanden. In der letzten halben Stunde hatte ich bemerkt, wie sich das Verhalten auch bei einigen anderen geändert hatte, und ich musste wiederum an die Worte des Direktors denken: »Das ist kein Ort für eine Frau!«
»Bevor wir schlafen gehen, hätte ich noch eine Frage«, meldete sich da Stephen zu Wort. Er zählte zu jenen, die mich bisher nicht mit einem gewissen Blick bedacht hatten.
»Nur zu.«
»Sie ..., Sie sind ja eine Frau!«
»Gut beobachtet.«
»Ja, für einen Biologen nicht schlecht«, spottete Maurice.
»Das hat er im ersten Semester gelernt«, lästerte Maik.
»Ha ha, sehr witzig. Was ich sagen wollte, ist, dass meine Freundin sich auch beworben hatte. Sie hatte sogar bessere Noten als ich. Aber man hat sie nicht genommen, weil sie eine Frau ist.«
»Aha.«
»Warum macht man bei Ihnen eine Ausnahme?«
»Ich weiß nicht ..., vielleicht weil ich nur eine oder zwei Wochen hier bleibe. Und ich bekomme von den Gefangenen auch niemanden direkt zu sehen. Und von der Besatzung eigentlich auch nicht unbedingt. Nur so weit es eben unumgänglich ist.«
»Hm ..., und weil Sie von der UNO sind wahrscheinlich.«
»Ja, auch das könnte ein Grund sein.«
»Nun ja ..., es ist ja auch ziemlich gefährlich hier. Im Wasser die Haie, im Gefängnis die Gefangenen ..., Mörder und Vergewaltiger und was weiß ich ...«
»Ja ..., was weißt du schon?«, rief Daniel.
»Es ist eigentlich kein Ort für eine Frau, wollen Sie damit sagen, oder?«
»Genau! Aber wir werden schon auf Sie aufpassen!«
»Genau! Das werden wir!«, rief Maik und erhob sich. »Soll ich Sie nach Hause bringen?«
Ich erhob mich ebenfalls und erwiderte mit einem leichten Lächeln: »Danke sehr, aber ich finde den Weg allein!«
Ich spürte die Blicke der Männer auf mir. »Das ist kein Ort für eine Frau!«
»Okay ..., dann gute Nacht!«, sagte Maik.
»Gute Nacht!«, riefen die anderen im Chor.
»Gute Nacht!«, sagte ich.