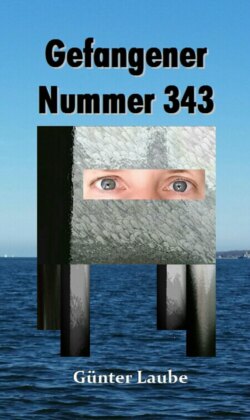Читать книгу Gefangener Nummer 343 - Günter Laube - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Rückblick
ОглавлениеIch erwachte, weil jemand meinen Namen rief.
»Maryam! Wach auf! Du träumst!«
Aus halb geöffneten Augen sah ich Sina, und sofort wusste ich, dass ich geträumt hatte. Sie sah mich mit einem sehr ernsten Blick an, den ich an ihr noch nicht bemerkt hatte. Wir kannten uns seit etwas mehr als einem Jahr und hatten uns bei der Wohnungssuche über ein Internetportal für WG-Mitbewohner gefunden.
Wir studierten beide an der FU Berlin.
»An diesem Ort ...«, murmelte ich noch, doch dann war ich hellwach.
»Alles klar?«, fragte Sina.
»Ja ..., doch ..., ich muss wohl geträumt haben. Habe ich dich geweckt?«
»Nur ein bisschen. Aber ich wollte sowieso gerade aufstehen. Es ist ja immerhin schon vier Uhr!«
»Ups, tschuldigung!«
»Kein Problem! Aber ich glaube, auch deine Haie hätten nichts dagegen, wenn wir noch zwei oder drei Stündchen schlafen würden.«
»Meine Haie?«
»Ja ..., du hast von Haien geträumt. Vielleicht ja auch von Großstadthaien«, kicherte sie.
»Oh ja ..., ich erinnere mich ..., das ist schon verrückt. Keine Ahnung, was das soll.«
»Egal ..., vergiss es, und schlaf weiter! Aber nicht zu lange ..., heute ist Dienstag, und wir müssen um neun an der Uni sein!«
»Okay ..., entschuldige nochmal.«
»Kein Problem. Auf in die zweite Runde!«
Sina tapste verschlafen aus meinem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich hörte sie in ihr Zimmer zurück gehen. Es wurde ruhig im Haus, dafür hatte ich jetzt alle Einzelheiten des Traums vor meinem inneren Auge und überlegte, ob ich einzelne Personen oder Orte oder Gegebenheiten wiedererkannte. Doch als ich nach einer Weile auf meinen Wecker sah, stellte ich fest, dass ich jetzt eine ganze Stunde lang überlegt und nichts gefunden hatte! Ich wälzte mich von links nach rechts und drehte mich vom Bauch auf den Rücken und wieder zurück. Doch es war zwecklos. Ich konnte nicht mehr einschlafen.
»Verflixt nochmal! Was war das für ein Traum?«
Ich stand auf, zog die Jalousie ein Stück hoch und sah aus dem Fenster.
Unsere Wohnung lag im Südwesten Berlins, in Zehlendorf, im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Wir konnten mit dem Fahrrad zur Uni fahren, genauso wie zum Wannsee, wo ich im Sommer und speziell in den Semesterferien mindestens einmal pro Woche war.
Obwohl es erst halb sechs an diesem Dienstag Morgen war, herrschte bereits viel Verkehr. Ich hörte das Rauschen von der Autobahn und der Potsdamer Chaussee. Auch in unserer relativ kleinen Nebenstraße war bereits einiges los. Einige kamen von der Arbeit, andere gingen zur Arbeit.
Neuesten Prognosen zufolge wird Berlin in zehn Jahren vier Millionen Einwohner haben. Die Stadt wächst. Nicht nur durch die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Ost- und Südosteuropa, sondern auch durch die anhaltende Landflucht der hiesigen Bevölkerung. Berlin ist die deutsche Metropole schlechthin, eine Weltstadt. Als ich in der siebten Klasse war, hatten wir einen Schulausflug zu der ehemaligen innerdeutschen Grenze unternommen. Die Zeit des Kalten Krieges und die Ereignisse des Jahres 1989 sind wohl mit keiner anderen Stadt so verbunden wie Berlin, das nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt wurde. In einen sowjetischen, einen französischen, einen britischen und einen amerikanischen, oder später auch vereinfacht ausgedrückt in eine westliche und eine östliche Zone. Dazwischen war die Mauer, die achtundzwanzig Jahre lang ein Volk, Familien und Freunde trennte. Zahlreiche Dokumente sind bis zum heutigen Tag erhalten geblieben, so dass wir uns ein mehr als lebendiges Bild machen konnten. Es war wie Geschichte zum Anfassen. Damals, als Teenager, hatte ich es nicht verstanden, warum das, was im Zwanzigsten Jahrhundert in Deutschland geschehen ist, nicht auch in meinem Land oder irgendwo anders auf der Welt geschehen konnte – oder kann. Ein im Prinzip friedliches Miteinander, ein gemeinsames GrenzenÜberwinden. Auch heute noch verstehe ich nicht, wie es damals gelingen konnte, die Bevölkerung von zwei Ländern, denen man über Jahrzehnte eingetrichtert hatte, dass die anderen die Bösen sind, in einem vollkommen unblutigen Akt zu vereinen.
Ich ließ die Jalousie wieder nach unten gleiten. Jetzt war ich hellwach. Da es aber noch entschieden zu früh war um aufzustehen, griff ich zu meinem Handy und schaltete es ein. Ich hatte zwölf neue E-Mails und drei neue Nachrichten, eine von meinem Vater, eine von meiner Schwester und eine von Tim. Ich hatte ihn am Samstag auf einer Party kennen gelernt, wir hatten uns gut unterhalten und zum Schluss die Handy-Nummern ausgetauscht. »Guten Morgen, schon ausgeschlafen?«, lautete seine Frage, die ich umgehend mit einem »Schon lange wach, aber von ausgeschlafen kann keine Rede sein« beantwortete.
Meine Schwester Jasmin schrieb mir, dass sie im Januar nach Äthiopien und von dort wohl nach Somalia gehen würde, zunächst seien drei Monate geplant.
Mein Vater schrieb mir, dass er für die Feier des fünfzigsten Geburtstags meiner Mutter im nächsten Monat eine Idee hätte, die er mit mir und den anderen einmal besprechen wollte. Natürlich ohne meine Mutter, da es eine Überraschung werden sollte. Er schlug vor, dass wir nächste Woche Mittwoch abends in seine Praxis kommen sollten.
Mein Vater ist Arzt, nach unserer Ankunft in Berlin konnte er seine Arbeit aber nicht sofort aufnehmen, da wir auf der Flucht alle Papiere verloren hatten. Wir hatten nur das, was wir auf dem Leib trugen, und waren froh, als wir die lange Reise bis in die Türkei geschafft hatten. Dort mussten wir drei Monate in einem Flüchtlingscamp ausharren, bis wir zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen weiter durften. Nach Griechenland, und von dort über Mazedonien, Serbien und Montenegro, Ungarn und Österreich bis nach Deutschland. Zu Fuß und mit dem Zug, doch an Einzelheiten habe ich keine Erinnerungen mehr. Insgesamt waren wir sechs Monate unterwegs. Wir landeten schließlich in Berlin und mussten wiederum lange Zeit warten. Niemand wusste, wo wir unsere Flucht beenden würden. Doch das Schicksal meinte es gut mit uns. Da mein Vater in Deutschland studiert hatte, noch immer sehr gut Deutsch sprach und während unserer Wartezeit Kontakt zu einem alten Freund aufnehmen konnte, der inzwischen als Arzt in Berlin lebte und arbeitete, konnten wir hier bleiben. Wir bekamen eine Wohnung zugewiesen, in Kreuzberg. Dort leben meine Eltern noch heute, sie fühlen sich dort zu Hause.
Nach über einem halben Jahr mit sehr vielen Behördengängen und noch mehr Bürokratismus - Verwaltungsirrsinn, wie meine Mutter einmal gesagt hatte – konnte mein Vater wieder als Arzt praktizieren. Er konnte in der Praxis von seinem Freund anfangen, und mittlerweile hat er die Praxis übernommen, da der Freund mit seiner Frau nach Amerika gezogen ist.
Meine Mutter ist zuerst zu Hause geblieben und hat sich um uns Kinder gekümmert. Um meine älteren Brüder Safi und Aaron, meine ältere Schwester Jasmin und mich.
Safi war bereits sechzehn, als wir aus unserem Heimatland flohen, und nach einem Schuljahr machte er hier die Mittlere Reife und anschließend eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker. Er war sehr zielstrebig und wusste schon immer, was er wollte. Er wohnte seit kurzem mit seiner Freundin zusammen, in Wilmersdorf.
Aaron hingegen besuchte wie später auch wir Mädchen ein Gymnasium und war nach dem Abitur zunächst unsicher, was er machen wollte. Nach einigem Zögern und Überlegen hat er sich dann dazu entschlossen, Journalist zu werden. Nach den Ereignissen im Flüchtlingscamp, die er als Dreizehnjähriger erlebt hatte, war er der Meinung, dass die Welt, die Menschen, immer die Wahrheit erfahren müssen. Auch zukünftig. Dabei war einer seiner Grundsätze, dass er sich nie als Sprachrohr missbrauchen lassen, sondern immer gut recherchieren wollte, bevor er etwas berichtete. Nach Stationen in Leipzig, Hamburg und München war er letztes Jahr nach Köln gegangen und hatte dort sein Journalistik-Studium abgeschlossen. Er hat sich auf Online-Journalismus spezialisiert, und er ist gut in seinem Job. Das Internet ist seine Welt, da kennt er sich aus. Selbst erfahrene Journalisten und Redakteure staunen bisweilen über seine Recherche-Ergebnisse. Inzwischen ist Aaron siebenundzwanzig, wohnt in Charlottenburg und arbeitet bei einer großen Zeitung in der Online-Redaktion.
Meine Schwester Jasmin ist drei Jahre älter als ich und war schon immer der emotionale, einfühlsame Typ. Sie wollte seit unserem Aufenthalt im Flüchtlingscamp in der Türkei Krankenschwester werden, da sie sich dort mit einer angefreundet hatte und später einmal alles machen wollte, was sie auch machte. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin, parallel studierte sie Gesundheits- und Pflegemanagement und bewarb sich anschließend beim UN-Flüchtlingshilfswerk. Sie wurde sofort genommen, nicht nur wegen des immensen Bedarfs an Fachkräften im Pflegebereich, sondern auch wegen ihrer Sprachkenntnisse. Wir alle waren diesbezüglich sehr erfahren, da wir sowohl Arabisch und Türkisch wie auch Englisch und Deutsch sprachen. Zudem hatten wir Grundkenntnisse in einigen anderen Sprachen wie Französisch und Kurdisch. Der lange Aufenthalt in dem Flüchtlingscamp sowie unser neues Zuhause in Berlin und speziell in Kreuzberg waren in dieser Hinsicht sehr lehrreich, und wir haben als Kinder alles aufgesogen, was uns begegnete. Manchmal wenn wir mittags nach Hause kamen und unsere Mutter mit den neuesten sprachlichen Errungenschaften konfrontierten, hatte sie gescherzt, dass wir später einmal eine Weltreise machen und uns mit jedem verständigen könnten, der uns dabei begegnete. Jasmin wohnt noch immer in Kreuzberg, sie hat ein Zimmer in einer WG mit zwei Frauen, die auch Krankenschwestern sind. Allerdings war sie im Laufe des letzten Jahres viel unterwegs, drei Monate in der Türkei, im Irak, in Syrien und Ägypten, und drei Monate in Kenia und im Sudan.
Als ich sechzehn war, hatte meine Mutter angefangen, halbtags zu arbeiten, und als ich letztes Jahr als letztes Kind der Familie in meine eigene Wohnung zog, wechselte sie die Stelle und arbeitet jetzt ganztags.
Ich schrieb meinem Vater zurück, dass ich nächsten Mittwoch kommen würde und auf die Überraschung schon sehr gespannt sei. Wir hatten schon immer ein sehr enges familiäres Verhältnis, und auch wenn wir jetzt räumlich getrennt voneinander lebten, so waren wir doch alle in Berlin, und es fanden sich zu derartigen Anlässen alle wieder zu Hause ein. Rückblickend betrachtet hatte die gemeinsame Flucht uns noch stärker gemacht, und ich erinnerte mich an ein Gespräch mit meinem Vater, in dem er mir erklärt hatte, dass ich das vierte Kind gewesen sei, und dass mit meiner Geburt in gewisser Weise die Zukunft oder die Gegenwart der Familie begonnen hatte. Denn einerseits hielten er und meine Mutter es für sinnvoll, dass ihre Kinder nicht in einem Traumschloss aufwuchsen, sondern sich durchaus mit der Realität auseinandersetzten, andererseits zählte auch die Sicherheit. Die beste Realität nutzt nichts, wenn man tot ist. Insofern hatten meine Eltern sich schließlich dazu entschlossen, das Land zu verlassen. Da war ich sieben Jahre alt. Mein Vater hat als Arzt schlimme Dinge gesehen, und eine Zeitlang war er sehr ruhig und zurückgezogen. Er hielt sich von mir und überhaupt von uns Kindern fern, wie ich fand. Wie ich später von meiner Mutter erfuhr, war das die Zeit, in der das Krankenhaus, in dem er arbeitete, bombardiert und zerstört worden war. Er hatte an dem Tag frei, doch viele seiner Kollegen und viele Patienten waren damals ums Leben gekommen. Wie er mir später einmal sagte, war dies auch ein Grund, warum er sich zur Flucht entschlossen hatte. Nach seiner Meinung waren gewisse ausländische Mächte nicht wirklich darauf aus, den Bürgerkrieg zu beenden, dem Gerede von Politikern schenkte er von da an nur noch wenig Beachtung. Damals hatte ich seine Worte nicht verstanden, doch als ich mir nach dem Abitur vor Ort selbst ein Bild der Umstände machen konnte, musste ich an ihn denken. Und ich fand so manche Äußerung bestätigt. Und im Rückblick verstand ich jetzt auch einige Zusammenhänge und sah vieles in einem anderen Licht. Einige Menschen wollten offenbar tatsächlich nicht, dass es besser wird. Doch andere wiederum packten an, wie man sagt, es musste schließlich vorwärts gehen! Nach meiner Rückkehr nach Deutschland stellte ich mit Bedauern fest, dass man von hier aus tatsächlich nur in geringem Maße die Verhältnisse in anderen Ländern verbessern konnte. In Relation zu dem, was darüber gesprochen und diskutiert wurde, stand es in keinem Fall! Da beschloss ich für mich, dass ich bald wieder dorthin fahren würde, ich hatte mehrere Menschen dort kennen gelernt, die so dachten wie ich, und mit denen ich auch noch in Kontakt war. Per E-Mail oder sogar telefonisch.
Anschließend warf ich einen Blick auf meine E-Mails, stellte fest, dass ich weder ein Haus noch ein Auto kaufen, keine neue Wunder-Diät ausprobieren und auch keine Reise nach Südostasien, Kanada oder in die Karibik gewinnen wollte, überlegte kurz, ob ich den Absendern schreiben sollte, dass sie meine E-Mail-Adresse gern aus ihrem Verteiler löschen könnten, verwarf den Gedanken jedoch als unrealistisch und löschte die Mails einfach. Private E-Mails hatte ich keine.
Da hörte ich, wie Sina ihre Tür öffnete und ins Bad ging. Ein Blick auf den Wecker verriet mir, dass es tatsächlich Zeit wurde, wenn ich den heutigen Tag nicht im Bett verbringen wollte. Ich stand auf, ging in die Küche und bereitete unser Frühstück vor.
Sina kam aus Würzburg, hatte dort aber keinen Studienplatz bekommen und hatte sich dann auch für Berlin beworben. Hier hatte es geklappt, und bei der ersten Begegnung während der Wohnungssuche hatten wir uns auf Anhieb gut verstanden.
Sie ist Italienerin, geboren und aufgewachsen in Norditalien, in einem kleinen Kaff in der Nähe von Mailand, und mindestens so interkulturell wie ich veranlagt. Als sie elf Jahre alt war, starb ihr Vater bei einem Unfall in der Fabrik, in der er gearbeitet hatte. Sie half daraufhin ihrer Mutter im Haushalt und ein wenig auch bei der Erziehung ihrer jüngeren Brüder, die damals neun und sechs Jahre alt waren. Ihre Mutter ist Französin und arbeitete halbtags, aber das ging schließlich nicht mehr, da ihr kleiner Bruder schwer erkrankte und ein halbes Schuljahr zu Hause und im Krankenhaus verbringen musste. Als er wieder gesund war, wagte sie einen Neuanfang und folgte einer Freundin nach Würzburg, die ihr dort einen Job besorgen konnte. Die Freundin hatte einen Deutschen geheiratet, die beiden betrieben eine Pizzeria, und ihre Mutter hat das Angebot dankend angenommen. Sie konnte dort mitarbeiten, in der Buchhaltung und im Service bei freier Zeiteinteilung, und sich um ihre drei Kinder kümmern. Sina wuchs so dreisprachig auf und nun studierte sie Deutsch, Französisch und Italienisch auf Lehramt. Sprachen fielen ihr leicht, meinte sie, sie war auch ein echtes Temperamentsbündel und hatte natürlich in der Schule Englisch und nebenbei auch noch Spanisch und Portugiesisch gelernt. Damit sie dort später mal Urlaub machen konnte, wie sie meinte.
Wir bildeten jetzt bereits seit einem Jahr eine Wohngemeinschaft und waren sehr gute Freunde geworden. Sie hatte eine Art von Humor, die ich mochte. Als ich ihr erklärte, dass ich nicht weiß, wo Würzburg liegt, meinte sie, da wo sich die Autobahnen sieben und drei kreuzen. Sie hatte eine eigene Art, wirkliche Dinge bildhaft oder plastisch zu erläutern und mit einer Prise Humor zu würzen. So konnte selbst ich mir das merken, die ich zwar einen Führerschein, aber kein Auto besaß, und auch noch nie in dem Gebiet unterwegs gewesen war.
Als Sina im Bad fertig war, ging ich hinein, und sie zog sich an und ging zum Bäcker bei uns um die Ecke. Ich wusste, dass sie eigentlich keine Brötchen mochte, aber sie fand den neuen Typen beim Bäcker so süß, deswegen hatten wir uns zu Beginn des Semesters darauf verständigt, dass sie immer Brötchen holen durfte. Leider war er nur Dienstags und Donnerstags im Geschäft, und immer nur am Vormittag. Und da dort immer sehr viel los war, hatte sich bisher noch keine Gelegenheit für sie ergeben, ihn mal anzusprechen – abseits vom Business.
»Das muss sich langsam entwickeln«, hatte sie mir erklärt, und ich hatte nicht weiter nachgefragt.
Wenig später saßen wir beim Frühstück, mit Brötchen, Brot, Rührei, Butter, Käse, Aufschnitt und Obst. Sina trank Kaffee, ich Tee.
Als um halb neun die Nachrichten im Radio verlesen wurden, brachen wir auf. Heute war Fahrradfahren angesagt. Obwohl es bereits Oktober war, war es ein fast herrlicher Spätsommertag, ein goldener Oktober, wie ich kürzlich im Internet gelesen hatte. Ich hatte mir den Begriff gemerkt, da ich ihn bisher nie gehört hatte. An der Uni trennten sich unsere Wege, einer Vorlesung folgte ein Seminar, und zum Mittag traf ich Sina wieder in der Mensa. Es war sehr voll, doch wir fanden schließlich einen Tisch, wo noch zwei Plätze frei waren. Nach dem Essen ging es auf dem direkten Weg in die Caféteria. Hier bestellte sich Sina einen Kaffee, während ich mich schon zu Franziska und Amelie setzte, die einen Vierertisch am Fenster besetzt hielten.
Als Sina mit ihrem Kaffee kam, nahm das Gespräch Fahrt auf, und nachdem wir eine Weile Belangloses ausgetauscht hatten, fragte Amelie: »Und wann triffst du ihn wieder?«
Obwohl ich ahnte, wen sie meinte, spielte ich die Verblüffte: »Wen?«
»Ach ..., nun tu nicht so! Du weißt schon ..., den Typen, den du am Samstag auf der Party kennen gelernt hast. Tim.«
»Ach ..., Tim ..., ja ...«
»Sie hat den ganzen Sonntag mit ihm gemailt«, schoss es da förmlich aus Sina heraus.
»Stimmt ja gar nicht!« Ich tat empört.
»Den ganzen Nachmittag!«
»Gar nicht wahr!«
»Und ob!«
»Und wenn schon!«
»Und dann?«
»Dann haben wir uns zum Telefonieren verabredet. Für gestern.«
»Gestern hat Maryam den ganzen Abend telefoniert. Ich schwöre!«, erklärte Sina mit feierlicher Miene.
»Gut, dass es Handys gibt«, prustete Franziska los. »Sonst wäre die Leitung dauerbesetzt gewesen. Hat der Akku so lange gehalten?«
»Ha ha«, machte ich. »Sehr komisch.«
Plötzlich verstummten die anderen. Hinter mir hörte ich jemanden, dann eine Stimme: »Und ..., erzähl ...! Du hast einen Typen kennen gelernt?«
Ich sah mich um. Hinter mir stand Viktoria.
Sina, Franziska, Amelie und ich wechselten einen Blick. Viktoria gehörte nicht zu unserer Clique, aber wir kannten uns vom Studium. Sie war so alt wie wir, einundzwanzig, ebenfalls im dritten Semester und wollte auch Lehrerin werden.
»Ja, am Samstag auf der Party. Es war schon recht spät, und ich wollte noch eben etwas zu trinken für uns organisieren. Doch das wollten viele, und ich stand lange allein in der Schlange ..., und auf einmal stand er neben mir.«
»Und hat er dich angesprochen?«
»Ich weiß gar nicht mehr ..., irgendwie kamen wir ins Gespräch und ...«
»Er ist schon vierundzwanzig«, bemerkte Amelie.
»Ich weiß, ich kenne ihn.«
Wie mit einem Reflex griff ich zu meinem Wasser und nahm einen großen Schluck. »Wieso kennt sie Tim?«
»Du kennst ihn? Woher?«, fragte Sina.
Viktoria sah sie mit hoheitsvoller Miene an. »Es ist immer gut, wenn man auf dem Laufenden ist«, erklärte sie in einem Tonfall, als würde sie gerade die Relativitätstheorie vor einer Gruppe von Teenagern erörtern.
»Bist du auf der Suche?«, fragte Amelie.
Ich verschluckte mich fast an meinem Wasser, gleichzeitig bemerkte ich, wie Sinas Gesichtsmuskeln zu tanzen begannen. Sie übte sich offenbar in Selbstbeherrschung, ich kannte das von ihr.
Viktoria schien sich jedoch nicht einmal ansatzweise angegriffen zu fühlen. »Vielleicht«, gab sie mit einem Gesichtsausdruck zurück, der undefinierbar war. »Das mit Fabian ist jedenfalls vorbei.«
»Das hat dann ja nicht lange gedauert«, meinte Amelie.
Ich sah sie erstaunt an.
»Was? Es ist immer gut, wenn man auf dem Laufenden ist. Hast du doch eben gehört!«
»Okay ...«
»Ich wusste gar nicht, dass du für die CIA arbeitest«, warf Sina ein.
»NSA«, korrigierte Franziska.
»Egal für wen ..., ihr macht mir Angst«, sagte ich. »Steht das irgendwo im Internet ..., oder hängt am Schwarzen Brett eine Info, wer hier wann mit wem geht, auf der Suche ist, Schluss macht oder dabei ist, Schluss zu machen?«
»Ja, das steht alles im Internet ..., dort gibt es eine große Suchdatenbank ...«
»Erzähl doch keinen Blödsinn«, unterbrach Viktoria Amelie. »Du bist mit Fabian befreundet ..., seit dem ersten Semester. Das weißt du doch alles bestimmt von ihm ..., aus erster Hand!«
Amelie prustete los. »Erwischt«, gab sie dann zu.
»Leute, Leute!«, staunte Sina.
»Ohne Worte!«, sagte ich und schüttelte den Kopf.
»Tja ..., du musst halt wissen, wen du fragen kannst«, meinte Franziska.
»Kommt auf die Sache an«, erklärte Sina.
»Richtig, für Affären haben wir ja jetzt jemanden, der besser informiert ist als CIA und NSA gemeinsam«, fügte ich hinzu und grinste dabei.
»Seht ihr ..., ihr kennt mich eigentlich gar nicht«, witzelte Amelie.
»Wer kennt schon den anderen wirklich?«, sinnierte Franziska.
»Gleich müssen wir zur Paartherapie«, spottete Sina.
»Gruppentherapie«, korrigierte Viktoria.
»Oder so.«
Ich erhob mich. »Leute ..., danke für das Gespräch, aber ich muss jetzt weiter. Gleich ist noch eine Vorlesung ..., dann muss ich zum Sport, dann arbeiten ..., und dann muss ich noch für die Klausur lernen. Ich habe nur noch zwei Tage Zeit!«
»Wir auch«, meinte Sina, schob ihren Stuhl demonstrativ nach hinten und stand ebenfalls auf.
»Okay ..., wir sehen uns«, sagte Viktoria und verließ unseren Tisch.
»Wollt ihr wirklich schon los?«, fragte Franziska.
»Ja ..., habt ihr denn keine Vorlesung gleich?«
»Nee ..., ich habe noch eine Stunde frei ..., aber es lohnt sich nicht, nach Hause zu fahren. Denn danach habe ich noch vier Stunden. Zwei Vorlesungen. Dienstag ist echt der schlimmste Tag!«
»Und erst die Nacht!«, warf Sina ein und sah mich an.
»Genau! Du musst nachher noch arbeiten, nicht?«, fragte Amelie. Das ging an mich.
»Ja ..., bis ein Uhr«, bestätigte ich.
»Na dann ..., sehen wir uns morgen, ja?«
»Aber klar ..., bis dahin! Ciao!«
»Ciao!«
Sina und ich traten den Weg zur letzten Vorlesung des Tages an. Psychologie stand auf dem Lehrplan. Wir sollten lernen, wie unterschiedlich der Umgang mit Erwachsenen und Kindern sein kann.
Auf dem Weg zum Hörsaal fragte ich sie: »Und ..., was war heute Morgen beim Bäcker? War er da? War er nicht da? Hast du ihn gesehen?«
»Wen?«
Ich räusperte mich ein wenig.
Sie verstand sofort. »Ach ..., ja ..., nee, doch. Ja, er war da. Aber er hatte keine Zeit. Es war zu viel los.«
»Hat er dich bemerkt?«
»Das will ich doch hoffen! Ich habe sechs Brötchen bei ihm gekauft!«
Ich musste lachen. »Ach so ..., darum die große Tüte. Vier hätten auch gereicht.«
»Aber er hat mir noch eine ganz spezielle Sorte empfohlen ..., da konnte ich doch nicht ablehnen.«
»Natürlich nicht. Und deswegen hast du auch gleich zwei Stück genommen. Für mich auch.«
»Genau!«
»Was soll bloß werden, wenn er mal nicht mehr da arbeitet? Dann macht der Bäcker direkt pleite! Mit Sicherheit.«
»Ach, du spinnst doch!« Sina grinste. Sie hatte längst gemerkt, dass ich sie auf den Arm nahm.
Wir alberten noch weiter herum und kamen in guter Stimmung beim Hörsaal an. Die Vorlesung war sehr kurzweilig, und trotzdem ertappte ich mich ab und zu dabei, wie ich nach der Uhrzeit sah. Als die Veranstaltung vorbei war, ging ich ohne Umwege zu meinem Fahrrad, fuhr nach Hause, packte meine Sporttasche mit Trainingsklamotten und fuhr ins Fitness-Studio.
Dort angekommen, zog ich mich um, schloss meine Sachen in meinen Schrank und ging in die Halle. Ich traf einige Bekannte, die ebenfalls wie ich regelmäßig hierher kamen und schon einige Übungen absolviert hatten. Doch ich ließ mich auf keine tiefergehenden Gespräche ein, ich wollte mein Pensum absolvieren und dann schnell wieder nach Hause. Nach einer Stunde hatte ich mich an fünf verschiedenen Geräten ausgepowert, fühlte mich aber auch fast wie neugeboren. Ich ging unter die Dusche, anschließend zog ich mich wieder an und radelte nach Hause. Ich lag gut in der Zeit und spürte, wie die Lebensenergie meinen Körper durchpulste. Es war ein gutes Gefühl.
Als ich wieder zu Hause ankam, war Sina schon da. »Hey, ich bin es!«
»Habe ich mir schon gedacht!«, tönte es aus dem Wohnzimmer zurück.
»Hast du schon gegessen?«
»Nein, ich habe auf dich gewartet.«
»Danke. Das ist nett. Wollen wir denn jetzt etwas essen? Ich habe Hunger.«
»Na klar. Ich auch. Ich habe auch schon einiges vorbereitet.«
»Brötchen?« Ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen.
Sina war nur für eine Sekunde verblüfft, dann begriff sie. »Brötchen gehören auf den Frühstückstisch. Abends gibt es Baguette. Oder Brot. Die Brötchen, die heute Morgen übrig geblieben sind, werden morgen früh aufgebacken.« Sie grinste.
»Okay. Dann also Brot ...«, meinte ich mit einem Lachen und öffnete den Kühlschrank.
Nach dem Abendbrot half ich Sina beim Saubermachen der Küche, dann leistete ich ihr noch eine Viertelstunde Gesellschaft im Wohnzimmer, bevor ich mich umzog und zur Arbeit fuhr. Wieder mit dem Fahrrad. Es hatte sich etwas abgekühlt, mich empfing eine angenehme Abendluft.
Ich arbeitete in einem Lokal, das auf Grund seiner hervorragenden Lage und sehr guten Küche sowohl von Touristen als auch Einheimischen und Studenten besucht wurde, als Kellnerin. Dienstags von abends um neun bis Mittwoch morgens um eins und Freitags von abends um neun bis Samstag morgens um drei. Insgesamt zehn Stunden pro Woche. Damit verdiente ich vierhundert Euro im Monat, gewissermaßen eine Art Grundgehalt während des Semesters. Sonderschichten und Trinkgelder gingen extra, und bisher hatte ich noch keinen Monat unter fünfhundert Euro verdient.
Ich wurde bereits erwartet. Von Sebastian, er war der Chef. »Hey, Maryam ..., gut, dass du da bist. Fatima ist krank. Du musst den hinteren Bereich heute Abend allein übernehmen.«
Sebastian war fünfzig Jahre alt, Ur-Berliner und beschäftigte neben Studenten, die oft für eine Saison oder ein Semester blieben, hauptsächlich Festangestellte. Von dem zwölfköpfigen Service-Team arbeiteten momentan nur zwei stundenweise, Lisa und ich. Lisa studierte an der Humboldt-Uni Medizin, wohnte aber bei ihrem Freund in Dahlem. Er studierte an der FU, wie ich, schrieb allerdings schon an seiner Master-Arbeit. Ich hatte ihn auch noch nie gesehen, kannte ihn im Grunde nur von Lisas Erzählungen. Sofern man so etwas “kennen” nennen kann. Die vier, die neben mir heute Abend Dienst hatten, waren Juan, der Koch, Britta, Alexandra und eben Fatima. Sie alle waren Stammkräfte.
Fatima und mich verband ein besonderes Schicksal. Wir hatten uns nach meinem Abitur in einem Flüchtlingscamp kennen gelernt, sie arbeitete dort schon länger als Flüchtlingshelferin, war sechs Jahre älter als ich und gab mir erste wertvolle Hinweise. Hinweise von einer Frau, die mich verstand, mitten im Leben stand, aber nicht meine Mutter war. Sie war Sunnitin und kam aus dem Irak. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland blieben wir in Kontakt, wir schrieben uns regelmäßig E-Mails, und nach drei Monaten erfuhr ich, dass sie sich verliebt hatte. Sein Name war Abdullah, er war Iraner, arbeitete auch in der Flüchtlingshilfe und war kurz nach meiner Abreise dort angekommen. Er war Schiit, und somit war für die beiden ein normales Zusammenleben nahezu unmöglich. Da erinnerte sich Fatima an meine Erzählungen über Deutschland und Berlin und schlug Abdullah vor, nach Berlin zu gehen. Sie erklärte ihm, dass Berlin zwar groß sei, er sich aber nicht fürchten müsse, denn immerhin sei Bagdad mit drei Millionen Einwohnern auch nicht gerade klein, und wenn er an seine Heimatstadt Teheran dachte, würde sich das noch stärker relativieren, denn dort lebten immerhin sieben Millionen Menschen.
Er hatte nach einigem Zögern eingewilligt, und sie hatte mich gefragt, ob ich ihr einen Tipp geben könnte, wie man in Berlin einen Job bekommen und all die Formalitäten und Sachen, die zu tun waren, erledigen konnte. Aus dem Ausland. Ich hatte ihr geschrieben, dass ich mich kümmern würde und sofort meine Eltern gefragt. Meine Mutter hatte die richtige Idee: Sie hatte gehört, dass an zahlreichen Berliner Schulen Projekte liefen, für die eigentlich laufend Mitarbeiter mit Sprachkenntnissen, wie sie Fatima und Abdullah vorweisen konnten, gesucht wurden. Ich hatte die Information weitergegeben, und die beiden hatten sich umgehend beworben, an zwei verschiedenen Schulen. Sie wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, da hatten wir uns nach längerer Zeit wiedergesehen, und ich lernte auch Abdullah persönlich kennen. Die Chemie stimmte, und beide wurden genommen. So kamen sie tatsächlich nach Berlin und bekamen zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. So lange sollte das Projekt noch laufen, und dann bestand gute Aussicht auf Verlängerung. Tatsächlich wurden nach wie vor in vielen Berliner Schulen Menschen mit ihren Erfahrungen und Sprachkenntnissen gesucht. Abdullah erhielt dann bald eine Festanstellung, doch Fatimas Schule sollte nach neuen Plänen mittelfristig geschlossen werden. Es fehlte Geld. Damit war absehbar, dass ihr Vertrag nicht verlängert werden würde, und ihr drohte damit nach Ende des Projektes die Ausweisung. Doch sie ließ den Kopf nicht hängen und bewarb sich sofort, als sie davon erfahren hatte, bei anderen Unternehmen und Firmen, quer durch alle Branchen. Auf eine Annonce von Sebastian antwortete sie nicht per Brief oder E-Mail, sondern ging spontan hin. Sie überzeugte ihn auf Anhieb, auch wenn sie noch nie in der Gastronomie gearbeitet hatte, doch er meinte, allein ihre Ausstrahlung und ihre anderen Kenntnisse würden sie qualifizieren. Den Rest würde er ihr schon beibringen. Es gab nichts, was sie nicht lernen konnte.
Und Fatima hatte nicht nur gelernt, sie war in dem Sinne auch eine gute Lehrerin. Als ich nach meinem ersten Semester einen Job suchte, hatte sie mich mit allem bekannt gemacht, der Kneipe, den Abläufen und mich den anderen vorgestellt. Sebastian hatte sie bei meiner Bewerbung darauf hingewiesen, dass ich vier Sprachen spreche und ihre beste Freundin sei. Da hatte er nicht mehr lange überlegt und mir den Job gegeben. Das war in den letzten Semesterferien, und nach einer Testphase von vier Wochen hatte er mich sozusagen fest engagiert. Meine Eltern hatten mir zum Studium einen Zuschuss für das erste Jahr gegeben, monatlich fünfhundert Euro. Doch jetzt musste und wollte ich auch selber wieder Geld verdienen, da ich meine Ersparnisse etwas dezimiert hatte.
Das war aber den Umständen geschuldet, denn ich war im Sommer auf einer Hochzeit eingeladen. Fatima und Abdullah hatten geheiratet – im Kreis ihrer Freunde. Von den Familien war niemand gekommen. Das, was Fatima also befürchtet und mir vor einiger Zeit per E-Mail mitgeteilt hatte, war wirklich eingetreten. Doch sie hatten in Berlin mittlerweile einen so großen Freundeskreis, dass es trotzdem eine große Feier war. Und dafür brauchte ich selbstverständlich auch etwas Schickes zum Anziehen! So plünderte ich mein Sparbuch, dass meine Eltern für mich vor zehn Jahren angelegt hatten, und auf dem durch meine Arbeit nach dem Abitur im Ausland eine nach meinen Begriffen größere Summe auf diese Gelegenheit quasi gewartet hatte. Der Rest, die eiserne Reserve, war für meinen nächsten Urlaub und für Notfälle gedacht. Die würde ich nicht anrühren.
Fatima war inzwischen siebenundzwanzig, so alt wie mein Bruder Aaron, und ein burschikoser Typ. Sie hatte große, dunkle Augen und eine wallende Mähne, die sie nur mit einer Bürste bändigen konnte. Ich beneidete sie insgeheim ein wenig, denn die Aufmerksamkeit der Männer war ihr gewiss – egal wo sie hinkam. Auch bei uns in der Kneipe hatte sie schon so manchen Verehrer, doch meistens blieb es bei blöden Sprüchen, die sie stets schlagfertig konterte. Sie konnte aber auch sehr resolut sein. Als bei einem Typen sehr spät in der Nacht keine Sprüche mehr halfen, und er die Hände nicht von ihr lassen wollte, hatte sie ihm ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet und ihn aufgefordert, dass er sich erst mal abkühlen sollte. Er war wütend aufgesprungen, doch sie bedachte ihn mit einem so verächtlichen Blick, dass er sie nicht anrührte. Als sich dann auch noch Alexandra neben sie stellte, hatte er fluchend die Kneipe verlassen.
Alexandra ist die dienstälteste Mitarbeiterin von Sebastian, groß, schlank, athletisch, Mutter von zwei Kindern, nicht auf den Mund gefallen und hätte mit ihren langen blonden Haaren und den blauen Augen auch Model werden können. Meiner Meinung nach. Sie konnte aber mit ihren Augen offenbar nicht nur nett in die Kamera lächeln, sondern hatte auch diesen eiskalten Blick drauf, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Mit einem solchen Blick hatte sie den Typen bedacht.
Das war offenbar zuviel für ihn, und Sebastian hatte die beiden kurzerhand für soviel Frauenpower gelobt und dem Kerl Hausverbot erteilt. Als Abdullah die Geschichte hörte, wäre er am liebsten dabei gewesen und hätte dem Typen seine Version von Power gezeigt. Doch als er Alexandra wenig später kennen lernte, hatte er verstanden, dass es auch anders geht. Sie hatte ihn mit einem Blick gebändigt, wie mir Fatima hinterher erzählte, und im Scherz hatte sie Alexandra gefragt, ob sie ihr nicht mal ihre Augen im Bedarfsfall ausleihen könnte.
Dass Fatima krank war, überraschte und beunruhigte mich. Sie hatte mir nichts geschrieben, und normalerweise mailten wir gerade in solchen Fällen. Ich absolvierte die Schicht mit einer gewissen Routine, die vier Stunden vergingen, doch es kam keine Nachricht von ihr. Auch Sebastian und die anderen hatten nichts wieder von ihr gehört.
»Ich werde mich erkundigen«, versprach ich, als wir uns um zehn nach eins verabschiedeten, und fuhr auf dem schnellsten Weg nach Hause.
Sina schlief bereits, wie ich feststellte, und ich ging schnell ins Bad. Anschließend ging ich in mein Zimmer, griff zu meinem Handy und schickte Fatima eine Mail: »Hi! Geht es dir gut? Ich habe gehört, du seiest krank?«
Ich musste nicht lange auf eine Antwort warten: »Wie man es nimmt. Ich hatte heute ein Gefühl, das ich noch nie hatte, und mir ist auf der Straße etwas schwindlig geworden. Da bin ich zu meinem Arzt gegangen, und der hat mich ins Krankenhaus geschickt, da er nichts Ungewöhnliches festgestellt hat. Und im Krankenhaus musste ich lange warten, aber dann hat mich ein Arzt untersucht, der war wirklich sehr nett. Und er hat festgestellt, dass ich schwanger bin!«
Ich atmete tief und beruhigt durch. Dann schrieb ich zurück: »Das ist ja toll! Das freut mich für dich. Und für euch!«
Sie antwortete umgehend: »Danke dir. Ich freue mich auch. Abdullah auch. Ich habe ihn aus dem Krankenhaus angerufen, und er kam gleich nach Feierabend vorbei und hat mich abgeholt. Aber es ist doch schon spät. Du musst bestimmt schlafen, oder?«
»Das stimmt, aber wer soll bei solchen Neuigkeiten schlafen?«, schrieb ich zurück und fügte noch einige Smileys hinzu.
Ihre Antwort bestand aus einem Smiley.
»Ich melde mich morgen. Gute Nacht!«, schrieb ich und wollte mein Handy ausstellen. Da kam eine Mail von Tim: »Gute Nacht, schlaf gut.«
Er wusste, dass ich heute gearbeitet und jetzt erst zu Hause sein würde. Er hatte an mich gedacht.