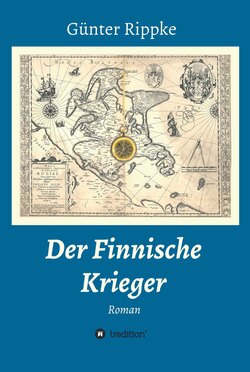Читать книгу Der Finnische Krieger - Günter Rippke - Страница 7
ОглавлениеFALDERA
Josef-Jakob Kleinermann war dreiundsechzig, als er sich entschloss, sein Haus und das kleine Ladengeschäft „Feine Papier- und Schreibwaren“ am Lüttwark/Ecke Mühlenweg aufzugeben. Er hatte hier 27 Jahre gelebt und sich auch am richtigen Ort gefühlt, aber plötzlich wollte ihm die Vorstellung, in der unveränderlichen Umgebung wirklich alt zu werden, nicht mehr gefallen. Einen anderen Grund hätte er kaum nennen können, es ging ihm gut, er war gesund und einigermaßen wohlhabend – nicht durch geschäftliche Erfolge, der Kleinhandel war mehr ein Zeitvertreib für ihn. Er genoss ein Erbe aus den väterlichen Anteilen an der Tuchfabrikation, die einst den wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt mitbegründet hatte.
Die Fabriken für Stoffe und Leder waren in vergleichsweise kurzer Zeit aus dem Stadtbild verschwunden. Man hätte ein neues Stadtwappen gestalten müssen, das die Silhouetten von fünf Fabrikschornsteinen über einem weißen Schwan durch ein anderes Symbol ersetzte, doch wollte sich kein neuer bestimmender Erwerbszweig einstellen. Bad Faldera hatte sich mit der Zeit zum Verkehrsknotenpunkt und bloßen Durchgangsort entwickelt.
Der Schwan hatte den Niedergang überlebt. Es handelte sich, wie Herr Kleinermann vermutete, um ein männliches Exemplar. Versuche, ein Schwanenpaar auf dem Mühlenteich anzusiedeln, waren stets gescheitert. Möglicherweise war das Tier ein ebenso eingefleischter Junggeselle wie auch er.
Herr Kleinermann hatte kaum ein Auge für das majestätische Gehabe auf dem Wasser hinter seinem Haus. Der Schwan hingegen schien die meist stille Ecke am Auslauf des Teiches zu lieben. Täglich segelte er langsam wie eine Hanse-Kogge in den ruhigen Hafen und ging hier für einige Zeit vor Anker, wie um das ruhige Treiben am Lüttwark zu betrachten oder von den Leuten selbst bewundert zu werden.
Hier hatten vor Jahrhunderten Mönche einen Arm eines Flüsschens angestaut und das Überlaufwehr angelegt, um bei Bedarf eine tiefer angelegte Mühle betreiben zu können. Mühle und Mühlgraben waren längst verschwunden, über das Wehr ging nun die schmale Straße „Am Lüttwark“, das Wasser floss direkt unter den Füßen der Passanten weg und lief in einer Rohrleitung unter dem Mühlengang dem andern Arm des Baches zu, der nach Umrunden die Stadt dort bald unter Büschen und Bäumen erschien.
Man mochte sich wundern, dass für die eigentlich harmlosen Effekte ein solcher Aufwand betrieben worden war. Doch wenn man die Lebensbedingungen vor hunderten von Jahren bedachte, erhielt die Sache ihren Sinn. Eine Aue in der eher trockenen Geestlandschaft hatte für die frühen Siedler schon eine Bedeutung, und wenn das Wasser eine unscheinbare Erhebung gar als Insel umfloss, war das gewiss ein Grund, an diesem Ort ein Kloster zu gründen.
Auch in späterer Zeit hatte das Wasser des Flüsschens den Ausschlag für die Entwicklung zur Stadt gegeben: Wolle und Felle aus der Tierhaltung im Umland konnten nur unter reichlichem Wasserverbrauch zu Stoffen und Leder verarbeitet werden. Es war daher folgerichtig, dass die ersten Manufakturen dieser Art dort entstanden, wo sich die beiden Arme des Flüsschens hinter dem künstlichen Teich wieder vereinigten.
Herr Kleinermann kannte die Stadtgeschichte selbstverständlich ausführlicher. Er hielt in seinem Laden stets eine kleine Auswahl entsprechender Heimatliteratur vorrätig. Man kann aber nicht sagen, dass er sich für Stadtgeschichte besonders interessiert hätte. Nach seinem Volontariat beim Holsteinverlag, der darauf spezialisiert war, hatte ihn das Thema kaum noch berührt, er fand es unergiebig. Seit Jahrhunderten stand alles fest, war dutzende Male beschrieben, kommentiert und fotografiert worden, was sollte daran noch interessant sein? Geschichte war nicht sein Fall, schon in der Schule nicht. Zahlen und Namen, Schlachten, Helden, Sowieso der Große.
Aus Geschichte könne man nichts lernen, fand er. Jede Generation mache die gleichen Fehler, was ja irgendwie verständlich war, weil alle Menschen einen ähnlichen Kreis durchlaufen; sie sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Greise, immer mit den entsprechenden Bedürfnissen, die sie unter den wechselhaften Bedingungen zu erfüllen versuchen. Die Mehrheit musste sich da irgendwie durchhangeln. Man schaffte das natürlich, mit den üblichen Behelfen.
Konnte man Erfahrung überhaupt weitergeben?
Er hatte da so seine Zweifel; vererbbar sei sie jedenfalls nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Andererseits – er hätte keine großartigen Erfahrungen weitergeben können. Sein Leben war ohne sensationelle Einschnitte verlaufen, und er hatte keine Kinder.
Allgemeine Literatur führte er nicht, dafür war Berendsen am Großmarkt zuständig. Aber wer etwas Ausgefallenes suchte, kam zu Kleinermann. Der konnte durch seine Kenntnisse des Verlagswesens die seltsamsten Titel beschaffen. Dann sah man für zwei, drei Tage etwa ein „Plattdeutsches Wörterbuch“ im Schaufenster oder den „Historischen Atlas Schleswig Holsteins“ oder „Reise mit Humboldt zum Orinoco“. War das Bestellte abgeholt, galt es als ausverkauft, konnte bei Bestellung jedoch kurzfristig geliefert werde.
Werbung brauchte er nicht, Kleinermann war ein Begriff in der Stadt.
Man hielt ihn allerdings für etwas schrullig. An richtige Öffnungszeiten hielt er sich selten, wenn ihm so war, machte er den Laden zu und setzte sich in das kleine Gärtchen neben dem Haus, eigentlich nur ein Tortenstück von wenigen Schritten bis zum Wehr. Von dort hatte er den Laden im Blick, und für den Fall, dass er von einem Buch so gefesselt war, dass er nicht mehr aufsah, gab es die Klingel an der Tür.
Das Gärtchen bestand eigentlich nur aus etwas Kies hinter einer niedrigen Hecke. Man hatte jedoch einen schönen Blick an zwei alten Weidenbäumen vorbei aufs Wasser.
Er nahm das alles schon lange nicht mehr als etwas Besonderes zur Kenntnis; seit dem Erwerb des Anwesens waren viele Jahre vergangen, ohne dass es hier Veränderungen gegeben hatte; Haus und Inventar stammten aus dem vergangenen Jahrhundert, und ähnlich sah es in der Nachbarschaft aus.
Für Fußgänger bildete der Weg übers Wehr seit alters die kürzeste Verbindung zum Kleinen Markt. Fahrzeuge waren auch nach der Befestigung verboten, die Passage wäre dafür zu eng gewesen, zumal sie hinter dem Wehr in den noch schmaleren Propstengang einmündete. Infolge der beengten Verhältnisse hatte man besonders an den Markttagen den Eindruck eines dichten Menschengedränges.
Herr Kleinermann liebte die Markttage nicht. Der Strom wogte vorüber, ohne den Laden für feine Papier- und Schreibwaren zu beachten – der an diesen Tagen ohnehin geschlossen blieb. Der Inhaber saß in ein Buch vertieft unterm Sonnenschirm im Gärtchen. Niemand wunderte sich darüber, den Anblick kannte man seit Jahren.
Er hatte aber, was niemand wissen konnte, seit einiger Zeit ein besonderes Buch in Händen. Studienrat Arpen bestellte immer etwas Ausgefallenes. Diesmal war es „Einsteins Relativitätstheorie ohne Mathematik“. Wie gewohnt, hatte Herr Kleinermann die Ausgabe zunächst selbst überflogen, um dann zu entscheiden, ob er den Titel seiner eigenen Bibliothek einverleiben könnte. Für den Kunden bestellte er dann ein neues Exemplar.
Er hatte nicht gleich alles verstanden, was er da las, war aber so fasziniert von den ungewöhnlichen Gedanken einer allgemeinen Relativität, dass er das Ganze unbedingt ein zweites Mal lesen wollte.
Die behauptete Massenzunahme bei Lichtgeschwindigkeit bis gegen unendlich war das Verrückteste, von dem er je gehört hatte, folgte aber wahrscheinlich nur aus einer Formel und hatte keine Bedeutung für den Normalfall. Auch die weiteren Schlussfolgerungen waren nicht von Pappe, fand er. Doch an ein Zwillingsparadoxon mochte glauben, wer wollte; das war Unsinn, meinte er, ein dummes Beispiel. Die Dinge passten überhaupt nicht zusammen; Menschen konnten keinesfalls zum Nachweis extremer physikalischer Effekte dienen, auch wenn es nur der Veranschaulichung dienen sollte.
Dass die Zeit ganz aufhören konnte, bedurfte für ihn keines Beweises. Solche Einsichten gehörten ohnehin zu den ältesten Erkenntnissen der Menschheit. Auch dass Masse eine Form von Energie sein müsse, gefrorene Energie sozusagen, fand er einleuchtend. Außerdem sei es bewiesen – irgendwie, ihm war der Hergang nicht mehr erinnerlich.
Wieso aber überall diese Lichtgeschwindigkeit.? Sollte ihre Multiplikation mit der Masse tatsächlich Energie ergeben? Ging so etwas überhaupt? Die berühmteste Formel der Welt. Naja, musste wohl irgendwie stimmen, war nichts zu machen, die Bombe hatte es gezeigt.
Egal, das Buch gehörte in seine Bibliothek. Die war in letzter Zeit fast nur noch durch wissenschaftliche Literatur gewachsen, er war fast süchtig nach neuen Ansichten über die Natur. Er stellte das Relativitätsbüchlein ganz vorne ins Regal, um darin demnächst weiter zu studieren.
Als Arpen seine Bestellung abholte, fragte Herr Kleinermann:
„Behandelt man den Stoff heute bereits in der Schule?“
„Ich bin von Hause aus ja Philologe“, erklärte Arpen, „ich erteile keinen Unterricht im Fach Physik. Insofern entzieht sich das Problem etwas meiner Kenntnis.“
„Dann sind Sie privat an dem Thema interessiert? Ich habe nämlich ebenfalls …“
„Nicht ganz“, sagte der Philologe. „Man hat mir für nächstes Jahr einen Kurs in der Zwölften angetragen, philosophische Aspekte der Naturwissenschaften.“
„Ah, interessant. Ein großes Thema, nehme ich an. Aber müssten da die Fakten nicht schon bekannt sein?“
„Das wäre wünschenswert.“
„Sie haben natürlich keinen Einfluss darauf, ich verstehe.“
„Was die Kollegen des naturwissenschaftlichen Unterrichts behandeln, ist deren Sache.“
„Selbstverständlich. Die Wissenschaften, sagen Sie. Dieses Buch behandelt aber nur eine einzige physikalische Theorie. Benötigen Sie eventuell weiteres Material? Ich stehe Ihnen da gern zur Verfügung.“
„Vielen Dank, ich werde bei Bedarf darauf zurückkommen. Eine einzige Theorie, gewiss. Aber sagen wir getrost: eine einzigartige. Es gibt keine vergleichbare Entwicklung in den anderen Disziplinen, weder von der Methodik noch von den weltanschaulichen Aspekten her – ich sollte wohl richtiger von der Erweiterung unseres Weltbildes sprechen, das durch Bewusstmachen der Relativität unserer Kenntnisse den Ereignishorizont bis in die kosmischen Dimensionen ausgedehnt hat.“
„So hatte ich das noch gar nicht erfasst. Ich habe nämlich ebenfalls etwas in dem …“
Arpen sprach ungerührt weiter: „Nur durch die Gewissheit der Ungewissheit ist es uns möglich, das Wesen der Realität zu erfassen. Die Schule meint ja, ausschließlich Gesetzmäßigkeiten vermitteln zu sollen, doch ist das zu einseitig.“
„Aber sind die Wissenschaften nicht berufen, die Gesetzmäßigkeiten der Naturvorgänge aufzuzeigen? Die Relativitätstheorie liefert ihre Einsichten ebenfalls in dieser Art, wie sollte es anders gehen?“
„Sie haben Recht mit der Konstanz der Naturprozesse. Diese Sicht befriedigt die elementaren Bedürfnisse. Doch ein tieferes Eindringen in die Wirklichkeit wird dadurch eher verhindert als befördert.
Wir beide stehen hier. Warum? Wegen der Erdanziehung oder Gravitation, sagt die Wissenschaft, und liefert gemäß ihrem Auftrag eine Formel zur Berechnung der Wirkung zwischen zwei Körpern, wohlgemerkt: nur zwischen zwei Körpern. Mehr erfährt man nicht.“ Der Lehrer machte eine Kunstpause und hob die Augenbrauen. Dann fuhr er fort: „Über das Wesen der Gravitation kein Wort, man hat davon keine Ahnung, verschweigt es aber. Hier zeigt Einstein uns eine neue Sichtweise.“
„Nicht nur hier, wenn mir erlaubt ist; ich habe nämlich …“ Er kam wieder nicht dazu, den Satz zu beenden, Arpen redete einfach weiter.
„Auch die Verformung der Raumzeit kann nur eine historisch bedingte Erkenntnis sein. – Dabei fällt mir ein: die Zeit! Wir müssen unsere Diskussion hier leider unterbrechen und ihre Weiterführung auf einen anderen Termin verlegen.“
„Sehr gerne, Herr Studienrat, jederzeit. Wir könnten gegenüber bei Lorentzen ja einen Kaffee …“
„Kaffee verträgt mein Magen nicht.“
„Oder Tee. Schauen Sie einfach rein, ich kann mir immer Zeit nehmen.“
Er lebte allein, schon immer. In jungen Jahren hatte er sich zwar für Frauen interessiert, konnte das aber nie recht zum Ausdruck bringen. Im Grunde hielt er das sexuelle Verlangen für einen Rückfall in die animalische Vergangenheit.
Die Schönheit einer Frau vermochte ihn durchaus zu begeistern, er hatte jedoch immer die Gefahr gespürt, dass er hoffnungslos verloren wäre, wenn er den kleinsten Schritt ins Reich des Verlangens wagte.
Er verstand das alles nicht, es war einfach zu kompliziert. Irgendwann hatte er die ganze Angelegenheit auf sich beruhen lassen. In späteren Jahren war er froh darüber, denn er wäre ganz gewiss untergegangen, das sah man doch an genügend anderen Beispielen. Brauchte es weiteres Unglück in der Welt? Plötzlich Frau und Kinder im Haus und alle unzufrieden, er vor allem mit sich selbst beschäftigt und seiner Unfähigkeit, ein gewisses bürgerliches Behagen um sich zu verbreiten.
Nein, es war besser so.
Er warf er einige restliche Frühstücksbrocken ins Wasser, ohne sich darum zu kümmern, ob sie dem Schwan oder den Fischen von Nutzen wären, dann machte er sich auf zum sonntäglichen Spaziergang. Er nahm gewöhnlich einen Weg, der ihn bald aus der Stadt führte, am einfachsten gleich durch den Probstengang und dann nach links, an der Kirche vorbei zur Brücke über den Bach, der inzwischen durch allerlei angesiedeltes Gestrüpp ganz unkenntlich geworden war. Früher hatten hier die Tuchfabriken begonnen.
Vor der Kirche blieb er stehen; bekannte Gesichter strebten dem Eingang zu, es war unmöglich, sie zu ignorieren. Er grüßte mit ernstem Kopfnicken während sie an ihm vorübergingen. Er selbst verspürte keinerlei Neigung mit ihnen einzutreten. Seit seiner Konfirmation durch Pastor Möbius hatte er die Kirche kaum noch besucht, und wenn, war es nicht mehr in religiöser Absicht geschehen. Mit einer Ausnahme allerdings.
Die Konfirmation, also die „Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen“ war damals noch eine Selbstverständlichkeit. Man konnte sich seinerzeit nichts anderes vorstellen; wenn die Kinder vierzehn wurden, gab es die Konfirmation, und sie galten fortan als erwachsen. Die meisten begannen dann eine dreijährige Lehre. Nur wenige besuchten eine „höhere Schule“ um das Abitur zu erwerben.
Erst später war ihm der Unsinn einer „Konfirmation“ aufgegangen, die ihn ungefragt an einen Glauben binden wollte, der ihm zunehmend unglaubhaft erschien.
Geraume Zeit hatte er sich erfolglos um Klarheit in religiösen Fragen bemüht, bis ihm ein Großereignis zu Hilfe kam:
Billy Graham, „das Maschinengewehr Gottes“, hatte ausgerechnet das kleine und unbedeutende Faldera zum Ziel einer Erweckungsoffensive erwählt.
Der Mann aus Amerika war gewohnt, Tausende auf einen Streich zu evangelisieren, ganze Fußballstadien waren keine Seltenheit. Was den großen Prediger bewogen haben mochte, auf diesem kleinen Feld Gottes Wort zu säen, blieb einer höheren Weisheit oder der Deutung jedes Einzelnen überlassen.
Die Kirche fasste jedoch die Besucher kaum.
Graham war ein faszinierender Redner, ein Magier und Prophet, ein Führer zum endgültigen Heil, beziehungsweise auch Verführer des Willens bis hin zur religiösen Verzückung – anders konnte man es nicht nennen, wenn am Ende des rednerischen Feuerwerks mindestens drei Viertel aller Besucher seiner Aufforderung folgten, am Altar öffentlich ihre religiöse Ergriffenheit zu bekennen.
Er, der Jüngling Kleinermann, konnte sich davon zurückhalten; vielleicht hatte er zu weit hinten gestanden und die das Bewusstsein lähmenden Salven waren überwiegend nur um ihn herum eingeschlagen. Das Ereignis war jedoch entscheidend, dass er sich fortan nicht mehr mit diesen Problemen befasste. Möglicherweise war er der Einzige, der durch Billy Graham zum Atheisten verkehrt wurde.
Sogar der Kirchenbau war ihm seitdem verhasst. Von der im Jahre 1125 erfolgten Gründung war natürlich nichts mehr vorhanden, und den Neubau von 1830 im klassizistischen Stil fand er ganz unerträglich.
Als die Glocken den Beginn der Zeremonien ankündigten, setzte er seinen Weg fort, ohne auch nur einen Blick auf Fassade oder Turm zu werfen.
Er erinnerte sich nur ungern an jene Zeit. Die Abkehr vom Kinderglauben hatte ihn in die Arme einer anderen Heilslehre getrieben, dem Marxismus. Auch er empfand damals die Grundsäuberung der gesellschaftlichen Verhältnisse als höchst notwendig. Bis gegen Ende der Schulzeit äußerte sich das eher im üblichen oppositionellen Verhalten zur Situation im Elternhaus, doch mit Beginn des Studiums erkannte er den gesellschaftlichen Charakter seines Aufbegehrens. Er kam Gleichgesinnten nahe, und unter Führung eines jungen Dozenten der Philosophie bildete sich bald ein studentischer Kreis von „Revolutionären“. Man erfuhr dort, dass es auch ein anderes Modell zur Gestaltung der Verhältnisse gäbe, eines auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ruhendes. Sie studierten und diskutierten intensiv dessen umfangreiche, miteinander verwobene Voraussetzungen, blieben jedoch uneins, ob oder wie das alles zu einem atmenden Organismus zusammengesetzt werden könnte. Er war besonders beeindruckt vom philosophischen Aspekt dieser Lehre, die ihm ein umfassendes Bild vom unlösbar mit den sozialen Verhältnissen verbundenen Menschen zu bieten schien.
Da er das Ganze lediglich von der theoretischen Seite her kennenlernte, konnte er dem Ideal einer neuen Gesellschaft ziemlich lange anhängen. Vom Versuch der praktischen Umsetzung in der anderen Welt blieb er praktisch unberührt.
Das Scheitern auch dieser Heilsbotschaft traf ihn jedoch tief.
Aber das war eine andere Geschichte.
Es gab noch den alten Pfad über die Brücke, den sie als Schüler häufiger nahmen, an der ungeheuer großen Backsteinwand von Bartrams Fabrik entlang, deren schwach glimmende Fenster ihnen in der dunklen Jahreszeit etwas wie Trost und Sicherheit bedeutet hatten, denn an eine Beleuchtung war in dieser Gegend nicht zu denken. Alleine ging hier bei Dunkelheit niemand entlang.
Sie waren immer erleichtert, wenn sie die Schule erreichten, obwohl keiner von ihnen sie wirklich liebte.
Nun stand er wieder vor dem Klinkerbau.
Erbaut von 1901 bis 1903, das sah man. Kraft und Vaterland, es fehlte nur noch die Pickelhaube. Merkwürdig, wie rasch doch der Zeitgeschmack wechselte. Die modernen Anbauten im Hofbereich waren vollkommen indiskutabel. Erinnerungswert besaß eigentlich nur der Spruch über dem Eingang: „NATURAE ET LITERIS“ Es hatte fast die ganze Schulzeit gedauert, bis sich ihm der Sinn dieser Buchstaben erschloss; schon das erste Wort schien ihm rätselhaft, es musste doch heißen NATURA, also „die“ Natur und nicht NATURAE, Genitiv, also „der“ Natur, oder? Er fragte jedoch niemanden, denn das hätte bedeutet, sich lächerlich zu machen.
Dann LITERIS – also „Den Büchern“, warum nicht „Die Bücher“? Oder bedeutete das Wort vielleicht etwas anderes, etwa Wissenschaften? Auch dann blieb ihm unklar, weshalb hier nicht LITERAE stand, wie es seiner Meinung nach richtig gewesen wäre, weil doch Mehrzahl.
Unter diesen unverständlichen Buchstaben war er täglich angetreten, die Ferienzeiten natürlich ausgenommen.
Wahrscheinlich meinte der Spruch nur DER NATUR UND DEN WISSENSCHAFTEN. Aber dann fehlte ja ein Verb!
Unverständlich war ihm auch ein Großteil des Unterrichts geblieben. Er hätte eigentlich ein ganz miserabler Schüler sein müssen, aber er hielt sich bis zum Schluss als ein nur mäßig schlechter. Immerhin hatte er dort eine recht ordentliche Ausbildung in den Naturwissenschaften erhalten.
NON SCOLAE SED VITAE DISCIMUS, das war auch so ein Gedicht. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Das übersetzten sie im Lateinunterricht, und er verstand endlich, dass die Wörter noch nicht der Sinn waren, manchmal musste man in der Übersetzung etwas ergänzen, damit ein fremder Ausspruch Sinn machte. Also hätte das Motto über dem Eingang wohl auch „Der Natur und den Büchern (gewidmet)“, oder auch kurz „Für Natur und Literatur“ oder irgendwie so heißen können. Am besten, man hätte gleich geschrieben: „Gymnasium für Natur- und Geisteswissenschaften“. Aber man liebte damals die heroisierende Verkürzung in Latein.
Herr Kleinermann fragte sich, ob er diese Rätseleien aus der Schulzeit vermissen würde, fand aber, wenn er sie bisher im Kopf behalten hatte, würden sie ihn wohl auch weiter begleiten.
Diese Erinnerungen waren wenig erfreulich, die ganze Schulzeit hatte er kaum ein Gefühl der Begeisterung verspürt, außer in Musik bei Schorschi Pavel. Aber da brauchte man auch keine Fakten lernen, und Arbeiten schreiben gab’s da auch nicht.
Er setzte seinen Weg in Richtung Goodeland fort, einem kleinen Dorf zwei oder drei Kilometer vor der Stadt, wo er einen guten Gasthof kannte, „Harmsens Ausspann“. Außerdem belebte ihn der Gedanke an gewisse Kindereien, denn mit dreizehn hätte er dort gern eine Freundschaft mit der Tochter des Gärtners gehabt. Es war aber bei einigen Fahrradtouren und gelegentlichen Treffen geblieben.
Sie saßen dann bei beginnender Dunkelheit auf den Gittern über den warmen Abluftschächten von Kösters Lederfabrik und schwiegen, während die Ventilatoren in der Tiefe gleichmäßig summten. Sie beide ganz allein auf der Welt.
Schön war’s. Er kannte sogar ihren Namen noch. Sigrid.
Die Lederfabrik stand seit Langem leer, die Gärtnerei existierte nicht mehr. Alles kam ihm fremd vor, er war hier sehr lange nicht mehr gewesen.
Er durchwanderte den Ort, fand aber Harmsens Ausspann nicht. War es möglicherweise die kleine Kneipe, die sich jetzt „Dalmatiner Stuben“ nannte?
Er trat ein um das zu erkunden.
Nein, hier wurden keine Erinnerungen wach.
Ein Gericht Grünkohl, auf das er eigentlich gehofft hatte, war in Dalmatien unbekannt, stattdessen ging er auf die Empfehlung „Kroatischer Grillteller“ ein, Steak, Leber und Cevapcici an Reis mit Tsatsiki und Salat, recht ungewohnt, aber wohlschmeckend. Dazu passte auch der kräftige Rote vom Balkan, obwohl er sonst lieber Weißwein trank.
Auf dem Rückweg wollte er noch kurz ins Café „Old Huus“ auf einen Pharisäer reinschauen, den er sonntags gern nahm. Man traf hier fast immer alte Bekannte. Beim Eintreten sah er auch gleich Lehrer Arpen beim Tee. Sie begrüßten sich.
„Herr Studienrat, wie erfreulich. Darf ich wohl für einen Augenblick bei Ihnen Platz nehmen?“
„Keine Frage, lieber Kleinermann, ich freue mich, Sie zu sehen. Kleinen Sonntagsspaziergang gemacht?“
„War mal draußen bis Goodeland. Alles recht verändert.“
„Gewiss. Man sieht es erst, wenn man es sieht – hahaha …“ Er lachte über seinen eigenen Witz.
„So ist es, Herr Studienrat, genau so. Ich war seit vielen Jahren nicht mehr unterwegs nach …“
„Wem sagen Sie das, man kommt ja kaum noch raus. Ist ja auch wenig Interessantes dabei.“
„Könnte ich so direkt nicht sagen. Aber darf ich Sie vielleicht etwas anderes fragen, Herr Studienrat?“
„Nur immer zu, Fragen bin ich ja gewohnt.“
„Wie fanden Sie unsern Einstein da letztens?“
„Nun, er war mir ja nicht unbekannt.“
„Ich meine inhaltlich.“
„Hochinteressant natürlich, wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig.“
„Nicht wahr? Ich hatte ebenfalls so meine …“
„Er behandelt ja auch Fragen, die hier auf der Erde so nicht bestehen.“
„In der Tat. Aber sind die Schlussfolgerungen nicht unglaublich?“
„Was bedeutet unglaublich? In der Wissenschaft gilt kein Glauben an etwas, sondern die Realität.“
„Selbstverständlich. Aber sollte die uns nicht wenigstens begreifbar sein?“
„Hm – da fragen sie was! Wollen Sie darauf nur eine Antwort haben oder zehn?“
„Eine würde vorerst genügen.“
„Die lautet Nein.“
„Was nein.“
„Die Realität ist nicht begreifbar. Punkt.“
Es entstand eine kleine Pause, Arpen nippte an seinem Tee.
„Sehen Sie“, begann er wieder, „wir können bestenfalls verstehen, was wir unmittelbar wahrnehmen, unsere Vorstellungskraft will aber hinter die Dinge kommen, und da sieht es eben anders aus. Ziemlich anders. Ich würde sogar sagen, gänzlich anders. – Sie können mir folgen?“ Kleinermann hatte einen ziemlichen Schluck vom Pharisäer genommen, der ihm wie selbstverständlich auch ohne Bestellung gebracht worden war.
„Absolut, Herr Studienrat, ich bin ganz Ohr.“
„Also. Was können wir mit Sicherheit von den kosmischen Verhältnissen wissen? Wenig. Sie sind gewaltig, das ist fast schon alles. Von den atomaren? So gut wie nichts, die chemischen Regeln einmal ausgenommen, und die Atombombe.
Und von den subatomaren Zuständen? Überhaupt nichts. Aber wir haben Theorien über diese Seiten der Realität. Das ist schon alles.“
„Ich würde sagen, das ist allerhand.“
„Ohne Frage. Sie hatten jedoch nach der Begreifbarkeit gefragt. Ich war noch nicht am Ende; … äh, also Theorien. Wir sind uns wohl einig, dass es sich dabei um Annahmen handelt, bestenfalls um Näherungen oder Wahrscheinlichkeiten, nicht wahr?“
„Darin stimmen wir vollkommen überein.“
„Sehr schön. Dann werden Sie mir gewiss auch darin beipflichten, dass unser sogenanntes Wissen, kein Begreifen der Wirklichkeit darstellen kann.“
„Sie umfassen da mit dem Realitätsbegriff eine Gesamtheit, der ich im Augenblick nicht spontan folgen möchte.“
„So nennen sie mir eine Begrenzung.“
„Hm. Ich weiß nicht recht. Es hat dem Menschen bisher doch genügt, was er mit seinen Sinnesorganen …“
„Ha, Sinnesorgane; wie viele haben wir denn? Was leisten sie? Sehen wir UV, hören wir Ultraschall? Können wir den Magnetismus wahrnehmen? Das sind doch ganz handfeste Erscheinungsformen der Wirklichkeit. Und ich könnte fortfahren: Radiowellen, Funk und Fernsehen, das ganze Ätherrauschen und so weiter.“
„In der Tat. Ich muss da meinen Horizont wohl etwas erweitern, scheint’s.“
„Die Einsicht ehrt sie, lieber Kleinermann. Aber ich sehe – vielmehr spüre vermittelst meines Temperaturempfindens, hahaha – dass der Tee inzwischen …“
„Oh, erlauben Sie mir.“ Kleinermann winkte der Bedienung. „Und vielleicht etwas Gebäck?“
„Ich hatte bereits einen vorzüglichen Apfelstrudel.“
„Wer sagt denn, dass ein zweiter weniger gut sei? Eine willkommene Empfehlung auch für mich. Mit Ihrer Erlaubnis!“ Er ließ zwei Apfelstrudel und zwei Darjeeling FF kommen. „Wir sollten unser Gespräch noch nicht beenden, Herr Studienrat!“
„Ganz wie sie wünschen, lieber Kleinermann, aber die wichtigsten Aspekte zu Einstein haben wir ja abgearbeitet, denke ich.“
„Das Empfinden kann ich keineswegs teilen, ganz im Gegenteil. Mir scheint, dass man mit dieser Ausdehnung des Denkens auf das Universum nie zu einem Ende kommen wird.“
„Eine interessante Position. Ich sehe, wir nähern uns einander an.“
„Wie auch nicht, Herr Studienrat. Ich bin dankbar, in Ihnen einen geistigen Führer …“
„Nun übertreiben Sie aber. Im Gegenteil: Ich bin überrascht von Ihrem allgemeinen Interesse.“
„Alles nur angelesen. Man hat ja keine solide Ausbildung in Sachen Wissenschaft erfahren.“
„Ach wissen Sie, das mit der Ausbildung wird oft zu hoch veranschlagt. Gewiss, sich einige Jahre ungestört den Studien hingeben zu können, ist dem Anliegen sehr förderlich. Andererseits erfährt man im Grunde nicht viel anderes, als auch einem Normalbürger zugänglich wäre – wenn er seine Zeit darauf verwenden könnte.“
Das Bestellte kam, und man beschäftigte sich vorerst damit.
„Großartiger Apfelstrudel“, meinte Herr Kleinermann.
„Vorzüglicher Tee“, ergänzte Arpen. Wo bestellen sie übrigens Ihren Bedarf, wenn ich fragen darf?“
„Tee nehme ich nur nachmittags, da genügt ein gelegentlicher Nachkauf im Teelädchen von Anke Tönnissen nebenan vollkommen. Ist ja nur zwei Häuser weiter. Anke weiß, dass ich Darjeeling FF trinke, immer neueste Ernte.“
„Ach ja? Sind Sie ein solcher Spezialist? Ich hielt mich bisher mehr an den Ostfriesentee.“
„Ist ja auch in Ordnung. Ein guter Assam hat seinen Charakter. Ostfriesentee ist stets Assam, und oft auch sehr kräftig, es kommt auf die Feinheit der Mischung an. Ich bevorzuge grundsätzlich Gartentees.“
„Diese Tasse überzeugt mich, ich sollte vielleicht meine Gewohnheiten ändern.“
„Anke könnte Sie gut beraten.“ Er lehnte sich zurück. „Und Sie würden uns Laien Hoffnung machen, mit Fleiß in den Wissenschaften voran zu kommen?“, begann er wieder.
„Nur mit Fleiß, lieber Kleinermann, nur mit Fleiß. Doch steht nicht alles in den Büchern. Die andere Hälfte ist immer noch das eigene Nachdenken.“
„Und wenn man dabei zu anderen Schlussfolgerungen gelangte?“
„Das ist natürlich möglich, doch eher selten. Ich würde sagen, in dem Fall verfügt man entweder noch nicht über einen ausreichenden Kenntnisstand und urteilt laienhaft, oder man ist bereits im Besitz einer vollkommenen Übersicht. Das wäre dann ein Glücksfall für die Wissenschaft. Adepten der ersten Art ziehen keine Schlüsse von einiger Bedeutung.“
„Ich möchte aber doch annehmen, dass Fragen und Zweifel erlaubt sind.“
„Höchst notwendig sogar, lieber Kleinermann, nichts ist sicherer. Aber Schlussfolgerungen sind etwas anderes.“
„Da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.“
„Dachten Sie dabei an etwas Besonderes?“
„Schon; es kann doch vorkommen, dass jemand die Einsicht gewinnt, die ganze Richtung wäre Unsinn, also die wissenschaftliche Weltsicht, und wendet sich einer anderen Deutung zu. Ich habe da zum Beispiel selbst …“
„Na, Sie sind mir aber einer! Wollen Sie etwa in die Esoterik abdriften?“
„Ich überlege noch“, erwiderte Kleinermann etwas gereizt über die ständigen Unterbrechungen. „Aber man bietet mir da gegenwärtig noch etwas zu wenig.“
Arpen blickte sein Gegenüber mit großen Augen an. Als er bemerkte, dass der Buchhändler ein genüssliches Schmunzeln nicht verbergen konnte, polterte er los.
„Sind Sie des Teufels, Mann, mich derart in Irritationen zu versetzen? Ich fass’ es nicht. Und um ein Haar … ha! Bieten zu wenig, hahaha … Das ist gut, ganz ausgezeichnet!“ Er lachte laut.
Kleinermann stimmte mit ein. Die Heiterkeit der Herren erregte schon die Aufmerksamkeit anderer Gäste; im Café „Old Huus“ ging es gewöhnlich ohne solche Befindlichkeitsäußerungen zu.
„Sie werden sehen, die Wissenschaften bieten Ihnen mehr. Übrigens: Stellen Sie mir doch umgehend schon mal eine Übersicht zusammen, was gegenwärtig an Titeln vom anderen Ende der universalen Unendlichkeiten erhältlich wäre, also zu den Problemen der Quantentheorie. Ich werde nicht umhinkönnen, mich auch darin etwas zu belesen.“
„Recht gern, Herr Studienrat. Geben Sie mir zwei bis drei Tage Zeit?“
„Es eilt nicht. Aber jetzt rufen mich die Pflichten.“ Er erhob sich, auch Herr Kleinermann stand auf.
„Wie, selbst am Hohen Sonntag?“
„Gewiss. Unsereiner hat sich ständig neu auf eine Begegnung mit der jungen Generation vorzubereiten. Ich gebe morgen ein Seminar zur Situation der Wissenschaften am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts – Thema der Klasse dreizehn, fakultativ natürlich, doch erfahrungsgemäß erscheint man vollzählig.“
„Dann wünsche ich gutes Gelingen.“
„Besten Dank, mein lieber Kleinermann.“
Beide deuteten eine leichte Verbeugung an und der Lehrer verließ das Café.
Herr Kleinermann winkte die Bedienung herbei und zahlte. Er dachte ebenfalls an den Heimweg, doch bemerkte er beim Aufblicken Baurat Hinrichs samt Frau an einem weiter entfernten Tisch. Es war völlig ausgeschlossen, sie zu ignorieren.
Er war mit sich und dem Tag recht zufrieden, besonders damit, dass er den Kleinstadtphilosophen so schön verblüfft hatte. Er schlenderte langsam an den Geschäften der Marktstraße vorbei. Berendsen hatte noch geöffnet, jedenfalls stand ein reichliches Angebot an Postkarten und Zeitschriften in den Ständern neben der Tür. Herr Kleinermann ignorierte solches Geschäftsgebaren.
Kurz vor seinem eigenen Laden blieb er stehen. Bei Goldschmied Henning Voß brannte schon Licht in der kleinen Werkstatt.
„Moin, Henning, büs’ noch bie to arbeiten?“ Mit dem alten Schulfreund konnte er platt reden.
Der Alte schob die Stirnlupe zurück.
„Ach du büs’t, Scheems. Ick mutt gau noch den Ring hier graveern, Heiner Brand will Hochtied maken.“
„Wilke Deern hett hei denn nommen?“
Sie sprachen kurze Zeit über das bevorstehende Ereignis. Der Goldschmied arbeitete weiter.
„Ick wull di noch wat segg’n, Henning.“
„So? Wat denn?“
„Ick will den Laden oppgeew’n.“
Der Alte richtete sich auf. „Wat meenst dormit, den Laden oppgeew’n?“
„Ick maak Schluss hier.“
„Du büst verrückt.“
„Nich glieks! Ick heww noch nich ruutkreeg’n, woans ick dann bliewen much.“
„Nu büs’ woll ganz dörchdreiht. Du wullt wechtrecken?“
„Ick sech doch: Nich glieks!“
Sie sahen sich schweigend an.
„Na dann mach doch. Hau ab. Und komm mir bloß nicht wieder in die Werkstatt“, sagte der Alte und wandte sich wieder seiner Arbeit zu.
„Is ja nu’ good, Henning“, sagte Herr Kleinermann. Er war erleichtert.
Er blätterte in den Verlagsangeboten. Kaum was für Arpen dabei, fand er. Alles keine Originalberichte. „Plancks Weltbild“ – das kannte Arpen wahrscheinlich längst.
Aber hier, ein Vortrag vor der Uni Leiden „Das Weltbild der neuen Physik“, 1929, und eine Zusammenstellung seiner Vorträge als Taschenbuch, das war vielleicht etwas. Bei Fischer.
Interessant war sicher auch „Sommerfeld und die Anfänge der Atomtheorie, Band 26 von „Physik in unserer Zeit“.
Bohr hatte reichlich, aber anscheinend nur in englischer Sprache publiziert. Entfiel also.
Doch Pascual Jordans „Begegnungen“ schien etwas zu sein, persönliche Erinnerungen an Einstein, Pauli, Born, Bohr, Heisenberg und Laue. Die ganze Creme der damaligen Physik.
Es war wohl das Beste, mit diesen Vorschlägen zu warten, bis Arpen wieder im Laden erschien.
Zwei Tage später war er da.
„Na, schon etwas gefunden, Kleinermann?“
„Selbstverständlich, Herr Studienrat, vorerst nur diese kleine Auswahl.“ Er reichte dem Besucher das Blatt.
„Den Vortrag von der Leidener Universität bekämen wir möglicherweise nur leihweise, nach Vorbestellung, er dürfte aber in dem Sammelbändchen des Fischer Verlags mit enthalten sein.
Band 26 von Physik in unserer Zeit ist leider nur im Lesesaal zugänglich.“
„Ist kein Problem, wir können damit vorerst noch warten. Alles andere ist lieferbar?“
„In wenigen Tagen, Herr Studienrat.“
„Ja – haben Sie noch eine besondere Empfehlung? Ich brauchte fürs Erste etwas Atmosphärisches, wenn ich so sagen darf, etwas vom damaligen Geist der Zeit, der ja einen Neubeginn darstellte. Die Themen der Wissenschaft schienen erfolgreich abgearbeitet, die Industrie machte bereits ausgiebig Gebrauch von den Ergebnissen …“
„Sie sprechen von den Wissenschaften allgemein, Herr Studienrat? Mir ist aufgefallen, dass damit immer stärker besonders die physikalische Forschung gemeint ist. Warum gab es wohl keine vergleichbare Bewegung auf den ehedem so erfolgreichen Gebieten der Chemie und Biologie?“
Der Lehrer sah den Buchhändler etwas verwundert an.
„Denken Sie an die Verdienste von Darwin, Haeckel, Haber, Mitscherlich und Bosch um die Jahrhundertwende. Danach ein eigenartiger Stillstand der Entwicklung“, ergänzte Herr Kleinermann.
„Nun, Sie sprechen da etwas an. Man könnte Weitere aufzählen, gewiss. Aber so war nun mal die Entwicklung.“
„Sollte der wissenschaftliche Fortschritt auch von den gesellschaftlichen Ereignissen abhängig gewesen sein?“
„Woran denken Sie dabei?“
„An den Kriegsbeginn 1914 etwa.“
„Mag wohl sein. Die Verflechtung mit den politischen Entwicklungen darf mich nicht interessieren, wenn ich das philosophische Ganze im Auge behalten will. Dabei fällt mir ein: Unsere Aufstellung entbehrt noch der Kopenhagener Deutung, mein lieber Kleinermann.“
„Ist mir bewusst, Herr Studienrat, dachte jedoch nicht, dass Sie gleich so weit vorstoßen wollten. Wird natürlich mitgeliefert! Darf ich Ihnen vielleicht noch etwas zur Einführung in den Geist jener Zeit, wie sie sich ausdrückten, bestellen – zur Ansicht etwa? Immer zu den besten Konditionen selbstverständlich.“
„Tja, ich weiß nicht … Was schlagen Sie vor?“
„Mir schiene die Autobiographie von Heisenberg sehr geeignet.“
„Nun, ich weiß nicht … Biographien? “
„Schon der Titel ist vielversprechend: Der Teil und das Ganze“.
„Vielleicht später. Die kleine Auswahl dürfte vorerst genügen; man muss sich auch zu bescheiden wissen, mein lieber Kleinermann.“