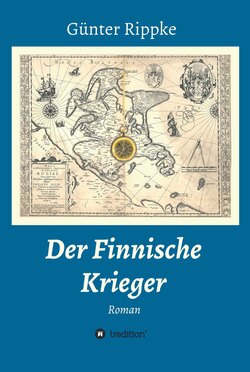Читать книгу Der Finnische Krieger - Günter Rippke - Страница 8
ОглавлениеGRANITZ
Er saß vor der Deutschlandkarte.
Der Süden kam nicht in Frage, so viel stand fest; die klimatischen Vorteile erschienen eher gering, die fremdartigen mentalen Bedingungen dagegen bedeutend. Er erinnerte sich an kurze Kontakte mit dem bayerischen und schwäbischen Dialekt; sich dort einzuleben und wohlzufühlen war ihm kaum vorstellbar.
In jungen Jahren hatte er, wie jeder Naturschwärmer, sogar von Griechenland geträumt, vom einfachen Leben und Nichtstun, von Knoblauch und Wein und langen, warmen Sommerabenden, doch hatte er nach einem dortigen Ferienaufenthalt von solchen Plänen Abstand genommen. Er brauchte eine vertrautere Umgebung.
Also dann doch das Land zwischen den Meeren.
Ost- wie Westküste waren ihm von Besuchen her mehr oder weniger bekannt, aber eine Entscheidung zu treffen, wo man sich denn nun niederlassen solle, war doch etwas anderes. Ein spontaner Wunsch wollte angesichts der vermutlichen Endgültigkeit nicht aufkommen. Die Sachlage war aber nun mal entschieden, jetzt ging es um konkrete Schritte.
See wäre schön.
Ost oder West?
Also gut: West. Eine von den Inseln nach Möglichkeit.
Spiekeroog hatte ihm gefallen. Ausgedehnte, mit dunkler Vegetation bedeckte Dünenlandschaft, trotzdem übersichtlich, alles zu Fuß erreichbar. Eines der dort verstreut liegenden Häuschen wäre vielleicht denkbar.
Auch war ihm das Dorf interessant erschienen, die gemütlichen Häuser, die einfachen Wege. Er erinnerte sich an eine alte Kate mit breit ausladendem Dach. Im Gasthof gegenüber war zu erfahren, dass früher alle Häuser so gebaut wurden, um bei Sturmfluten Bewohner und Haustiere aufnehmen zu können. Falls das Wasser bis zum Giebel anstieg und die Lehmwände darunter einfielen, ließ sich der schwimmfähige Oberbau aus der Verkeilung lösen und trieb mit dem Wind auf das Festland zu. Ob die schwimmenden Dächer das rettende Ufer wirklich erreichten, ist nicht überliefert; man möchte eher befürchten, dass die wütende Brandung sie zerschlagen hat, wie es auch weit seetüchtigeren Fahrzeugen erging, die im Toben des Meeres vor der Küste scheiterten. So sei vor hundertfünfzig Jahren im Sturm ein Auswandererschiff bei Spiekeroog gesunken, wobei 8o Menschen den Tod fanden. Sie seien damals in den Dünen außerhalb des Dorfes beigesetzt worden, die Stelle hieße heute noch Drinkendodenkarkhoff, Friedhof der Ertrunkenen.
Könne man sich ansehen, hatte der Kneiper gesagt, solche Katastrophen wären früher keine seltenen Ereignisse gewesen. Inzwischen verfüge man aber über ausreichende Schutzmaßnahmen.
Doch, dort zu bleiben konnte er sich vorstellen.
Wie stand es mit den Immobilien? Er fand kein Angebot nach seinem Geschmack, doch unglaubliche Preisvorstellungen. Man müsste wieder hinfahren um Näheres zu erkunden. Erst mal weiter.
Zu den Halligen im Wattenmeer?
Das nun doch nicht. Dann schon lieber Sylt, wo ebenfalls Landschaft war.
Mode-Insel, überlaufen, nichts für ihn.
Die Nordseeküste zog ihn nicht wirklich an, die Küste im Osten kannte er besser, sie lag näher und wurde fast als Naherholungsgebiet betrachtet. In jungen Jahren war er beiderseits der Schlei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. An die kleinen Dörfer erinnerte er sich gerne. Sie waren aber nach und nach „modernisiert“ worden, und dabei hatten sie ihren ursprünglichen Charakter weitgehend verloren. Arnis zum Beispiel kannte man nach den Eingriffen kaum wieder.
Vielleicht war Kappeln an der Mündung der Förde davon verschont geblieben.
Auch Eckernförde wäre möglicherweise etwas, der Ort erinnerte an das abwechslungsreiche Stadtbild von Bergen auf Rügen.
Doch Städte waren nicht, was er eigentlich suchte.
Rügen! Wieso war er nicht gleich darauf gekommen? Auf Rügen kannte er sich doch aus. Dort schien alles so selbstverständlich wie zu Hause, vielleicht hatte er gerade deshalb nicht daran gedacht. Wenn man Urlaub machte, fuhr man nach Rügen.
Er erinnerte sich noch deutlich an den ersten Besuch, in einem Winter voller Verzweiflung; eine ernst gemeinte Beziehung hatte sich als nicht genügend belastbar erwiesen und war gerade zerbrochen. Er hatte seine Anstellung beim „Holsteiner Courier“ aufgegeben und einfach den Nachtzug nach Lauterbach bestiegen. Was er dort wollte, wusste er auch nicht. Lauterbach war wenigstens die Endstation von irgendwas.
Aus der Reiseerinnerung erwuchs Gewissheit – er musste nach Rügen, dort könnte er vielleicht am ehesten etwas finden. Und war es jetzt nicht eine ähnliche Situation wie damals, auf der Suche nach einem Neubeginn?
Er ging zum Bahnhof und stieg kurz entschlossen in einen Zug der gerade nach Stralsund wollte. Von dort war es einfach, einen beliebigen Ort auf der Insel zu erreichen.
In Binz nahm er die Bäderbahn. Er hoffte, so einem Ziel am ehesten näher zu kommen, denn das Bähnlein zuckelte gemächlich durch die interessanteste Gegend der Insel und berührte die wichtigsten Ferien- und Badeorte.
Der Traditionszug, von den Urlaubern „Rasender Roland“ genannt, war die Schmalspurausgabe einer wirklichen Eisenbahn. Der ganze Betrieb wurde von Enthusiasten in Bewegung gehalten, die fortgesetzt mit der längst überholten Technik zu kämpfen hatten. Die nostalgischen Dampfesel behaupteten dennoch den ersten Beliebtheitsplatz; kein Fotoapparat kam ohne Aufnahme an den dampfenden, schwitzenden, gusseisernen Veteranen vorbei.
Herr Kleinermann erstieg einen der hochbeinigen Waggons, dessen Abteil sich als fast leer erwies. Er wählte einen Fensterplatz, um Gegend und Treiben im Blick zu halten, doch ereignete sich so gut wie nichts vor ihm. Dass ein Bahnhof derart tief in Schlaf gesunken sein konnte, kam ihm fast unwirklich vor. Auch die weitere Umgebung schien erstarrt zu sein, nichts regte sich, kein Laut zeugte von einer nahen oder fernen Tätigkeit, selbst im Abteil stand die Zeit still. Man schreckte auf, wenn ein neuer Fahrgast zustieg, aber schon nach wenigen Augenblicken schien auch der eingeschlafen zu sein.
Herr Kleinermann war erleichtert, als der Gegenzug einfuhr und die Reise losging. Die betagte Lok schleppte sich mühsam, aber immerhin erfolgreich durch das ausgedehnte Waldgebiet der Granitz und hielt erst am Haltepunkt gleichen Namens, wo die wenigen Fahrgäste das Abteil und Herrn Kleinermann verließen, um wie er wusste, das ehemalige Jagdschloss der Putbuser Herrschaft auf dem Tempelberg zu besichtigen. Der Bau war eine der Inselattraktionen.
Er blieb sitzen und wandte sich wieder der Betrachtung aus dem Fenster zu. Das Gebäude für den Bahnwärter schien unbewohnt, daneben träumte ein Holzschuppen im Unkraut vor sich hin. Aber Moment mal, – hier war doch etwas …, er wollte schon aussteigen, aber in dem Augenblick stieß die Lok ihren kurzen Pfiff aus und setzte sich in Bewegung. Sie hielt erst zwei Stationen weiter. Sellin.
Er stieg aus, denn er sah auch hier, was ihn schon beim Halt zuvor so angesprochen hatte: Die nostalgischen, einfachen Bahnbauten im Stil der Jahre um 1900 aus dunkelgrün gestrichenem Balkenwerk und Füllungen von unverputzten roten Klinkern im Kleinformat.
Das war möglicherweise, was er suchte, ohne davon zu wissen: Ein gut erhaltenes kleines Bahnwärterhäuschen. Der Aufenthalt weckte Erinnerungen aus Kinderjahren. Er ging umher wie auf Wolken. Alles stand da: Das Hauptgebäude mit dem Aufenthaltsraum für die gewöhnlichen Reisenden, der Fahrkartenschalter, dessen kleines Fenster immer mit einem bunten Tuch verhängt war, daneben der Eingang zur Bahnhofsgaststätte für die Anspruchsvolleren unter den Wartenden.
Der früher übliche schmale Anbau für Stückgut und Gepäck diente hier anderen Zecken; die Laderampe hatte sich in ein großes Blumenbeet verwandelt und die schwarzen Schiebetore in blanke Fenster und einen weiteren Eingang; die frühere kleine Bahnhofsgaststätte erglänzte nun als attraktives Restaurant im nostalgischen Rahmen. Überall standen, saßen, bewegten sich ferienfrohe Menschen im weichen Licht des Sommernachmittags.
Herr Kleinermann war von der Entdeckung sehr beeindruckt, doch herrschte ihm hier eindeutig zu viel Gewusel.
Er musste auf weitere Erkundungen verzichten, der Gegenzug kündigte sich bereits an und fuhr bald mit reichlich Qualm und Gebimmel ein. Die Menge ordnete sich und sah dem Ereignis gebannt entgegen. Die kleine Lok schleppte die lange Wagenreihe unter ständigem Bimmeln langsam heran und pustete dabei Dampf nach allen Seiten. Einige Urlauber missdeuteten den offenbar betont vorsichtigen Einzug und wagten sich mit ihren Kameras bis dicht ans Gleis, sie ignorierten sogar den Versuch des Lokführers, der sich aus dem Fenster des Führerstands beugte und sie mit energischen Handbewegungen versuchte aus dem Weg zu scheuchen. Endlich stoppte der Einzug und die Leute stürmten die Abteile.
Wie selbstverständlich und ohne nachzudenken stieg auch Herr Kleinermann ein, er suchte nicht erst einen Sitzplatz, da er beim zweiten Halt wieder aussteigen wollte.
Er war er der einzige Reisende, der am Haltepunkt Granitz den Zug verließ.
Weit und breit sah er kein weiteres Gebäude als das Bahnwärterhäuschen und den Geräteschuppen, etwas weiter ab noch die ehemalige Bedürfnisbude.
Das Ensemble wollte ihm wie ein Geschenk vorkommen, als ob die verlassene Station ihn seit Jahren erwartete hätte.
Die Natur war bereits weitgehend im Besitz der Anlage. Doch dagegen ließe sich etwas tun, er konnte und würde etwas dagegen, oder richtiger, dafür tun, dass sein Haus wieder – hier besann er sich und kam auf den Boden der Tatsachen zurück.
Er versuchte durch die blinden Fensterscheiben den Innenzustand des Hauses zu erkennen. Der Dienstraum zeigte, dass er bis auf einige technische Reste, wahrscheinlich Verankerungen der ehemaligen Bedienanlagen, nur leer sei. Das Wohnzimmer lag hinter dem kleinen Fenster fast ganz im Dunklen, ein Tisch, eine Stuhllehne, das war fast alles, was er ausmachen konnte, eine Ahnung von Kanonenofen, doch keine weiteren Einzelheiten.
Das erinnerte ihn an die unbedingte Notwendigkeit, noch vor Dienstschluss bei der Bahnhofsverwaltung in Putbus vorzusprechen.
Er hatte den Ort seiner endgültigen Bestimmung gefunden.
An die Möglichkeit, dass seinem Vorhaben noch andere als nur zeitliche Schwierigkeiten entgegenstehen könnten, dachte er überhaupt nicht.
Er schritt Länge und Breite des Häuschens ab und versuchte die Innenaufteilung von drei mal sechs Metern Grundfläche zu erraten. Das Dienstzimmer schien ein vorgezogener Flachbau zu sein.
Angenommen, es wäre ein Standardtyp von Bahnwärterhäuschen, dann könnte man doch den einfachsten, rationellsten Grundriss erwarten, also innen zwei tragende Wände, was im Prinzip vier Räume ergäbe. Und unabhängig von der bisherigen Nutzung ließen die sich …
Ein Zugsignal ließ ihn aufhorchen. Wo kamen denn plötzlich diese Leute her?
Sie standen am Bahngleis und blickten alle in die gleiche Richtung.
Ah, der Zug, sagte sich Herr Kleinermann. Er müsse hier abbrechen.
Er stellte sich zu den anderen. Aber blickten nicht alle in die falsche Richtung?
Als die Dampfwolke über den Bäumen erschien, fragt er den nächststehenden Urlauber nach dem Fahrziel dieses Zuges.
„Nach Göhren, nehme ich an. Wir wollen aber nur bis Baabe, wir machen dort Urlaub. Wir waren heute oben im Schloss, also vom Turm hat man ja eine fabelhafte Aussicht über ganz Rügen. Sind Sie auch die Wendeltreppe hoch?“
„Nein, ich bin in der Gegenrichtung unterwegs, ich wollte nach Putbus.“
„Das ist erst der nächste“ – der Urlauber schaute auf die Uhr – „na, ’ne gute halbe Stunde, würde ich sagen, die verkehr’n hier im Gegentakt, wissen Sie.“
Herr Kleinermann konnte sich für die Auskunft nicht mehr bedanken, der Zug lief mit Getöse ein und die Leute gerieten in Bewegung.
Er ging nicht zum Haus zurück; die verbleibende Zeit wollte er zur Erkundung der nächsten Umgebung nutzen, wenn dort auch kaum etwas auf seine Entdeckung zu warten schien. Als er den Weg erreichte, der über die Schienen in den Wald lief, blieb er stehen und schaute sich um. Hier hatten früher gewiss Schranken dem Verkehr Einhalt geboten, wenn ein Zug kam. Der Weg war breit genug zu jeder Versorgung des Schlosses weiter oben. Woher mochte die staubige Straße kommen?
Sie eilte in Begleitung alter Alleebäume auf die Chaussee Bergen – Thiessow zu. Linker Hand versteckten sich unterhalb „seines“ Häuschens einige Gebäude im Grünen.
Er ging sehr befriedigt zurück: Alles war geradezu ideal hier.
Die Verhandlungen mit der Verwaltung der Bäderbahn waren bald abgeschlossen.
Herr Kleinermann ließ keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit aufkommen, er nahm die Verwaltung im Sturm, nämlich mit der Andeutung, dass Geld hier keine Rolle spiele. Ein Kauf war allerdings nicht möglich; man einigte sich auf eine unbefristete Nutzung unter Auflagen zum denkmalgerechten Erhalt. Der Innenzustand war auf eigene Kosten wieder bewohnbar zu machen.
Fünftausend Euro Zuwendung „für die Bediensteten“ hatten die Angelegenheit wirksam beschleunigt.
Schon nach einem viertel Jahr konnte er einziehen.
Er schaute aus dem Fenster, ob der 11.58 aus Göhren heute pünktlich sei. Über der Bahnstrecke im Wald stand ein weißes Wölkchen und er hörte das ferne Rattern des Zuges. Er sah auf die Uhr: Zwei Minuten Verspätung. Vor der Kurve zum letzten Anstieg stieß die Lok ihren Pfiff aus. Jetzt musste der Heizer Kohle schaufeln. Die weiße Dampfspur über den Bäumen verwandelte sich in dicken grauen Qualm, unter dem das Bähnlein als ein Spielzeug sichtbar wurde. Die Maschine keuchte mühsam die leichte Steigung heran und hielt schwer atmend vor Kleinermanns Fenster.
Drei Personen stiegen aus, eine Familie, die offensichtlich zum Schloss wollte. Sie gingen die Wagenreihe entlang, der Mann fotografierte die Frau und den Jungen vor der verschwitzten Lok. Dann überstiegen sie das Gleis und entschwanden.
Der Zugbegleiter blickte sich um, hob den Arm, bestieg mit elegantem Schwung die letzte Wagenstufe, der Zug setzte sich unter Dampf und Qualm mühsam wieder in Bewegung. Als das Ende vorüber rollte, grüßte der Schaffner mit einer leichten Handbewegung zum Fenster, Herr Kleinermann deutete eine leichte Verbeugung an.
Dieses Szenario wiederholte sich in mehr oder weniger abgewandelter Form mehrmals täglich. Oft stiegen ganze Scharen von Feriengästen aus oder ein, es kam auf die Tageszeit an. Alle wollten zum Schloss hoch oder waren von dort zurückgekehrt.
Er wandte sich wieder seiner Beschäftigung zu.
Natur und Mensch, oder Mensch und Natur, das war doch wohl das wirkliche Thema. Konkreter hätte er es nicht formulieren können. Stand dabei nicht schon im Voraus fest, dass damit nie ein Ende zu erreichen sein würde?
Aber immer wieder fing jemand damit an. Jeder Pinsel, der an dem Bild vom Menschen im Universum herummalte, meinte, es müsse noch deutlicher werden, es stimme so ja nicht. Und mancher kam und malte einfach was drüber, als müsse auch das so sein. Irrtümer verschwanden unter neuen Farbschichten. Manchmal hielten sie sich lange, weil ihr Anblick schon zur Selbstverständlichkeit geworden war. Das Bild konnte stimmen, aber auch ganz anders sein. So geriet das Gemälde immer verworrener. Bald malte jeder, der auf sich hielt, auch an einer eigenen Version von der kosmischen Vielfalt.
Herr Kleinermann hielt erschrocken inne – hatte er etwa sich selbst gemeint? Er wollte kein neues Bild, er wollte nur wissen, ob die letzte Fassung, die wissenschaftliche, die überwiegend aus Formeln und Zeichen bestand, wirklich zuträfe.
Waren mathematische Modelle wirklich geeignet, die Realität abzubilden?
Die Forschung konnte ohne die beschwerliche Realität im Abstrakten größere Schritte machen, also war Mathematik zur ersten und besten Stütze Wissenschaft aufgestiegen.
Aber auch Beobachtungen mit immer besseren Geräten förderten spektakuläre Ergebnisse zu Tage. Alles schien zum Beispiel doch darauf hinzudeuten, dass man bei kosmischen Dingen mit der Urknalltheorie auf dem richtigen Weg sei.
Das Universum sollte nun doch aus dem Nichts hervorgegangen sein. Nicht ganz so wie im Schöpfungsbericht der Bibel, aber fast so. Es war ja möglich oder fast sicher, dass unbekannte Teilchen und seltsame Energieformen das Universum erfüllten. Warum sollten sie sich nicht „irgendwie“ zu stofflicher Materie verdichtet haben? Auf dem Papier ging es doch auch.
Schon möglich, aber überprüfbar war das nicht. Es war im Grunde so viel Glauben an die wissenschaftliche Weltanschauung erforderlich wie zuvor an die metaphysische.
Herr Kleinermann war mit seinen Gedanken allein.
Nicht dass beim Urknall etwas geknallt hätte, sinnierte er, das sei nur so ein Wort für die erste denkbare physikalische Erscheinung des Universums, ein Zustand unendlich hoher Energie und Dichte, hieß es. Die Temperatur habe bei 10 32 Grad gelegen, eine mit keinem Wort zu benennende Zahl. Wenn die Dichte unendlich gewesen sei, müsste das Volumen gegen Null gehen. Das ging aber beides nicht. Hier verweigerte selbst die Mathematik ihre Dienste.
Aber woher wollte man darüber etwas wissen? Messen ging ja nicht. Er wälzte Bücher, befragte das Internet. Überall nur der gleiche Unsinn. Das ganze Szenario erschien ihm als Ausgeburt einer krankhaften oder krampfhaften Fantasie.
Er beschloss, persönliche Auskunft bei WISSENlive einzuholen, obwohl der Luxus von drei Minuten individueller Auskunft nicht gerade billig zu haben war.
Eine gewinnende Frauenstimme begrüßte ihn.
Willkommen bei WISSENlive direct.
Wählen Sie ein Fachgebiet und geben Sie ihre Frage oder das Problem ein.
Er wählte – Physik – Urknall –Temperatur– woher?
Der Monitor dunkelte ab und Sterne erschienen. Aus der Tiefe entstand ein Objekt, kam näher und wurde zum Gesicht.
Ganz einfach, sagte der Experte auf dem Bildschirm unvermittelt, das ergibt sich aus der Theorie.
Ja, aber wie denn.
Im Anfang war alles anders. Keine Materie, nur Energie, ein ungeheurer Strahlungsausbruch zur Geburt von Zeit und Raum, in Bruchteilen von Sekunden entfaltete sich das Universum wie eine riesige Blume zu unendlicher Größe …
Hab’ ich auch schon gehört, mit Über-Lichtgeschwindigkeit. Gibt es gar nicht, sagt die gleiche Theorie. Aber was ist nun mit der erwähnten Über-Hitze von damals?
Die nahm mit der Ausdehnung natürlich rapide ab, eine tausendstel Sekunde nach Beginn der Ausdehnung betrug sie nur noch 10 hoch 13 Kelvin, das sind Zehnmilliarden Grad. Und nach einer Sekunde war sie sogar auf Zehnmillionen Grad gesunken, also 10 hoch 7 Kelvin. Unter diesen Bedingungen nahm die Energie neue Formen an, die Urkraft spaltete sich in die heutigen Grundkräfte auf und Strahlung verdichtete sich zu Materie, die ersten Atome entstanden.
Aber erklären Sie doch mal, woher Sie die Zahlen nehmen.
Ganz einfach. Was geschieht im umgekehrten Fall, beim Erhitzen einer Substanz? Sie zerfällt, die Atome werden frei. Die dafür erforderliche Energie kann man messen, ebenso für den Zerfall in die Elementarbausteine. Kehrt man den Prozess um, ordnet sich alles wieder stufenweise zum Ausgangsprodukt. Man weiß also, bei welcher Temperatur sich zum Beispiel erst Atome gebildet haben können, und so weiter.
Das ist alles bekannt. Bestes Beispiel Sonne und so, klar. Aber es war ja die Rede von der ungeheuren Strahlungstemperatur, was nach der Definition von Temperatur als Bewegungsenergie von Teilchen einen Widerspruch darstellt, da gab es ja noch gar keine Teilchen.
Das ist richtig. „ Temperatur “ ist in diesem Zusammenhang als Zugeständnis an die Sprachgewohnheiten zu verstehen. In einem allgemeineren Sinn handelt es sich um die mittlere Energiedichte eines Systems. Die Angabe 10 hoch 32 Grad stellt die höchste Energiedichte dar, die physikalisch begründbar ist, man könnte sie auch in anderen Einheiten angeben, aber das wäre noch unanschaulicher.
Und wie begründet man diesen Wert vom Beginn unserer Welt?
Das ist eine längere Geschichte, sie reicht hundert Jahre und mehr zurück, wollen Sie sie wirklich hören?
Ich bitte darum. Aber kürzer, wenn’s geht.
Die Angabe beruht auf den so genannten Planck-Einheiten, die mit den drei Naturkonstanten Lichtgeschwindigkeit, Gravitationskonstante und dem elementaren Wirkungsquantum gebildet werden können. Je nach deren mathematischer Kombination erhält man ein universelles System aller physikalischen Größen ohne die willkürlichen Festlegungen aus der Vergangenheit.
Übrigens auch für den Begriff Zeit – bevor Sie danach fragen. Das würde jetzt zu weit führen.
Wahrscheinlich. Obwohl noch eine ganze Reihe anderer Fragen offenbleibt.
Ein anderes Mal gerne. Unsere Zeit ist bereits vorüber. Oder möchten Sie weitere Auskünfte? Dann drücken Sie bitte „f“ für fortsetzen.
Er zögerte. Das Gesicht versank langsam in den Tiefen des Alls, der Bildschirm erlosch.
Herr Kleinermann blieb etwas unzufrieden zurück, diese Auskunft hätte er sich eigentlich selbst beschaffen können.
Als Herr Kleinermann eines frühen Morgens wie zufällig zum Fenster blickte, sah er eine Person vor dem früheren Geräteschuppen stehen, ein schlecht gekleideter Mann von unbestimmtem Alter. Er streckte sich, blinzelte in die Sonne und kratzte sich am Kopf.
Herr Kleinermann machte das Fenster auf.
„Hallo, was machen Sie da?“
Die Person schaute erschrocken hoch und war dann blitzschnell verschwunden.
War da nun jemand gewesen oder doch nicht? Er schloss das Fenster und ging hinaus um nachzuschauen.
Der Schuppen war verschlossen wie immer, mit einem einfachen Riegel von außen. In dem Verschlag konnte er keine Veränderung entdecken, das Brennholz und der alte Trödel standen unverändert.
Seltsam, dachte Herr Kleinermann, er hatte doch ganz deutlich gesehen, wie jemand vor dem Schuppen stand.
Er nahm sich vor, die Sache im Auge zu behalten, harkte den Sand am Eingang, um eventuelle Spuren zu sichern, aber als sich die nächsten Tage nichts ereignet hatte, und der geharkte Sand schließlich von Wind und Wetter eingeebnet war, ohne je verräterische Fußabdrücke zu zeigen, vergaß er die Angelegenheit. Vielleicht war es eine Sinnestäuschung, dergleichen sollte ja vorkommen, zumal wenn man dauerhaft allein lebte, auch bestimmte Erkrankungen des Nervensystems könnten sich so oder ähnlich ankündigen, wusste er. Darin kannte er sich jedoch nicht weiter aus. Er sollte sich vielleicht informieren. Aber auch das vergaß er bald.
Doch als er nach geraumer Zeit aus irgendeinem Grund den Verschlag betrat, kam ihm darin etwas verändert vor. Er hätte nicht sagen können, was, aber es war, als hätte hier jemand Staub gewischt. Lagen sonst nicht immer einige Steinchen im Gang oder zufällige Holzsplitter?
Er suchte nach weiteren Veränderungen. In der Ecke fand er etwas, das sich als alte Decke erwies. Hatte das Bündel schon immer hier gelegen? Er konnte sich nicht erinnern, möglich schien es durchaus, er hatte nie auf solche Einzelheiten geachtet. Möglicherweise hatte hier aber auch ein Landstreicher genächtigt oder ein Obdachloser. Vielleicht jener Mensch von damals? Den gab es dann vielleicht doch?
Herr Kleinermann beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.
SIE MÜSSEN SICH NICHT VERBERGEN. SIE DÜRFEN HIER SCHLAFEN schrieb er in großen Buchstaben auf ein Blatt, das er in den Gang legte.
Am nächsten Tag schaute er nach: Alles war unverändert. Entweder war kein Gast erschienen, oder so spät, dass er den Zettel in der Dunkelheit übersehen hatte. Man müsste etwas erfinden, das die Anwesenheit einer Person unzweifelhaft beweisen konnte. Etwas Essbares schied aus, das würden auch Fuchs und Marder nehmen.
Ihm fiel ihm ein Trick a la James Bond ein: Ein Haar, das beim Öffnen der Tür zwangsläufig reißen musste. Aber woher nehmen? Er selbst hatte kaum noch welche, und was da eventuell stand, hatte er immer kurzgehalten. Aber er könnte einen dünnen Holzspan an die Tür lehnen.
Dann aber erschrak er vor sich selbst. Ging es hier etwa darum, ein wildes Tier zu fangen?
Er versuchte gar nicht erst, eine Rechtfertigung für seine Gedanken zu finden, er fühlte sich einfach beschämt. Der Zettel war ja bereits eine ungeheure Überheblichkeit – er erlaubte jemandem, im Abstellschuppen zu schlafen?
Er vernichtete das Blatt und formulierte neu: MAN DARF SICH HIER NATÜRLICH AUFHALTEN WENN MAN MAG und heftete es außen an die Tür. Alles andere überließ er fortan dem Lauf der Dinge. Er verbot sich, das Plakat überhaupt zu sehen, und nach einiger Zeit hatten Regen und Wind auch diese Botschaft mitgenommen, die Angelegenheit war erledigt.
Er ging weiter seinen Studien nach.
Das Elementarquantum war jetzt der Star? Nicht verwunderlich, wo alles mehr und mehr auf die Quantenphysik zusteuerte. Die hätte noch niemand verstanden, witzelten selbst die Erfinder über die eigenen Gedankenkonstruktionen. Aber Elementarquantum war einfach. Energie floss nicht gleichmäßig wie Wasser, sondern bewege sich nur in kleinsten Portionen, als „Quanten“. Das habe sich bei Untersuchungen von Vorgängen im subatomaren Bereich gezeigt. Im Normalfall merke man davon nichts, eine Physik auf der Basis von Elementarvorgängen sei für den Alltagsgebrauch nicht gedacht.
Wofür aber dann, wollte Herr Kleinermann fast fragen, besann sich aber, denn es ging ja um theoretische Aspekte, um ein Verständnis, um eine Denkmöglichkeit, wie die Weltuhr ticken könnte.
Es wären gerade die eingefahrenen Denkgewohnheiten, die zum Unverständnis mit den wissenschaftlichen Ergebnissen führten. Das hatte er oft gelesen, ohne es richtig aufzunehmen. Doch diese Weisheit war aus dem Leben gegriffen, sie musste also stimmen. Sollte nicht die Praxis Richtschnur aller Theorie sein?
Na schön. Dann hatte er in seinem Verständnis etwas nachzuholen.
Sein Interesse an den ersten Augenblicken des Universums war etwas gesunken. Bloßes Geschwätz, reine Konstruktion, fand er; auf solche Weise könne man sich allerlei zusammenreimen und als Tatsachen verkaufen. Beziehungsweise auch die Realität auf sonst was zurückführen und annehmen, die neue Theorie sei zutreffend, weil die weiter bestehende Praxis das beweise. Hier stimmte etwas nicht.
Auch die Lichtgeschwindigkeit habe bei der Höllen-Geburt eine Rolle gespielt? Wie das? Licht gab es damals doch gar nicht. Oder war alles wieder nur eine Definitionsangelegenheit und hatte mit Licht konkret gar nichts zu tun?
Er hätte vielleicht doch nach dem Beginn der Zeit fragen sollen, das hätte Zeit gespart.
Ha, Zeit sparen. Was sollte das nun wieder heißen, wenn es die „eigentlich“ auch nicht gab? Sollte er vielleicht nochmals bei WISSENlive direct anfragen? Dazu hätte man allerdings konkrete Fragen stellen müssen, nicht mit einem Durcheinander kommen.
Nein. Es gab Bücher, es gab das kostenlose Internet und man hatte einen Kopf, das sollte reichen. Experten live nur in unlösbaren Fällen, nahm er sich vor.
Wie kam er jetzt überhaupt auf Zeit? Hatte er darüber nicht genug gelesen? Das Kapitel war doch abgeschlossen.
Offenbar hatte er nichts verstanden. Oder nichts behalten, was im Endeffekt aufs Gleiche hinauslief. Er versuchte, sich zu erinnern: Der Begriff war mehrdeutig. Wie alles, an dem die Menschen schon Jahrhunderte herumrätselten, die einen sagten ja, die andern nein. Die Zeit existiere als Erfahrung, ließe sich als objektive, selbständige Erscheinung aber nicht fassen.
Die Relativitätstheorie ließ Zeit nur in der unlösbaren Verbindung mit dem kosmischen Raum als Raumzeit gelten, die auch gegen Null gehen konnte. In der Quantentheorie kam die Zeit überhaupt nicht vor.
Beide Theorien seien hundertfach geprüft und hätten sich stets als übereinstimmend mit der Praxis erwiesen, worauf zahlreiche technische Anwendungen beruhten, sie wären aber miteinander absolut nicht vereinbar, hieß es.
Die Einführung des mathematischen Konstrukts einer „imaginären“ Zeit hatte die Diskussion um den Begriff endgültig und erfolgreicherfolglos beendet. Den Trick hatten jedoch nur wenige verstanden. Er, Kleinermann, gehörte nicht zu ihnen, und danach hatte er sich um kein Verständnis der Zeit mehr bemüht.
Doch jetzt schien es wiederum, als ob die Zeit sehr wohl als eigene physikalische Größe definierbar wäre, man müsse nur die richtigen Beziehungen der drei Grundgrößen: Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit und dem Wirkungsfaktor h zueinander finden.
Er war wieder interessiert. Diesmal suchte er gleich an der richtigen Stelle: Planckeinheiten.
Er staunte nicht schlecht; Zeit hatte sich in einen komplizierten mathematischen Ausdruck verwandelt. Man sollte die Wurzel aus dem Produkt G mal h durch c3 ziehen. Mathe war noch nie seine Stärke gewesen, aber vor dieser Aufgabe kapitulierte er gleich. Wie jemand daraus die Zahl 5,39116 x 10-44 Sekunden zaubern konnte, blieb ihm ein Rätsel. Er suchte im Internet.
Das sei die kleinste denkbare Zeiteinheit, nämlich die Dauer, die das Licht zum Durcheilen der Planck-Länge brauche, die kleinste Zahl der Welt, die noch einen Sinn darstellen konnte. Er war beeindruckt.
Doch dann kamen ihm Zweifel; nicht am Ergebnis, aber die ganze Sache war ja reine Rechnerei, und zudem abseits vom Problem. Man hatte das kleinste Zeitintervall definiert, nicht die Zeit als solche. Wenn diese Angabe auch den ersten denkbaren Augenblick nach dem Urknall bezeichnen mochte, hieß das doch lediglich, dass ab hier das Zählen begann, und nicht, ob die Zeit eine unverrückbare, selbstständige Erscheinung sei. Zudem begann die Zeit entgegen jeder Erwartung nicht bei Null, sondern schon mit einem Zahlenwert? Sollten die verwendeten Konstanten überhaupt in den Beziehungen zueinanderstehen, wie sie hier verwendet wurden? Einen physikalischen Sinn konnte er darin nicht erkennen, außer dass die gewaltsame Operation am Ende formal die Einheit „Sekunde“ ergab.
Das sei alles Unsinn, meinte er.
Er suchte weiter. An anderer Stelle entdeckte er eine einfachere Gleichung für die elementare Zeit: Zeit wäre Planck-Länge durch Lichtgeschwindigkeit. Ohne Potenzen und Wurzel. Inhaltlich war das identisch, sah aber einfacher aus. Das entsprach der bekannten Formulierung aus dem Physikunterricht: Zeit ergibt sich aus der zurückgelegten Wegstrecke dividiert durch die Geschwindigkeit der Bewegung. Wer 100 km mit durchschnittlich 50 Sachen fahren will, braucht dazu 2 Stunden. Lernte man bereits in Klasse sieben.
Jetzt musste er doch lachen. Weiter war die Physik nicht gekommen? Zeit wäre nur über Geschwindigkeiten zu definieren? Das war ja ’n alter Hut. Dann wäre Zeit nur ein Begriff zur Beschreibung von Bewegungen oder Veränderungen? Das bedeutete doch: Wo keine Bewegung, da keine Zeit.
Die Planck-Einheiten erklärten nichts, fand er, sie zeigten lediglich die Denkbarkeit physikalischer Größen auf der elementarsten Stufe. Einen Realitätsanspruch hatten die Werte nicht, sie lagen Meilen weit außerhalb einer Überprüfbarkeit. Außerdem erweckten sie den Eindruck, als hätten unsere Begriffe aus der Mechanik, wie Masse, Länge oder Geschwindigkeit im Bereich des Wirkungsquantums eine Bedeutung.
Herr Kleinermann erschrak etwas bei dieser Bewertung. Er war ja keineswegs in der Lage, die Rolle der Planckgrößen für die wissenschaftliche Arbeit umfassend einzuschätzen. Aber wer dort tätig sei, sollte vielleicht auch mal an die Verwirrung denken, die das uferlose Mathematisieren bei manchem normalen Menschen auslösen konnte, fand er. Hätte ein Normalo kein Recht darauf, verstehen zu wollen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“? Sollte sein Interesse dabei weniger gelten als das der Spezialisten? War die Wissenschaft nicht für den Menschen gedacht?
Bei unvoreingenommener Betrachtung sei alles „ganz einfach“, wie jener Experte sich ausgedrückt hatte: Die Relativitätstheorie erforschte die kosmischen Verhältnisse, die Quantenmechanik die Elementarvorgänge im submikroskopischen Bereich, beides wären Aspekte des Naturgeschehens und könnten nur zusammen ein Bild abgeben.
Aber die Forscher waren offenbar gegen diese Sicht; die eine Art Mathematik passe nicht zur andern, nein, absolut nicht, der gegensätzliche Formelkram ließe sich nicht unter einen Hut bringen, und was man damit jeweils entschlüsselt habe, noch viel weniger. Es müsse eine neue Theorie her, eine, die alles erklären könne, eine, die zur Weltformel führe.
Daran glaubten offenbar selbst Nobelpreisträger ernsthaft.
So etwas gibt es nicht auf dieser Welt, sagte sich Herr Kleinermann; eine einzige Theorie sollte die ganze Welt erklären können?
Er redete mit sich selbst.
Änderten sich die Bedingungen, änderten sich auch die Erscheinungen. Die Stufen der Entwicklung sind jeweils neue Qualitäten. Das wusste er noch von früher.
Die gleichzeitige Sicht auf „alles“ ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hatten jene Genies davon nichts gehört? Sie hätten selbst darauf kommen müssen, ihre eigenen Forschungen legten den Schluss doch nahe.
Er resümierte nochmals für sich selbst: auf der Erde herrschten Bedingungen, die es erlaubten, den Erscheinungen und Beziehungen eine konkrete, überschaubare Form zuzuordnen. Was die Festsetzungen Newtons auch zutreffend abbildeten.
Im Kosmos herrschten Unendlichkeiten, eine ganz andere Realität, und lange versagte der Versuch, mit herkömmlichen Mitteln einen verständlichen Eindruck davon zu gewinnen. Erst die Einstein’sche Relativitätstheorie schien den Verhältnissen angemessen. Das Alltagsverständnis blieb davon allerdings überfordert, nur durch langsame Gewöhnung an die Aussagen war auch beim Laien eine gewisse Akzeptanz erreicht worden.
Der Blick auf die subatomaren Zustände habe dann neue Verwirrungen ausgelöst, weil man vor völlig unerwarteten Erscheinungen stand; konkrete Beziehungen lösten sich auf, nichts schien mehr greifbar. Um diese Verhältnisse abzubilden, musste man neue, und dem Laien noch unheimlichere mathematische Wege beschreiten. Von einem Verständnis war nun gar keine Rede mehr.
Die Tatsachen zeigten jedoch unbestechlich das Gesetz der Natur: Wechsel der „Bewegungsform der Materie“ bedeutete Veränderung ihrer Erscheinungen. Das zu erkennen bedurfte es eigentlich keiner Philosophie, es sei einfach logisch, fand er.
Aber eine verallgemeinernde Betrachtung der Naturprozesse, um deren Komplexität als „Einheit von Widersprüchen“ zu erkennen, wäre dabei unverzichtbar.
Die naturwissenschaftliche Methode, die Erscheinungen ohne alle störenden Einflüsse zu studieren, konnte nichts anderes als nur isolierte Beziehungen zeigen, während doch die ganze Wirklichkeit einem universalen Zusammenhang und Wandel unterlag.
Wo war er stehengeblieben?
Ach so. Ja, die Planck-Einheiten. Vermutlich alles Unsinn, was sollte Lichtgeschwindigkeit zur Potenz genommen bedeuten? Er erinnerte sich, dass er darüber ins Philosophieren geraten war – ein unerfreuliches Thema.
Naturwissenschaft und Philosophie gingen selten Hand in Hand, man könnte fast meinen, zwischen ihnen bestehe ein grundsätzliches Misstrauen. Sehr zum Nachteil beider, wie sich in der Hoffnung auf eine Weltformel zeige. Die gegenwärtige Philosophie hatte weder am Höhenflug der Kosmologie teilgenommen, noch an der Suche nach dem Allerkleinsten; möglicherweise wusste sie von den Problemen überhaupt nicht.
Was er sich da als Laie an Philosophie zusammenreimte, stammte aus Erkenntnissen, die über hundert Jahre alt waren. Kant, Hegel, Marx, Engels. Dialektik. Wer interessierte sich noch dafür?
Sein Interesse am Weiterspinnen war erloschen, er dachte an ein Mittagessen. Er hätte den Zug nehmen sollen, zwei Stationen weiter zum Chinesen vielleicht. Oder auf den Gegenzug in einer guten halben Stunde warten. Dort gab es im Bahnhofslokal Sellin immer etwas. War aber gewiss auch voll um diese Zeit, die Badegäste belagerten die Gaststätten ja wie die Fliegen.
Er überflog wieder seine Notizen. Die Zeit, ja-ja. Und die anderen elementaren Festlegungen. Interessant, nicht mehr. Aber hier – er hatte doch die Temperatur vergessen, deren absoluter Höchstwert 1032 Grad sein sollte. Wie kam man darauf, was hatte der Experte eigentlich gesagt?
Wieso ergab die Kombination der Elementarkonstanten in diesem Fall einen Maximalwert, während diese Definitionen sonst immer die denkbar kleinsten Werte darstellten?
Er war mit sich selbst unzufrieden. Was wollte er nur!