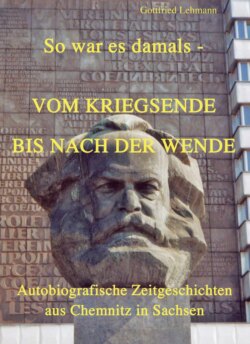Читать книгу Vom Kriegsende bis nach der Wende - So war es damals - Gottfried Lehmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWir hatten Hunger
Das größte Problem war der Hunger, wir Kinder, aber auch die Mütter waren nie satt. Wenn man von Helden spricht, sollte man nicht die Leistungen der Mütter während des Krieges und nach dem Krieg nicht vergessen. Sie waren mit ihren Sorgen und Kindern allein und unsere Mutter gehörte dazu. Was gebe ich meinen Kindern in den nächsten Tagen zu essen, war ihre größte Sorge. Man müsste eigentlich den Kriegs- Müttern auch mal ein Denkmal setzen.
Natürlich gab es große Unterschiede bei der Verpflegung der Menschen. Kein Bauernkind musste hungern und keiner konnte damals eine gerechte Verteilung bewirken.
Unsere Schwester Elfriede, im Februar 1945 geboren, wurde ein ganzes Jahr gestillt. Weil es später da zeitweise nur Mehlbrei für das Kind gab, hat ein Arzt in der Winterzeit unserer Mutter den Rat gegeben, geringe Mengen geriebene rohe Kartoffeln in den Mehlbrei zu mischen. Die darin vorhandenen Nährstoffe sollten den Kind zu gute kommen.
Um überleben zu können, mussten wir alle auf den nah liegenden Feldern Ähren lesen und Kartoffel stoppeln. Das heißt, die abgeernteten Felder wurden nochmals von der Bevölkerung nach Getreideähren und Kartoffeln durchsucht. Wegen der großen Lebensmittelknappheit fuhren die Bauern aber mehrmals mit einem, vom Pferd gezogenen Reschen über die Äcker, um so wenig wie möglich Verluste für sich selbst zu haben. Es blieb also nicht mehr viel übrig. Trotzdem warteten hunderte Menschen am Feldrand, bis das Feld vom Bauer “freigegeben“ wurde. Die losen Ähren kamen in eine Klammerschürze und die noch mit Halm hielt man wie einen Strauß in der Hand. Über die Felder, mit den harten Strohstoppeln, wurde nur barfuss gelaufen, auch bis zu den ersten Bodenfrost, es gab ja keine Schuhe.
Wir Kinder hatten uns daran gewöhnt und sehr dicke Hornhaut an den Fußsohlen bekommen. Die Ähren kamen in einen Sack, wurden getrocknet und später gedroschen, bis die Körner heraus fielen. Beim Roggenkorn musste man darauf achten, dass man das giftige Mutterkorn aussortieren musste und nicht mit verwenden darf. Die Körner haben wir dann, bei leichtem Wind, schüttend zwischen zwei Schüsseln, spelzenfrei geblasen. In einer kleinen Schrotmühle wurde das Getreide danach grob gemahlen und irgendwie in der Küche verwertet. Als Kinder haben wir gern Weizenähren ausgepult, die Körner gekaut ohne sie hinterzuschlucken, und das mehrmals hintereinander. Danach entstand ein zäher Brei, das war unser selbst gemachter Kaugummi. In der Landwirtschaft war damals alles noch ganz einfach, die heutigen Mähdrescher gab es noch gar nicht. Gemähtes Getreide wurde mit Stroh zu Garben zusammen gebunden. Diese Garben hat man dann zu Puppen auf den Feldern zusammengestellt. Die Puppenfelder sahen besonders aus der Ferne, wunderschön aus. Auf den Feldern standen damals auch Vogelscheuchen um bestimmte Saaten und reifes Getreide vor Vogelfraß zu schützen. Es waren angezogene mannsgroße Puppen mit Hut und ausgebreiteten Armen und es gab noch viele blaue Kornblumen und roten Mohn zwischen den Getreidehalmen, die man am Feldrand bewundern konnte. Erst nach entsprechender Trockenzeit und den richtigen Wetter wurden die Getreidepuppen zum Körnerausdreschen, mit einem Pferdegespann und den hölzernen Erntewagen in die Scheune gefahren. Erst später, nach der Erntezeit, wurde mit einer Riemenscheibe am Traktor und einen langen Flachriemen die Dreschmaschine angetrieben. In dieser Zeit bekamen die Hühner nichts zu fressen, im Umfeld der Dreschmaschine lagen genug Körner zum aufpicken als Nahrung, das wusste der Bauer.
Die Bauern waren in dieser Zeit sehr unbeliebt, man hatte das Gefühl, die Notlage der Menschen wird ausgenutzt. Die hungernde Bevölkerung musste beim Betteln ihre Wertgegenstände gegen Lebensmittel tauschen. Züge der Bahn in ländliche Richtungen waren voll mit Rucksackfahrgästen zur Lebensmittelbeschaffung, man nannte das Hamstern fahren.
Onkel Paul kam aus der Gefangenschaft relativ schnell zurück. Als ortsbekannter Nazi wurde er sofort von den Russen geholt. So nannte man damals die begründete oder unbegründete Verhaftung von der Besatzungsmacht oder irgendeiner Hilfspolizei. Die Verwanden wurden nicht unterrichtet was mit den Menschen geschah. Das konnte eine kurze Zeit sein oder auch eine jahrelange Verschleppung zur Zwangsarbeit nach Russland bedeuten.
Aus dem Ort der Verhaftung konnte er nach den Westen Deutschlands fliehen. Es war nachts, als er vorher nochmals nach Hause kam. Alles war geheimnisvoll und die Nachbarschaft durfte es nicht erfahren und wir Kinder hatten absolutes Sprechverbot. Später bekam Tante Elly von Ihrem Mann aus dem Westen regelmäßig Päckchen mit harten Brotresten geschickt, manche aber auch verschimmelt. Auch Erbsen und Bohnen lose im Karton, kann ich mich erinnern.
Von den Brotresten bekam unsere Mutter auch etwas ab, trotz der getrennten Küche der beiden Frauen. Es wurde davon Brotsuppe gemacht.
Die zugeschickten Erbsen und Bohnen wurden zwischen den Familien nicht geteilt. In den Bohnen- und Erbsentopf der Tante Elly habe ich, wann es ging, verbotenerweise und mit sehr schlechtem Gewissen, öfters mal mit meinem Löffel reingelangt.
Im Haus gab keinen Gasanschluss und eine alte elektrische Kochplatte war defekt. Dann hat unsere Mutter ein Bügeleisen verkehrt herum in einen kleinen Topf gehangen und als Heizplatte für Kinderbrei und Babymilch genutzt.
Der von Hand betriebene Fleischwolf war das kleine Küchenwunder, um alles Grüne essbar zu machen. Die Strünke vom Kohlgemüse wurden auch gegessen, sie waren so hart, dass einer den Fleischwolf gedreht hat und zwei Personen mussten den Tisch halten. Es wurde alles gegessen, Gartenmelde, Löwenzahn, Brennnessel und auch viel mir unbekanntes Unkraut. Viele Jahre später schmeckte mir immer noch kein Spinat.
Damit diese schlimme Zeit nicht vergessen wird, schrieb unsere Mutter diesen treffenden Satz in einem mahnenden Gedicht nieder:
„und wie wir uns vom Grünen ernährt, fast wie das Vieh,
das meine lieben Kinder, das alles, vergesst es nie!“
Die Nutzung des 1000 qm großen Siedlungsgartens war sehr wichtig und überlebensnotwendig. Meine Mutter sagte mir einmal später, mein Wissen, was ich mir mit dem Lesen eines Gartenbuches angeeignet habe, hat uns vielleicht das Leben gerettet. Um auch die noch vorhandene Wiese für den Lebensmittelanbau nutzbar zu machen, mussten die großen Jungen Armin und Siegfried die Wiese rigolen. Das heißt, zwei Spaten tief umgraben, um den verdichteten Boden zu lockern und danach Kartoffel zu legen. Weil jede Kartoffel kostbar war, wurden die Knollen je nach Keimlage halbiert geviertelt und danach auch nur noch die Keime gelegt. Irgendjemand hatte die Erdarbeiten beobachtet und erstattete eine Anzeige, wir hätten Waffen vergraben. Als die Hilfspolizei deshalb zu meiner Mutter kam und danach graben wollte, ist sie wütend geworden. Sie hat den Hilfspolizisten entrüstet und verärgert gesagt, sie können nach den Waffen suchen und im Acker danach graben so tief wie sie wollen, aber erst, wenn die gelegten Kartoffeln reif und geerntet sind. Das hat die Leute beeindruckt und sie sind nie wieder gekommen.
Zigaretten und Tabak waren sehr gefragte Waren auf dem Schwarzmarkt. Wem genug Gartenland gehörte und wer genug zu essen hatte, baute auch zum Eigenbedarf und als Tauschmittel Tabakpflanzen an. Die Blätter wurden getrocknet und geschnitten in der Pfeife geraucht oder selbst gedrehte Zigaretten daraus hergestellt.
Für den Gemüsegarten waren die Ausscheidungen der Pferde, also die Pferdeäppel als Dünger wichtig. Mit Schaufel und Besen wurden sie noch viele Jahre von der Straße geholt.
Um gepflanztes Kohlgemüse vor dem Raupenfraß zu retten, mussten wir Kinder die Raupen mit der Hand ablesen, es waren damals ungewöhnlich viele. Wir bekamen für 100 Stück Raupen zur Belohnung eine trockene Schnitte. Unsere Schwester, noch ganz klein, half auch mit. In ihren kleinen Händchen waren die Kohlweißling Raupen nur noch grüner Matsch.
Um etwas mehr Nahrung zu haben, hat man natürlich auch versucht, trotz des Verbotes, Feldprodukte zu stehlen. Auf dem Schulweg musste ich immer an einem Futterrübenfeld vorbei. Ich wollte auch meinen Beitrag zur Ernährung leisten und der Mutter eine große Rübe bringen. Die sehr festsitzende Rübe habe ich mehrmals, immer beim täglichen Vorbeigehen, mit dem Fuß locker gestoßen. Als die Rübe endlich locker war, bin ich dann bewusst hingefallen und habe die Rübe in eine Tasche gesteckt, ich musste vorsichtig sein, weil man das Feld von der Siedlung einsehen konnte. Ich war stolz, diese Rübe bei der Mutter abliefern zu können. Sie hat dann eine Futterrübentorte gebacken. Heute würde man so etwas nicht mehr essen. Bei Felddiebstahl wurde die Lebensmittelkarte weggenommen. Das war damals die schlimmste Strafe, der Flurschutz, eine Hilfspolizei, wachte darüber.
Auf unserer Straße standen viele Apfelbäume. Aber nur das Aufheben von Fallobst war erlaubt. Mein Cousin Armin und mein Bruder Siegfried haben nachts, vom verdeckten Garten aus, Holzknüppel in die Bäume geworfen und am nächsten Tag das gefallene Obst aufgelesen.
Um die knappen Lebensmittel einigermaßen gerecht zu verteilen, gab es damals nur örtlich gültige Lebensmittelmarken und nur unregelmäßige Sonderzuteilungen auf bestimmte Abschnitte der Lebensmittelkarte.
Ein heißer Tiegel in der Küche, wurde vor dem Braten mit einer Speckschwarte ausgerieben, um dem Boden etwas fettig zu machen. Diese Speckschwarte wurde aber viele Mal verwendet bis kein Fett mehr sichtbar war.
Damals war mein größter Geburtstagswunsch, ein eigenes Brot mit Marmelade nur allein essen zu dürfen. Ich glaube, zweimal habe ich ein eigenes Brot bekommen. Mir diesen Wusch zu erfüllen, war aber der Mutter erst im Jahre 1947/48 möglich. Als die Versorgung dann etwas besser wurde, konnte man mit einem Sonderabschnitt der Lebensmittelkarte ausnahmsweise zu Weihnachten in dem Nachbarort Berbisdorf zwei Weißbrote holen. Dort musste man aber etwa sieben Kilometer hin und wieder zurücklaufen. Zu Hause haben wir dann mit Margarine und Zucker einen Hilfsstollen daraus gemacht.
Mutter hatte eine Stieftante in Amerika und diese war schon nach dem 1. Weltkrieg aus Deutschland ausgewandert. In unserer Notlage schrieb sie ihr Bettelbriefe. Ich schätze, dass uns nur 3 Pakete geschickt wurden. Der Inhalt war gebrauchte Kleidung für Kinder, auch einmal 3 Stundenlutscher, damals eine Sensation. Kleine Päckchen Spagetti und auch Nudeln, sichtbar im kleinen Zellophanfenster der Verpackung, uns damals noch völlig unbekannt.
In einem Paket war für mich ein passendes weißes Hemd dabei. Auf dem Rücken war ein Cowboy mit einem blutigen Indianer- Skalp in der Hand abgebildet. Für meine Mutter war diese Abbildung ungewöhnlich und sehr abstoßend. Dieses Hemd mit dem feinen weißen Kragen durfte ich nur unter einer Jacke tragen. Die Nahrungsausbeute aus den Paketen war sehr gering, also nicht das was Mutter sich erhoffte. Ihr wäre am liebsten ein großer Karton lose gefüllt mit Erbsen oder Bohnen gewesen, sagte sie damals.
Bemerkung auf einen Brief von der Tante Marie aus Amerika
Ihr habt ja keine Ahnung wie infolge der Gräueltaten alles Deutsche hier verhasst ist...
Heute bestimmt unbekannt, ist die schleimige Fitzfädelsuppe, die damals sehr viel gegessen wurde. Sie bestand aus fein geriebenen Kartoffeln, nur mit Wasser gekocht. Ob da noch was anderes dran war, kann ich heute nicht mehr sagen. Um uns Kinder satt zu bekommen, wurden alle Möglichkeiten genutzt.
Im Garten gab es viele große Johannisbeeren Sträucher. Wir bekamen eine begrenzte Anzahl Schnitten, mit Butter oder Margarine bestrichen und dazu konnten wir im Garten die roten Johannisbeeren vom Strauch essen und das war dann unser Abendbrot.
Mein Cousin Armin musste nach der Schulzeit im ehemaligen Rittergut Kühe hüten und bekam als Lohn Milch dafür. Wir Kinder mussten regelmäßig vom Fleischer, neben der Klaffenbacher Schule, mit dem Krug fettige Wurstbrühe holen, die gab es aber auch nicht immer.
Das Fett war damals für den ausgehungerten Körper besonders wichtig.
Irgendwann bekamen wir einmal Zuckerrüben. Die haben wir erst geschnitzelt, dann im Waschhauskessel gekocht und eingedickt. Es entstand daraus brauner Zucker und das ganze Waschhaus hat geklebt.
Ein zusätzliches Problem gab es damals auch noch, als es in einem sehr trockenen Sommer zu wenig Wasser gab. Von etwa 20 Grundstücken hatten nur wir in unserem Brunnen noch Wasser. Alle Bewohner dieser Siedlung mussten bei uns, in unserem sehr tiefen Brunnen, Wasser holen. Die Bewohner der Siedlungshäuser kamen mit Handwagen, Eimern und Wannen. Damit das Wasser beim Transport nicht nur wenig überschwappte, wurden hölzerne Schneidebretter aufs Wasser gelegt.
Der ältere Bruder meines Vaters, wohnte in Chemnitz. Er hatte keine Kinder und immer genug zu Essen. Er verkaufte und tauschte verbotene Schmuggelwaren aus Westberlin. Zu Geburtstagen und auch zu Weihnachten wurden wir eingeladen. Das heißt, wir konnten dort einmal richtig satt werden, aber wir Kinder haben uns dort nie richtig wohl gefühlt.
Von Klaffenbach nach Chemnitz liefen wir mit dem Kinderwagen etwa 4 Stunden. Uns Kindern wurde es aber nicht langweilig, weil wir Mutters selbst gemachte Gedichte auf dem Weg lernen mussten. Die Gedichte, die wir dort aufsagen mussten, waren Ersatz für fehlende Geschenke.
In den Schulferien war entweder mein Bruder Siegfried oder ich etwa eine Woche dort. Unsere Mutter war immer froh, einen Esser weniger daheim zu haben. Bei meinem Besuch musste ich täglich Küchenabfälle von zwei Familien, die weit entfernt wohnten, für die Hasen holen. Viele hatten damals Stallhasen, um zusätzlich Fleisch für die Küche zu haben.
Die Strom und Stadtgas Versorgung war damals auch nicht ausreichend und nur mit Unterbrechungen möglich und durch diesen Mangel gab es regelmäßig territoriale Abschaltungen in der Stadt. Mein Bruder, der wieder einmal bei Onkel und Tante auf Besuch war, schlief nachts auf dem Sofa. Nach so einer Gas Abschaltung hatte man den Gashahn offen gelassen. Als nachts der Gasdruck wieder kam, hat mein Bruder im Schlaf eine starke Gasvergiftung bekommen und konnte gerade noch im Krankenhaus gerettet werden.
Als ich wieder mal nach Gablenz musste, schlief ich deshalb mit im Dachbodenschlafzimmer, in der Mitte der Ehebetten.
Einmal durfte ich allein mit der Straßenbahn der Linie 7 von Gablenz nach Fuhrt Glösa und zurück fahren. Diese lange Straßenbahnfahrt war für mich ein großes Erlebnis, andere Vergnügungen gab es für mich nicht. Auch das Rangieren der Straßenbahn an der Endstelle war für mich interessant. Der Zug mit zwei Anhängern hatte einen Fahrer und zwei Schaffnerinnen. Die mussten beim Rangieren mit dicken Handschuhen die schweren öligen Rangierstangen schleppen und die elektrischen Stecker tauschen.
Der Triebwagen wurde wieder vor die Anhänger rangiert und die Türen auf einer Seite geöffnet und auf der anderen Seite geschlossen. Damals gab es ja noch keine Wendeschleifen, dort hat scheinbar mich zum ersten Mal die Technik interessiert.
Die Fenster der Straßenbahnen hatten zum Teil noch Sperrholz oder Hartpappe als Glasersatz. Die Scheiben waren durch die Druckwellen beim Bombenangriff zerstört worden. Ein besonderer einzelner Straßenbahntriebwagen, beiderseits mit Jalousien ausgestattet, belieferte damals auch an der Straße liegende kleine Gemüseläden mit Waren von der zentralen Markthalle. Um den Liniendienst wenig zu stören, mussten die Gemüsearbeiter immer rennen. Viele Weichen erlaubten den schnellen Wechsel zum anderen Gleis.