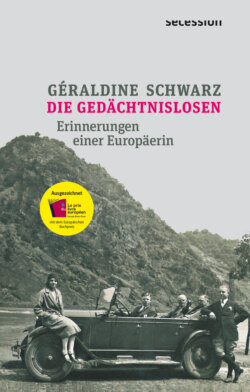Читать книгу Die Gedächtnislosen - Géraldine Schwarz - Страница 12
3Das Phantom der Löbmanns
ОглавлениеDIE VERGANGENHEIT, die meine Großeltern für immer unter den Ruinen des Dritten Reiches verschüttet glaubten, tauchte eines Morgens im Januar 1948 im Briefkasten wieder auf, als Karl Schwarz einen Umschlag vorfand, dessen Absender auf Anhieb das Unheil ankündigte: Dr. Rebstein-Metzger, Rechtsanwältin – Mannheim. In dem Brief teilte die Anwältin kurz gefasst mit, dass ihr Klient, ein gewisser Julius Löbmann, der in Chicago lebte, von der Schwarz & Co. Mineralölgesellschaft rund 11.000 Reichsmark kraft eines Gesetzes einfordere, das in der amerikanischen Zone eingesetzt worden sei und Wiedergutmachungen für die unter dem Nationalsozialismus ihres Eigentums beraubten Juden vorsehe.
Von der Geschichte dieses Briefes und dessen, was er auslöste, haben weder mein Vater noch meine Tante – die es liebt, Familiengeschichten zu erzählen – jemals gesprochen. Ich wusste, dass Opa Mitglied der NSDAP war und seine Firma einst Juden gehört hatte – mein Vater muss es mir wohl im Vertrauen gesagt haben, als ich in der Schule die Geschichte des Dritten Reiches studierte, aber ich war damals noch zu jung, um mich für die Hintergründe zu interessieren. Es geschah sehr viel später aufgrund einer Bemerkung meiner Tante Ingrid, dass ich mich entschloss, die Ordner von Opa zu durchstöbern, die seit dem Tod meiner Großeltern im Keller des Mannheimer Wohnhauses aufbewahrt wurden. Unter den Papieren, die im Laufe der Zeit zwar vergilbt, deren aufgedruckte Buchstaben aber noch immer gut lesbar waren, fand ich einen Vertrag, der bezeugte, dass Karl Schwarz zwei jüdischen Brüdern, Julius und Siegmund Löbmann, sowie deren jüdischem Schwager, Wilhelm Wertheimer, dessen Schwestern Mathilde und Irma sie geheiratet hatten, eine kleine Gesellschaft für Mineralölprodukte abgekauft hatte. Die Firma Siegmund Löbmann & Co. lag in der Gegend des Industriehafens von Mannheim nahe am Neckar gelegen, in der Helmholtzstraße 7a. Es ist aber vor allem das Datum, das von Interesse ist: August 1938, für die deutschen Juden das Jahr des endgültigen Absturzes in die Hölle, denn nun nahm der Druck durch Verfolgung und Diskriminierung in geradezu schwindelerregender Weise zu und zwang sie, ihr Eigentum zu Niedrigstpreisen aufzugeben.
Von der Familie Löbmann konnte ich nur recht wenige Spuren finden, bis ich im Internet auf eine Familie Loebmann stieß, die tatsächlich in Chicago lebte, wo Julius wohnte, als er von meinem Großvater Wiedergutmachungsleistungen einforderte. Die darauffolgende Entdeckung einer langen Liste an Loebmanns im Onlinetelefonbuch aber setzte meinen Hoffnungen ein jähes Ende. Ebenso gut konnte man eine Stecknadel in einem Heuhaufen suchen. Ich begann also meine Nachforschungen auf die Linie der Wertheimer zu konzentrieren, den Namen der Familie des dritten Eigentümers der Siegmund Löbmann & Co., Wilhelm, dessen zwei Schwestern Julius und Siegmund geheiratet hatten. Dabei stieß ich auf einen Artikel, der eine Lotte Kramer, geborene Wertheimer, erwähnte, Tochter von Sophie, der dritten Wertheimer-Schwester. Lotte war eine der letzten noch lebenden Zeuginnen der Kindertransporte, einer Rettungsaktion, mit der mehr als 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei zwischen 1938 und 1940 nach England gelangten. Ich fand ihre Spur in einem Seniorenheim in Peterborough, einer kleinen, gut eine Stunde nördlich von London gelegenen Stadt. Sie stimmte umgehend einem Treffen mit mir zu.
Lotte Kramer ist 95 Jahre alt. Eine kleine, zierliche Frau mit feinen Gesten und so höflich, wie es nur Engländerinnen sein können. Sie hatte zwei Sessel einander gegenüber gestellt, nah genug, damit wir uns gut verstehen konnten, und erzählte mir von ihrem Leben und was sie über das der Löbmanns wusste.
»Meine Mutter Sophie und ihre beiden Schwestern liebten sich sehr«, sagt sie und nimmt eine Schwarz-Weiß-Fotografie von der Wand, auf der drei junge Frauen zu sehen sind. Die Jüngste von ihnen, Mathilde, mit einem dicken Knoten im Haar und einer gestreiften Bluse, hat ein hübsches, zielgerichtetes und offenes Gesicht; ihr zur Seite Irma, die Älteste der drei, trägt einen Kragen mit Häkelsaum, der ihre müden und vielleicht ein wenig traurigen Züge aufheitert; die Letzte, Sophie, sitzend, eine Medaille um den Hals tragend, zeigt einen unsicheren Blick, der mit vager Hoffnung erfüllt ist. Lotte wurde 1923 in Mainz geboren, wo sie auch aufwuchs. Regelmäßig legte sie die knapp 100 Kilometer zurück, die sie von Mannheim trennten, um ihre heiß geliebte Cousine Lore zu besuchen, die Tochter von Siegmund und Irma Löbmann. Sie erinnert sich an ihre ausgedehnten Spaziergänge in den Gärten am Fuße des Wasserturms, an das Flanieren auf den belebten Straßen und den nie fehlenden Kaffee und Kuchen ihrer Tante Irma, einer »hervorragenden Köchin«. »Es kam sogar vor, dass wir alle gemeinsam zum Urlaub im Kraichgau aufbrachen, ins Geburtsdorf der Löbmanns, wo auf einem Bauernhof damals ein Teil ihrer Familie lebte. Wir waren sehr verbunden miteinander.«
Die Wertheimer-Schwestern hatten drei Brüder: Siegfried, der in den Zwanzigerjahren fortgezogen war, um sich in den USA niederzulassen, Paul, der in der Zeit des Nationalsozialismus nach Frankreich ins Exil ging, und Wilhelm, der zu Beginn der Dreißigerjahre in die Firma Siegmund Löbmann & Co. investierte, um seinen beiden Schwägern zu helfen, das von der Wirtschaftskrise 1929 schwer getroffene Haus zu retten. Dank dieser Unterstützung erholte sich die Firma wieder, bevor sie dann unter der Bürde der zunehmenden Diskriminierung jüdischer Geschäfte im Nationalsozialismus wieder abrutschte.
Lotte war neun Jahre alt, als Hitler an die Macht kam. Im Januar 1933 hatte der deutsche Präsident Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg angesichts der Wahlerfolge der NSDAP, die im Juli 1932 mit 37 Prozent und im November desselben Jahres mit 33 Prozent der Stimmen zur ersten politischen Partei des Landes geworden war, klein beigegeben: Er hatte den Chef der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Adolf Hitler, zum Kanzler ernannt. Der zögerte nicht lange, löste den Reichstag auf, rief Neuwahlen aus und inszenierte mit dem Ziel, die absolute Mehrheit im Parlament zu erreichen, eine aggressive Kampagne, die geprägt war von Propaganda, Parteiverboten, Repressalien und Drohungen gegen andere Kandidaten. Trotzdem verfehlte Hitler sein Ziel, da seine Partei im März nicht mehr als 43,9 Prozent der Stimmen erhielt.
In Mannheim, einer Stadt, in der traditionell die SPD und die KPD besonders stark vertreten waren, kam die NSDAP Ende der Zwanzigerjahre auf keine 100 Mitglieder. Aber nachdem sich mit der Wirtschaftskrise von 1929 die Zahl der Arbeitslosen verdreifacht hatte, wurde mit den Parlamentswahlen vom Juli 1932 die NSDAP mit 29,3 Prozent der Stimmen zur stärksten politischen Kraft der Stadt. Kurz nach ihrer Machtergreifung 1933 zerschlugen die lokalen Nazi-Autoritäten sowohl die SPD als auch die KPD, verboten Zeitschriften und zwangen den Bürgermeister von Mannheim, beim Verbrennen der Fahne der Republik zuzuschauen, bevor sie ihn in ein Krankenhaus sperrten. Unmittelbar darauf wurden mehr als 50 jüdische Beamte entlassen, noch bevor das Regime am 7. April 1933 das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« erließ, um schon bald darauf alle »nicht arischen« oder politisch missliebigen Beamten ihres Dienstes zu entheben, Universitätsangestellte und Wissenschaftler inbegriffen.
Mit rasanter Geschwindigkeit verbreitete sich in Mannheim, wo mit gut 6.400 Mitgliedern die größte jüdische Gemeinde Badens lebte, ein Antisemitismus neuer Ordnung. In der gesamten Region waren die Veränderungen zu spüren. »Plötzlich gab es überall antisemitische Propaganda, auf der Straße, in den Zeitungen, im Radio«, erinnert sich Lotte. »Eines Tages haben wir mit der Schulklasse einen Propagandafilm für Kinder gesehen, der die Geschichte eines zum Nazismus konvertierten Jungen zeigte, was uns unglaublich beeindruckte, wir wollten alle sein wie er.« Auf ihrem Heimweg von der Schule ging sie tagtäglich an der Hitlerjugend vorbei. »Ich war eifersüchtig, ich träumte davon, eine von ihnen zu sein, sie wirkten in ihren Uniformen so unglaublich glücklich.« Es war vor allem die Normalität, die sie beneidete, sie, das kleine jüdische Mädchen, das schon als Kind die Ausgrenzung, Erniedrigung und Scham zu ertragen hatte, die ihrer Gemeinschaft aufgebürdet worden waren.
In einem hervorragenden Buch mit dem Titel Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt – Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim erklärt die Historikerin Christiane Fritsche, wie in vielen Bereichen auf lokaler Ebene zahlreiche antisemitische Maßnahmen ergriffen wurden, ohne dass ein nationales Gesetz sie gerechtfertigt hätte. Die Handelskammer von Mannheim gab den Ton an, indem sie sich Ende März ihrer jüdischen Mitglieder entledigte, sprich: ihres eigenen Präsidenten und eines Drittels ihres Personals. Parallel dazu, und aus eigener Initiative, schlossen zahlreiche Institutionen und Verbände von Kaufleuten, Rechtsanwälten, Medizinern mit irritierender Geschwindigkeit Juden aus ihren Reihen aus. Damit wurden ihnen nicht nur die wesentlichen professionellen Netzwerke genommen, sondern auch ihr Ruf geschädigt, womit sie einen Teil ihrer Kundschaft verloren, was den Niedergang ihrer finanziellen Lage und ihres Lebensmuts noch weiter beschleunigte.
Eine weitere Form der Stigmatisierung und Isolation der Juden bestand im Aufruf zum Boykott ihrer Läden. In vielen deutschen Städten gab es schon bald nach der »Machtergreifung« kleinere Aktionen: SA- und SS-Männer standen vor den Türen jüdischer Geschäfte, um die Kundschaft abzuschrecken. Voller Ungeduld stimmten sich auf lokaler Ebene Vertreter der NSDAP und andere Nazi-Organisationen miteinander ab, um endlich zur Tat schreiten zu können und für den 1. April 1933 einen nationalen Tag des Boykotts aller jüdischen Geschäfte auszurufen. Schon Tage zuvor druckten die Zeitungen unablässig Boykottaufrufe und Plakate. Quer durch das gesamte Land stellten sich Mitglieder der SS und SA in Uniform vor jüdische Geschäfte, um Kundschaft beim Betreten derselben zu behindern, Schaufenster mit antisemitischen Botschaften vollzuschmieren, Reden an die Menge zu halten oder Spruchbänder zu schwingen, auf denen geschrieben stand: »Deutsche, wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!« An diesem Samstag hatten viele Läden und Kaufhäuser, da sie vorgewarnt waren und weil orthodoxe Juden den Sabbat feierten, ihre Türen verschlossen gehalten und ihre Jalousien heruntergelassen. Andere wurden verwüstet und ausgeplündert, Juden zusammengeschlagen. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung nicht aktiv mitgemacht hatte, zeigte sich, dass die Nazis nicht mit Widerstand rechnen mussten.
Wenige Monate später, so erläutert Christiane Fritsche, ließ das Reichswirtschaftsministerium die Industrie- und Handelskammer wissen, dass eine »Unterscheidung zwischen arischen oder nicht rein arischen Firmen innerhalb der Wirtschaft nicht durchführbar« sei, denn eine »solche Unterscheidung mit dem Zwecke einer Boykottierung nicht arischer Firmen (würde) notwendig zu erheblichen Störungen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus führen«. Diese Angst vor Arbeitslosigkeit war einer der Gründe, warum das NS-Regime zunächst nicht per Gesetz gegen Juden in der Wirtschaft vorging, erklärt die Historikerin. Bis Mitte der Dreißigerjahre beteuerten daher Reichsminister und NS-Größen immer wieder, »dass es kein Sondergesetz gegen Juden in der Wirtschaft geben werde und dass Übergriffe gegen jüdische Betriebe zu unterbleiben hätten«. Dieses Signal jedoch wurde auf lokaler Ebene nicht respektiert.
Eines der wirkungsmächtigsten Instrumente in Mannheim war die örtliche Nazi-Zeitung Hakenkreuzbanner, die tagtäglich dazu aufrief, die 1.600 jüdischen Geschäfte der Stadt zu boykottieren, indem sie deren Namen und Adressen bekannt gab, ja, manchmal sogar jene ihrer Kunden, die sie weiterhin aufsuchten und dafür der Illoyalität gegenüber dem Führer bezichtigt wurden. Christiane Fritsche, die Tausende Seiten dieser Tageszeitung durchforstet hat, fand in ihr »praktische Tipps«, welche das Hakenkreuzbanner den Ehemännern erteilt hatte, um ihre Frauen davon abzubringen, weiterhin bei Juden einzukaufen. Sie sollten ihnen drohen, das Haushaltsgeld zu kürzen: »Wenn Du zum Juden läufst, weil er angeblich billiger ist, dann brauchst Du auch nicht so viel Haushaltsgeld, als wenn Du bei einem anständigen deutschen Kaufmann kaufst.« Die Zeitung drohte ebenfalls damit, die Namen der »Judenliebchen« zu veröffentlichen, von Frauen also, die angeblich Beziehungen mit Juden unterhielten. Diese Einschüchterungskampagnen konnten in Städten mittlerer Größe wie Mannheim mit damals etwa 280.000 Einwohnern greifen, da die Bürger eine öffentliche Verunglimpfung mehr fürchten mussten als in einer anonymen Großstadt wie Berlin.
Eine weitere Methode zur Hetze bestand nach Fritsche darin, Gerüchte über den hygienischen Zustand in der Küche eines jüdischen Restaurants oder die sexuellen Vorlieben eines jüdischen Firmenchefs in Umlauf zu bringen. In einigen Fällen führte dies sogar bis zu den Schmutzprozessen, die auf Grundlage falscher Anklagen wegen Gaunerei, sexueller Belästigung oder Hehlerei geführt wurden. Jüdische Unternehmer waren häufig von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen und wurden daran gehindert, ihre Produkte auf Messen auszustellen. Andere lokale Direktiven verboten Juden, ihre Schaufenster in der Vorweihnachtszeit mit »christlichen« Dekorationen zu schmücken, also mit Engeln, einem Weihnachtsbaum oder einer Krippe, was darauf hinauslief, ihnen ein »nicht arisches« Etikett zu verpassen, womit ihre Umsätze während dieser Hochsaison noch einmal deutlich gesenkt wurden. Das Hauptaugenmerk galt den großen jüdischen Kaufhäusern, von denen es in Mannheim vier gab. Die Stadt verbot ihren Beamten sogar unter Androhung von Strafe, in diesen Häusern einzukaufen. 1936 waren bereits drei von ihnen wegen finanzieller Notlage an »Arier« veräußert worden.
»Ich glaube, dass die Löbmanns dem Schlag standhielten, da ich mich nicht erinnern kann, bei meinen Besuchen einen Wandel in ihrer Lebensführung bemerkt zu haben. Das heißt, sie lebten bescheiden, sie waren verhältnismäßig religiös, religiöser als wir«, berichtet Lotte Kramer. Da die Löbmanns keinen Einzelhandel betrieben, waren sie von dieser Hexenjagd wahrscheinlich in einem geringeren Maße betroffen als andere. Ihre Kundschaft war weniger sichtbar als jene, die durch die Türen eines Schneiders oder Bäckers ging, und ließ sich daher nicht so leicht von angedrohten Verleumdungen abschrecken. Aber eben nicht alle, denn der von 1933 an sichtbare Einsturz der Umsatzzahlen der Firma Siegmund Löbmann & Co., deren Auflistung ich in Opas Papieren gefunden habe, zeigt, dass auch diese unter der Illoyalität einiger Kunden gelitten hatte, sei es aus Angst oder aus Antisemitismus.
Anfangs noch schöpfte die deutsche Gesellschaft ihren Enthusiasmus gegenüber dem Nationalsozialismus eher aus einem neuen Vertrauen auf die Stärke ihres Vaterlands als aus der antisemitischen Besessenheit ihrer Nazi-Führer, die lauthals hinausschrien, dass nur ein von seinen »nicht arischen« Elementen gereinigtes Deutschland aus seiner Asche neu auferstehen könne – und zwar dank eines Volkes, dem seine rassische Harmonie eine in der Geschichte der Menschheit nie da gewesene Kraft verleihen werde. Dieser Wahn war zudem pure Mythologie, da sich die Deutschen, wie alle anderen auch, bereits unendlich viele Male mit anderen Völkern vermischt hatten, und dies schon Jahrtausende vor der Ankunft Adolf Hitlers und Joseph Goebbels’ auf Erden, die im Übrigen keinem einzigen morphologischen Kriterium eines vermeintlichen Ariers entsprachen.
Viele Bürger hatten anderes zu tun, als Juden zu jagen, nur weil sie Juden waren. Da sich aber rasch Gelegenheiten boten, aus dieser Verfolgung persönlichen Nutzen schlagen zu können, steigerte sich die Begeisterung für die rassische Sache – und zwar quer durch sämtliche Schichten der Gesellschaft. So fanden sich selbst in den gebildeten Milieus kaum Universitätsprofessoren, Wissenschaftler, Anwälte oder Juristen, die sich dem Ausschluss jüdischer Kollegen widersetzt hätten, brachten deren nun frei gewordene Posten doch all jenen einen unverhofften Vorteil, denen es aufgrund mangelnder Kompetenz nicht gelungen war, eine solche Stelle zu besetzen.
Der Fall des Philosophen Martin Heidegger, Mitglied der NSDAP bis zum Ende des Krieges und von 1933 bis 1934 Rektor der Universität in Freiburg, spiegelt das vorherrschende damalige Klima in den Universitätszirkeln wider, deren Professoren mehrheitlich die Einführung einer Quotenregelung wünschten, um die »Überrepräsentation« von Juden an den Hochschulen und allgemein bei intellektuellen Posten zu beenden. Bereits 1916 schrieb Heidegger in einem Brief an seine spätere Ehefrau Elfriede, die eine notorische Antisemitin war: »Die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings schreckerregend.« 1929 schrieb er Victor Schwoerer, dem Vizepräsidenten der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft: »[…] es geht um nichts Geringeres als um die unaufschiebbare Besinnung darauf, dass wir vor der Wahl stehen, unserem deutschen Geistesleben wieder echte bodenständige Kräfte und Erzieher zuzuführen oder es der wachsenden Verjudung im weiteren u. engeren Sinne endgültig auszuliefern.« Andere Akademiker neideten ihren jüdischen Kollegen schlicht und einfach den Erfolg.
Sich seiner Konkurrenten billig entledigen zu können war auch der Hauptgrund eines plötzlich aufkommenden Antisemitismus in der Wirtschaftswelt. Von den Kunden seiner in Schwierigkeiten geratenen Mitbürger profitieren zu können war derart verführerisch, dass Händler in Mannheim nicht zögerten, in ihren Schaufenstern zu verkünden: »Kaufen Sie hier in einem deutschen Geschäft.« Die in Not geratenen jüdischen Kaufleute begannen, ihre Medaillen aus dem Ersten Weltkrieg hervorzuholen und sich an ihre Westen zu heften, andere wiederum versuchten, sich über Wasser zu halten, indem sie Preisnachlässe und Ratenzahlungen für Billigwaren anboten. »Ganz ohne entsprechende Gesetze hatte sich in den Wochen unmittelbar nach der Machtergreifung damit in schier atemberaubender Geschwindigkeit ein Bewusstseinswandel bei vielen Deutschen vollzogen: jüdisch oder arisch – das machte auf einmal auch im Geschäftsleben einen Unterschied«, analysiert Christiane Fritsche.
Es geschah vielleicht auch vor diesem Hintergrund, dass Karl Schwarz die Wappenzeichnung anfertigen und in seinem Büro aufhängen ließ, die seine arischen Wurzeln bekräftigte und die mein Vater bei seinem Tode vorgefunden hat.
Die Diskriminierung im gesellschaftlichen Leben war ebenso erbarmungslos: Verbote für Juden, ins Kino zu gehen, auf Bälle, ins Theater, in öffentliche Schwimmbäder; Ausschlüsse aus den Sporthallen und bei sämtlichen Arten von Vereinen. Es gibt ein Foto, auf dem Frauen und Männer in Badekleidung zu sehen sind, die ganz offensichtlich zu Tode erschrocken über Bootsanleger im Rhein bei Mannheim laufen, um den paramilitärischen SA-Angehörigen zu entkommen, die sich zu den Badenden gesellten, um Juden niederzuknüppeln. Diese Szene ging dem nächsten, noch umfassenderen Schritt beim Ausschluss der Juden aus der Gesellschaft voraus: den Nürnberger Rassengesetzen von 1935, die sie zu Bürgern zweiter Klasse degradierten und sie der Rechte beraubten, die einem deutschen Staatsbürger zustanden.
Ihre ganze Jugend lang verfolgte Lotte die rapide Verelendung der jüdischen Lebenswelt. Sie erinnert sich deutlich: »In meiner Klasse gab es fünf Jüdinnen, und auch wenn wir kein ausgeprägtes politisches Bewusstsein hatten, so verstanden wir doch, dass die Situation für uns schlimmer war, wir sprachen nur unter uns darüber. Unsere Mütter hatten sich verändert, sie waren besorgt, wir mussten unmittelbar nach der Schule nach Hause kommen, durften mit niemandem sprechen.« Eines Tages erklärten die Eltern ihr, dass sie keine deutsche Schule mehr besuchen dürfe und in eine jüdische Anstalt umgeschult werden müsse. »Der Lehrer war sehr nett, er entschuldigte sich gegenüber unseren Eltern und schlug sogar vor, abends Nachhilfestunden zu geben, sollten wir sie benötigen.«
Trotz dieser Verfolgung hatten 1936 nur 1.425 der insgesamt 6.400 Juden aus Mannheim die Stadt verlassen, während sich auf nationaler Ebene von der Gemeinde mit mehr als 500.000 Juden etwa 150.000 ins Exil begeben hatten. Vermutlich waren es jene, die schon am meisten gelitten hatten, da sie politisch engagiert waren, ihren Beamtenposten verloren hatten oder ihr Geschäft bankrottgegangen war. Paradoxerweise sollten sie dem Schicksal später dafür danken, die ersten Opfer gewesen zu sein, was sie zur rechtzeitigen Abreise motiviert hatte.
Weil es den Löbmanns mehr schlecht als recht gelang, ihre Geschäfte fortzuführen, war zu emigrieren für sie lange keine Option, so wie wohl für die meisten Juden in Deutschland, und sei es auch nur, weil es bedeutet hätte, das eigene Vermögen den Nazis zu überlassen. Wie so häufig im Dritten Reich war der Umgang mit Juden von einem tiefen Widerspruch geprägt. Auf der einen Seite wollten die Nationalsozialisten ihnen das Leben möglichst unerträglich machen, um sie zur Auswanderung zu bewegen. Auf der anderen Seite aber stellten die Behörden ihrem Fortzug unüberwindbare Schwierigkeiten in den Weg. So stieg die Steuer auf Devisentransfers aus Deutschland heraus bis 1934 auf 20 Prozent und bis 1939 auf einen mehr als abschreckenden Satz von 96 Prozent. Hinzu kam die Reichsfluchtsteuer: Ab einer Summe von 50.000 Reichsmark mussten die Emigranten dem Regime 25 Prozent ihres Gesamtvermögens und Einkommens abtreten. Ganz zu schweigen von dem Verwaltungslabyrinth, das es zu durchlaufen galt, wollte man legal auswandern.
Im Grunde aber lag das wesentliche Motiv der Abneigung der Juden gegen eine Auswanderung darin, dass sie gar keine Lust hatten, ihre Heimat zu verlassen, um sich in einem Land wie Palästina niederzulassen, einer Halbwüste mit kargem Klima und einer Kultur, die ihnen unendlich fremd war. Denn sie liebten Deutschland zutiefst.
Wie konnten sich die Löbmanns und die vielen anderen nur weiterhin einem Land verbunden fühlen, das sie dergestalt misshandelte, und warum haben sie nicht erkannt, wie ernst die Lage bereits für sie war?
In Wirklichkeit war die Gefahr für eine Unternehmerfamilie wie die Löbmanns gar nicht so deutlich lesbar, da zunächst keine nationalen Gesetze gegen jüdische Unternehmen erlassen wurden, was die Illusion aufrechtzuerhalten half, dass es Juden trotz allem möglich war, wirtschaftlich im Dritten Reich zu existieren und zu überleben. Und dies nur umso mehr, als sich zur Abfederung der Auswirkungen der Boykottbewegung eine ökonomische Parallelwelt herausgebildet hatte, die ausschließlich aus jüdischen Unternehmern, Händlern und Kunden bestand.
Hinzu kam Selbstverblendung. Lotte Kramer, deren Vater »ununterbrochen wiederholte, dass er nicht fortgehen wollte«, erklärte mir, der Wille ihrer Familie dazubleiben, sei so stark gewesen, dass jedes kleine Zeichen von Solidarität innerhalb der deutschen Gesellschaft genügt habe, um sie zu beruhigen. »In der Schule hatte ich eine nicht jüdische Freundin. Als die Juden die Schule verlassen mussten, sagte deren Mutter zu meiner: ›Ich will, dass unsere Töchter Freundinnen bleiben.‹ Es war dann meine Mutter, die sie davon überzeugen musste, dass dies zu gefährlich war. Aber diese Reaktionen schenkten neues Vertrauen.«
Man teilte positive Erlebnisse miteinander, etwa jenes von einem Pärchen, das der Polizei dummes Zeug erzählt hatte, um seine bedrohten Nachbarn zu decken, oder das vom kleinen, anonymen Koffer voller Medikamente, den eine gute Seele vor der Haustür einer jüdischen Familie abgestellt hatte, deren Kinder krank waren. »Meine Eltern hatten sehr enge nicht jüdische Freunde, Greta und Bertold, die abends, als sich die Lage bereits verschlechtert hatte, heimlich zu uns kamen, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei, und uns dabei Sachen brachten, die zu besorgen für uns kaum mehr möglich war. Sie gingen ein ziemlich hohes Risiko ein.« Die Tragik dabei aber war, dass diese Herzensseelen mit ihrer gut gemeinten Hilfe, ohne es zu wissen, die Gemeinde noch ermutigten, weiterhin das Beste zu erhoffen, obwohl es zu dieser Zeit noch möglich gewesen wäre, der Falle zu entkommen, von der niemand ahnen konnte, wie tödlich sie sein sollte.
Ich habe über die Solidaritätsbekundungen nachgedacht, die den Löbmanns das Herz erwärmt haben mussten, und ich glaube, es war vor allem die Treue zumindest eines Teils ihrer Kundschaft. Ich habe eine mehrseitige Liste gefunden, die Opa mit der Firma übernommen hatte. Dieser lange Parademarsch an Namen erzählt von einem anderen Deutschland, von jenen Menschen nämlich, die ihre Loyalität nicht aufgekündigt hatten.
Lotte Kramer liefert mir noch eine andere Erklärung für deren Illusion: »Wir hatten das Gefühl einer gewissen Normalität, denn innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ging das Leben weiter. Vielleicht war die Ausgrenzung auf dem Land und in den Dörfern schneller spürbar gewesen, aber in großen Städten wie Mainz und Mannheim konnte man die Verbote leichthin vergessen, da alles intern gelebt wurde. Es gab die jüdische Schule, den jüdischen Sportklub, Tanzkurse, Feste, Konzerte und viele Freunde … Und es gab die Synagoge, sie spielte eine wichtige Rolle im Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die Löbmanns, sie gingen regelmäßig zur Synagoge.«
Die kleinen, mir von Lotte gelieferten Hinweise waren entscheidende Teile des Puzzles, die mir gefehlt hatten, um zu begreifen, warum die Löbmanns und mit ihnen die große Mehrheit der Juden bis zur letzten Minute geglaubt hatten, in ihrem Land weiterhin eine erträgliche Existenz führen zu können und dass ihr Heimatland wieder zur Besinnung kommen und endlich aufhören würde, Juden zu verstoßen, die den Wissenschaften, der Philosophie, der Literatur, den Künsten und der Wirtschaft unzählige Talente geschenkt hatten, ohne die Deutschland niemals auf so vielen Gebieten solch strahlende Erfolge hätte feiern können. Am Ende hatten sie sich eher mit dieser erniedrigenden Behandlung abgefunden, als den Exodus zu wählen.
Darum musste die Familie Löbmann alle Hoffnung aufgegeben haben, als sie sich schließlich doch entschied fortzugehen. Von 1936 an begann das Regime, das bis dahin einer »Entjudung« der Wirtschaft keine Priorität gegeben hatte, das Ruder herumzureißen. Die Arbeitslosigkeit war stark zurückgegangen, die Wirtschaftskrise überwunden, von nun an galt die Arisierung jüdischer Güter als vorrangiges Ziel. 1938 erließ Berlin immer mehr Sonderregelungen für jüdische Unternehmen, mit denen deren Inhaber, die ihre Firmen bislang nicht verkauft hatten, gezwungen werden sollten, diese an »Arier« zu übertragen. Für die Firma Siegmund Löbmann & Co. lag der erste Schlag in der drastischen Senkung der den Juden bewilligten Einkaufsquoten von Werkstoffen, was sich auf den Handel mit Erdölprodukten fatal auswirkte. Dann wurden sie gezwungen, in einem Verzeichnis detaillierte Angaben über die Gesamtheit ihrer Besitztümer einzutragen: von Immobilien über Betriebsvermögen, Versicherungen, Wertpapiere, Bargeld, Schmuck, Kunst bis hin zu ihrem vollständigen Haushalt. Eine weitere Verordnung verlangte schließlich, dass alle jüdischen Firmen als solche erkennbar waren. Gleichzeitig verschärften die Nationalsozialisten die politische Verfolgung der jüdischen Gemeinde: Polizeirazzien, willkürliche Internierungen, Zerstörungen von Kultstätten. Diese alarmierende Entwicklung dürfte es gewesen sein, die Siegmund und Julius überzeugte, sich von ihrer Firma zu trennen, um mit dem Verkaufserlös ihre Auswanderung zu finanzieren. Aber sie waren nicht die Einzigen, Zehntausende Juden boten 1938 ihre Unternehmen gleichzeitig zur Übernahme feil, womit ein erdrückendes Überangebot entstand. Unter diesen Bedingungen war klar, wen der Markt begünstigte.
Die Aussicht, ein gutes Geschäft machen zu können, hat möglicherweise die Entscheidung von Karl Schwarz beeinflusst, die Ölfirma Nitag zu verlassen, bei der er immerhin die sichere Stelle eines Generalbevollmächtigten innehatte, ein ordentliches Gehalt verdiente und ausreichend Respekt genoss, um 1935 innerhalb der Firma zum Delegierten der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront befördert zu werden. Es war übrigens auch das Jahr, in dem er in die NSDAP eintrat, vielleicht weil die Parteimitgliedschaft eine Bedingung seiner Beförderung war. Unwahrscheinlich ist, dass er sich aus Begeisterung der Partei anschloss. Denn Opa war ein Hedonist, ein Lebemann, für den die sadomasochistischen Kraftmeiereien der Macht, mit denen sich die Nationalsozialisten hervortaten, wenig Anziehung besaßen. Deren blinder Gehorsam entsprach mitnichten seinem unabhängigen Geist, der seinen Freiraum beanspruchte. Er liebte es, allein in den Bergen, die Freiburg überragen, Ski zu fahren und an den Seen zu campen, wo er seiner Leidenschaft für die Freikörperkultur frönen konnte, einer Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland gegründet worden war. Bei Nitag dürften die Unterordnung unter seinen Chef, der die Regeln vorgab, die Routine des Angestellten und die Erwartung einer Beförderung als einzige jährliche Aufregung auf ihm gelastet haben. Er wird wohl von Unabhängigkeit geträumt und sich vorgestellt haben, dass er sich bei seiner Pfiffigkeit und seinem Kommunikationsgeschick auf eigene Beine stellen kann – und dies nur umso mehr, als er in seiner Jugend gelernt hatte, in einem Labor Petroleum und Paraffin herzustellen. Er hat das Zeugnis dieser Ausbildung aufbewahrt, auf dem präzisiert wird: »Wir waren während dieser Zeit mit der Führung, Fleiß und Betragen des Herrn Schwarz stets zufrieden.«
Vielleicht hätte mein Großvater es trotzdem nicht gewagt, allein in See zu stechen, wenn sein Kollege Max Schmidt ihm nicht eines Tages seine eigene Verachtung gegenüber diesem folgsamen Leben gestanden hätte. Ich stelle mir vor, wie die beiden ihren Abgang gleich einer Flucht aus der Gefangenschaft vorbereiteten, nach getaner Arbeit bei einem Glas Bier zum Feierabend. Und tatsächlich hatte das Vorhaben etwas von einem Komplott, da Karl und Max sich nicht nur vornahmen, zu zweit ein Konkurrenzunternehmen zu gründen, wenn auch ein sehr viel kleineres, sondern auch noch sieben ihrer Kollegen abzuwerben und deren Kundschaft gleich mit. Die Gelegenheiten, welche die zu Schleuderpreisen angebotenen jüdischen Firmen boten, dürften diese konspirative Atmosphäre nur noch verdichtet haben, denn mein Großvater war kein glühender Antisemit, er muss sich der Schande bewusst gewesen sein, die es bedeutete, aus der Not der Juden Profit zu schlagen.
Die beiden Komplizen suchten wahrscheinlich das Register der Firmen auf, die noch zu arisieren waren, etwa ein Drittel der insgesamt 1.600 jüdischen Unternehmen, die es in Mannheim gegeben hatte. Die anderen waren entweder bereits verkauft oder aber nach ihrem Bankrott liquidiert worden.
Wie mag der Seelenzustand, mit dem Karl und Max die Löbmanns trafen, zu beschreiben sein? Verlegenheit? Schuldgefühl? Oder war es die Arroganz derer, die sich in der Position des Mächtigeren wissen? Ich weiß es nicht, aber ich verfüge über einen Hinweis: Karl und Max haben 10.353 Reichsmark für die Firma bezahlt, also »nur« circa 1.100 Reichsmark weniger als der ursprünglich festgelegte Preis. Im Wissen, dass dieser den Erwartungen der NS-Obrigkeiten angepasst sein musste, um deren Einwilligung zum Handel zu erhalten, war es vielleicht ein Anflug von Mitgefühl, der es den beiden verbat, das Ganze noch weiter zu treiben. Sicher ist, dass es weitaus schlimmere Profiteure als meinen Großvater bei diesen Gaunereien gab, unerbittliche Aasgeier, welche die einerseits wachsenden Schwierigkeiten für jüdische Unternehmer, einen Käufer zu finden, und andererseits ihre bedrückende Not, genug Geld für den Wegzug und die Gründung einer neuen Existenz im Ausland zusammenzubringen, aufs Erbärmlichste ausreizten. Durch Großzügigkeit zeichnete sich Karl Schwarz jedoch auch nicht gerade aus, da er widerspruchslos die von den Nazis festgelegte Regelung zur Preisfindung anwendete: Nur der materielle Wert einer jüdischen Firma sollte berücksichtigt werden, für ihren immateriellen Wert aber sollte es keinen Pfennig geben. Damit wurde genau das ausgespart, was sie häufig am wertvollsten machte: die vielen Jahre, in denen man sich einen guten Ruf aufgebaut und also einen festen Kundenstamm gewonnen hatte, um eine Dienstleistung, ein Produkt, eine Marke zu verbessern, eine Formel zu entwickeln oder Patente zu sichern.
Nach dem Verkauf begleitete Julius Löbmann über mehrere Monate meinen Großvater für 400 Reichsmark auf dessen Geschäftsreisen, um ihn der Kundschaft der Firma vorzustellen – womit eben genau jener Wert realisiert wurde, den Karl Schwarz und Max Schmidt nicht bezahlt hatten. Ich denke, dass das Einvernehmen zwischen Karl und Julius verhältnismäßig »gut« gewesen sein muss, sonst wäre es wohl kaum zu diesen gemeinsamen Reisen gekommen, und dies erst recht, als es von nun an Juden verboten war, sich auf Geschäftsreise zu begeben. Unterkünfte und Restaurants, die sie über Jahre hinweg als Kunden empfangen hatten, verkündeten nun in ihren Schaufenstern: »Juden unerwünscht.« Ihre Lage verschlechterte sich zusehends. Berufsverbote häuften sich. Sie erhielten von Amts wegen einen zweiten Vornamen in ihre Personalpapiere gedruckt, damit man sie besser unterscheiden konnte: Sara für Frauen, Israel für Männer. Und schließlich wurde in ihre Pässe ein großes J gedruckt.
Während dieser Reisen muss Opa wegen Julius eine ganze Reihe von Leuten angelogen haben, Straßenpolizisten etwa, Hotelbesitzer oder auch Restaurantbetreiber … Dieses Risiko gemeinsam getragen zu haben, dürfte sie einander nähergebracht haben. Das aber sollte mit den Novemberpogromen 1938 ein Ende finden.
Am 9. November 1938 waren Julius und Opa zusammen im Schwarzwald auf Geschäftsreise, in einer idyllischen Kulisse aus Hügeln und Tannenwäldern. Als sie im Laufe des 10. November nach Mannheim zurückkehrten, hatte der antisemitische Hass eine weitere Gewaltschwelle überschritten. Ein brutaler Pogrom war quer durch das Reich von Mitgliedern der NSDAP, der SA und der Hitlerjugend angefacht worden, wobei Hitler »ausdrücklich seine Zustimmung zu den antijüdischen Aktionen gegeben« hatte, schreibt der Historiker Dietmar Süß in seinem Buch Ein Volk, ein Reich, ein Führer: Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich. Nach seinen Schätzungen »muss man wohl – als direkte oder indirekte Folge der Pogrome – von etwa 1.300 bis 1.500 Todesopfern und 1.406 zerstörten Synagogen ausgehen, 30.756 jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gesteckt«.
Lotte Kramer hat es nicht vergessen: »Wir erhielten den Anruf eines Onkels, der gegenüber der Synagoge wohnte, wo sich auch unsere Schule befand, er sagte zu unserer Mutter: ›Schick deine Kinder nicht zur Schule, das Gebäude brennt!‹ Mein Vater bekam rechtzeitig den Rat, er solle verschwinden, woraufhin er sich in den Wäldern versteckte. Mit unserer Mutter sind wir hoch auf den Dachboden gestiegen, von wo aus wir durch das kleine Fenster hindurch die Leute auf der Straße sahen, wie sie Geschäfte verwüsteten; zum Glück kamen sie nicht zu uns. Mein Vater kehrte bei Einbruch der Nacht zurück und in dieser Nacht schlief ich im Bett meiner Eltern. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich wirklich Angst.«
In Mannheim begannen die Gewalttätigkeiten am 10. November bei Sonnenaufgang. Drei Synagogen wurden zerstört, eine von ihnen sogar mit Sprengsätzen pulverisiert, Männer wurden festgenommen, um sie später ins Konzentrationslager Dachau zu verschleppen. Profitgier war einer der Hauptbeweggründe für diesen Ausbruch an krimineller Energie: Der Großteil der jüdischen Läden wurde ebenso geplündert wie zahlreiche Wohnungen. Die Banditen des Nationalsozialismus machten in ihren Autos Plünderfahrten, drangen bei Armen ebenso ein wie bei Reichen, raubten, was sie konnten, und zerstörten den Rest. Viele Mannheimer Bürger waren von dieser Barbarei schockiert, die ihren verharmlosenden Namen »Reichskristallnacht« den Scherben von Millionen zersplitterten Scheiben schuldet. Opa wird ähnlich empfunden haben, als er, gerade zurückgekehrt von einer Reise, von seinem Lieferwagen aus dieses traurige Schauspiel betrachtete: brennende Bücher, Möbel, die aus den Fenstern auf den Bürgersteig flogen, zerstörte Fenster und Vitrinen. Julius an seiner Seite packte die Unruhe, als er erfuhr, dass Teile seiner Familie festgenommen worden waren. An diesem Tage beendeten sie ihre illegale Zusammenarbeit, sie war zu gefährlich geworden.
Die Verwandten von Julius konnten befreit werden und von nun war höchste Eile geboten, die Abreise in die USA zu organisieren. Die Familie hatte Kontakte nach Chicago und New York, wo Siegfried lebte, der Bruder von Irma und Mathilde Wertheimer, der in den Briefen an seine Schwestern Lobeshymnen auf Amerika sang. Die Löbmanns schickten tatsächlich erste Möbelstücke nach Chicago, was sie sich dank des Geldes aus dem Verkauf der Firma leisten konnten. Doch es war eine optimistische, wenn nicht gar naive Geste, denn wenn es schon vor 1938 äußerst schwierig war, ein Visum für die USA zu erhalten, so erwies sich dies von nun an als so gut wie unmöglich.
Angesichts der wachsenden Zahl jüdischer Flüchtlinge rief der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt im Juli 1938 zu einer internationalen Konferenz auf, in der vagen Hoffnung, dass die Teilnehmerstaaten sich verpflichten würden, zusätzliche Kontingente aufzunehmen. Nachdem Italien und die UdSSR die Einladung abgewiesen hatten, fanden sich die Vertreter von 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen für neun Tage in Évian-les-Bains ein, am Ufer des Genfer Sees. In der Kühle der Salons des majestätischen Hôtel Royal, zu seiner Einweihung 1909 als »schönstes Hotel der Welt« bezeichnet, Insel gekrönter Häupter und renommierter Künstler, lösten sich die internationalen Delegierten auf der Rednerbühne darin ab, ihr tiefstes Mitgefühl für das Schicksal der europäischen Juden auszudrücken. Aber niemand bot seine Gastfreundschaft an, abgesehen von der Dominikanischen Republik, die im Gegenzug dafür Subventionen einforderte. Die Vereinigten Staaten, von nur einem Geschäftsmann repräsentiert, weigerten sich, ihre festgelegte Quote von 27.370 Visa pro Jahr für Deutschland und Österreich zu erhöhen. Eines der einflussreichsten Länder der Erde hatte damit den Ton vorgegeben und der Rest der Welt zögerte nicht, ihm zu folgen.
Trotz der immensen Kolonialreiche, die Großbritannien und Frankreich damals noch besaßen, wurde keine einzige der denkbaren Optionen praktisch in Betracht gezogen, weder Palästina noch Algerien oder auch Madagaskar. Frankreich erklärte, dass es »einen äußersten Sättigungspunkt in der Flüchtlingsfrage« erreicht hätte. Der Abgesandte aus Australien ließ verlauten, sein Land, eines der weitläufigsten der Welt, habe »kein Rassenproblem« und verspüre »auch keine Neigung, durch eine ausländische Masseneinwanderung eines zu importieren«. Der Vertreter der Schweiz, Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei, teilte mit, sein Land sei ein reines Transitland. Dieser notorische Antisemit hatte nie seinen Hass gegenüber Juden verhehlt, die er als »artfremde Elemente« betrachtete, welche die Schweiz mit »Verjudung« bedrohten.
Ich stelle mir diese Vertreter der »internationalen Gemeinschaft« mit ihren verstimmten und betont schmerzlich berührten Gesichtsausdrücken vor, wie sie zwischen zwei Anstandsreden im Schatten der eleganten Pergola dieses Hotels Erfrischungen zu sich nehmen, in dem einst Marcel Proust, Sohn einer elsässischen Jüdin, überzeugter Dreyfusianer, Passagen seines Buches Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben hat, ein literarisches Meisterwerk, das ganz Frankreich zum Stolz gereichte. Die zukünftige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir, die nach Évian als »jüdische Beobachterin aus Palästina« geladen war, sollte später festhalten: »Dazusitzen, in diesem wunderbaren Saal, zuzuhören, wie die Vertreter von 32 Staaten nacheinander aufstanden und erklärten, wie furchtbar gern sie eine größere Zahl Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tue, dass sie das leider nicht tun könnten, war eine erschütternde Erfahrung.«
Von was für Zahlen war die Rede? Es ging darum, unter 32 Staaten, die direkt oder indirekt über große Territorien verfügten, die etwa 360.000 Juden aufzunehmen, die es in Deutschland noch gab, zu denen noch etwa 185.000 Juden aus Österreich hinzukamen. Es handelte sich dabei zum Großteil um großstädtische, gut ausgebildete und praktisch erfahrene Bürger, die für viele Länder eine Bereicherung dargestellt hätten. Etwa für ein Land wie Argentinien, das angesichts seiner riesigen, unterbevölkerten Landstriche stets auf der Suche nach solchen Einwanderern war. Und doch unterzeichnete sogar noch vor dem Ende der Konferenz in Évian der argentinische Außenminister José Maria Cantilo ein Rundschreiben, das unter dem Siegel der Verschwiegenheit sämtlichen argentinischen Konsulaten befahl, Visa – auch Touristenvisa – allen Personen zu verweigern, »von denen anzunehmen ist, dass sie ihr Herkunftsland verlassen haben oder verlassen wollen, weil sie als unerwünschte Personen angesehen werden, oder des Landes verwiesen wurden, ganz unabhängig vom Grund ihrer Ausweisung« – mit anderen Worten: den Juden.
Es fällt schwer, in dieser pauschalen Zurückweisung von Flüchtlingen etwas anderes zu sehen als den Ausdruck einer internationalen Antisemitismus-Epidemie, die weit über die Grenzen des Dritten Reiches hinausragte. China, auf der Konferenz nicht vertreten, war eines der wenigen Länder, das europäische Flüchtlinge akzeptierte, sogar ohne Visum, weil es dort keine Einwanderungsquoten gab. Da sie nirgendwo anders hingehen konnten, begaben sich bis zu 20.000 Juden nach Schanghai, und dies der komplizierten Sprache, der fremden Kultur und der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse zum Trotz. Doch selbst in solcher Entfernung wurden sie noch von der langen Hand der Nazis erfasst: Ende 1941 sperrten die Japaner, die einen Teil Chinas okkupiert hatten, auf Druck ihrer deutschen Alliierten die europäischen Juden in ein Getto, wo 2.000 von ihnen unter desaströsen Lebensbedingungen starben.
Nicht einmal nach den Qualen der Novemberpogrome rührte sich die internationale Gemeinschaft. Einzig Großbritannien erklärte sich mit einer Geste bereit, 10.000 jüdische Kinder in britische Familien aufzunehmen, womit jene Kindertransporte gemeint sind, die Lotte Kramer das Leben gerettet haben. Zugleich aber schloss es mit Palästina, das unter britischem Mandat stand, eine der letzten noch offenen Türen für die europäischen Juden. Aus Angst, die bereits bestehenden Spannungen zwischen Arabern und Juden könnten sich noch weiter zuspitzen, legten die Briten zwischen 1939 und 1944 eine Quote für jüdische Migranten von insgesamt 75.000 Personen fest, während noch beinahe zehn Millionen Juden auf dem europäischen Kontinent lebten.
Nach dem 9. November 1938 und der sukzessiven Abschaffung der letzten Rechte, die Juden noch besaßen, machte sich Panik breit. Hunderttausende, die sich bis dahin geweigert hatten, verstanden plötzlich, dass sie das Land so schnell wie nur eben möglich verlassen mussten. Sie strömten in Massen vor die Konsulate der ganzen Welt, die schon in den Jahren zuvor immer weniger Visa ausgestellt hatten und sich nun angesichts dieses Ansturms an Hoffnungslosigkeit noch abweisender zeigten. Die Diplomaten hatten entsprechende Anweisungen erhalten.
»Mein Vater begab sich zum amerikanischen Konsulat und harrte dort sehr lange aus«, berichtet Lotte Kramer. »Er kehrte mit einer Nummer in der Hand nach Hause zurück, aber er befand sich so weit unten auf der Warteliste … Wir wussten, dass wir keinerlei Chance hatten. Meine Eltern versuchten es auch mit Panama, Ecuador, von wo aus sie hofften, in die USA gelangen zu können, aber sie erhielten nichts.« Trotz der evidenten Aufnahmekapazität dieses von europäischen Juden bevorzugten Ziellands, in dem viele bereits Familienangehörige besaßen, die sich aller Erfahrung nach hervorragend integriert hatten, blieben die USA ihrem Schicksal gegenüber ungerührt und hielten mit einer bürokratisch grausamen Hartnäckigkeit an ihrer Quote fest.
Eine der wohl dramatischsten Episoden dieser Politik bildete die Reise der St. Louis im Frühling 1939, einem transatlantischen Passagierdampfer aus Hamburg, der Havanna ansteuerte und 937 Personen an Bord hatte, fast alle von ihnen deutsche Juden, die Kuba als Transitland erreichen wollten, um von dort in die USA zu gelangen. Kuba aber, für das man zuvor in Deutschland noch Visa bekommen konnte, hatte in der Zwischenzeit wegen eines politischen Skandals die Einreisebestimmungen geändert. Provokateure hatten die öffentliche Meinung gegen Juden aufgeheizt und eine antisemitische Demonstration noch vor der Ankunft des Schiffes organisiert. Nur 29 Passagiere durften schließlich an Land gehen, die St. Louis aber wurde aus den kubanischen Gewässern verjagt.
Sie fand sich vor Miami wieder, und zwar so nahe der Küste, dass die Flüchtlinge die Lichter an Land sehen konnten. Kapitän Gustav Schröder und jüdische Organisationen versuchten, Präsident Franklin D. Roosevelt davon zu überzeugen, ihnen Asyl zu gewähren. Vergeblich. Der Hauptgrund dafür war die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung, die angesichts der während der Wirtschaftskrise gestiegenen Arbeitslosigkeit allergisch auf jegliche Immigration reagierte, vor allem auf die der europäischen Juden, deren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt man mehr fürchtete, als dass man Verständnis für ihre Situation hatte. Es lag nun an Kanada, sich solidarisch zu zeigen, aber auch hier erwies sich der Immigrationsbeauftragte Frederick Blair als unerbittlich. Anfang Juni 1939 zurück in Europa, weigerte sich Kapitän Schröder, seine Passagiere an Deutschland auszuliefern, und ließ sie in Antwerpen an Land gehen. Ein Viertel von ihnen fand im Holocaust den Tod.
Die Familie Löbmann hat nie ein Visum erhalten. Es ist gut möglich, dass sie sich mit dem Möbeltransport in die USA an diese fast unmögliche Perspektive geklammert hat, um ihre materiellen Güter nicht aufgeben zu müssen, anstatt ihre Haut zu retten und es mit anderen Ländern zu versuchen. Aber auch ein Visum hätte ihnen mitnichten garantiert, sicher am gewünschten Ziel in Übersee anzukommen, denn dazu musste man zumindest ein, wenn nicht zwei Drittländer durchqueren, Frankreich, Portugal, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, wo gewissenlose Mittelsmänner Bestechungsgelder verlangten, die umso höher wurden, je stärker die Not der Juden anwuchs. Reisebüros, Konsulate, Schlepper, Hotelbesitzer, bestochene Beamte – wie viele haben sich nicht am Antisemitismus bereichert! Die Mittel der Löbmanns aber waren begrenzt, da die Summe, die sie aus dem Verkauf ihrer Firma gezogen hatten, nach den für Juden geltenden Verordnungen auf einem vom Reich kontrollierten Konto, von dem sie jeweils nur kleinere Summen abheben durften, blockiert war.
Trotzdem war es noch nicht vollkommen unmöglich, Deutschland zu verlassen. Nach den Novemberpogromen 1938 konnten bis zu 40.000 Juden flüchten. Unter ihnen befand sich Lotte Kramer. Ihre Lehrerin an der Schule in Mainz hatte von den organisierten Kindertransporten nach Großbritannien gehört und einen Platz für sie gefunden. »Meine Mutter sprach mit ihrer Schwester Irma darüber, der es gelang, auch ihre beiden Kinder Lore und Hans im Transport unterzubringen. Ich wollte von meinen Eltern nicht getrennt sein, aber ich war mit meinen Cousins zusammen, und es war ein wenig wie ein Abenteuer.«
1939 konnten noch fast 80.000 Juden das Land verlassen, davon mindestens 1.000 Juden aus Mannheim. Einige von ihnen landeten in Indien oder Kenia, Länder, die nicht ihre erste Wahl gewesen waren.
Die Familie Löbmann hat vielleicht zu lange gezögert, sich von Amerika als Bestimmungsort abzuwenden und sich stattdessen mit dem Lebensminimum irgendwohin zu retten. Diese Abneigung gegen alles Improvisierte wurde zu ihrer Fessel. Je länger die Löbmanns abwarteten, desto mehr ging ihr Vermögen zur Neige und damit die Chance, doch noch auswandern zu können. Denn nach dem 9. November 1938 gab es kein Halten mehr bei den organisierten Plünderungen. Um die Juden für jene Pogrome zu bestrafen, deren unglückselige Opfer sie selbst ja waren, forderte das NS-Regime von ihnen eine Sühneleistung in Form einer neuen Steuer, der Judenvermögensabgabe, mit der die Nationalsozialisten 25 Prozent des Vermögens derer ergaunerten, die wie die Löbmanns mehr als 5.000 Reichsmark besaßen. Dann befahl man ihnen im Februar 1939, sämtliche Gegenstände aus Silber, Gold und Platin auszuhändigen, ebenso wie Perlen und Edelsteine, und zwar für einen Preis, der häufig nur ein Zehntel des eigentlichen Wertes ausmachte. Wenige Monate später zwang eine neue Verordnung diejenigen, die das Land verließen, zusätzlich zur Steuer auf Devisen und zur Reichsfluchtsteuer eine progressive Auswandererabgabe zu bezahlen.
Die Lage der in Deutschland festsitzenden Juden verschlimmerte sich zusehends. Hitler hatte entschieden, sie endgültig aus dem Wirtschaftsleben und der Arbeitswelt auszuschließen. Diejenigen, die bereits alles verloren hatten, wurden zwangsweise herangezogen, um Straßen zu bauen oder den Müll zu entfernen, während Firmen, die noch nicht arisiert worden waren, zu Schleuderpreisen verkauft wurden. Einige Juristen trieben den Zynismus so weit, dass sie die Eigentümer, die in Dachau eingesperrt waren, aufsuchten, um sie den Verkaufsvertrag unterzeichnen zu lassen. Man riss sich Grundstücke unter den Nagel, auch die der Synagogen, der jüdischen Organisationen, der jüdischen Friedhöfe. In Mannheim, wie Christiane Fritsche berichtet, hat selbst die evangelische Kirche an dieser finsteren Zerlegung teilgenommen – und damit die Preise aufs Erbärmlichste gedrückt.
Am Morgen des 22. Oktober 1940 tauchten Nazi-Schergen in den Häusern der Löbmanns sowie bei Wilhelm Wertheimer, dem Bruder von Irma und Mathilde, auf und befahlen ihnen, ihre Koffer zu packen: Jeder Erwachsene hatte das Recht auf maximal 50 Kilogramm Gepäck sowie 100 Reichsmark und sollte Nahrung und Wasser für drei Tage mitnehmen. Ihre Konten, ihre Wertpapiere sowie ihr Grund und Boden wurden mit allem, was sie beinhalteten, gepfändet. Wenige Stunden später warteten sie auf dem Gleis des Mannheimer Bahnhofs gemeinsam mit ungefähr 2.000 anderen Juden der Stadt darauf, in einen Zug zu steigen, dessen Ziel sie nicht kannten. Ungefähr die Hälfte der Mannheimer Gemeinde war in den Jahren davor ins Exil geflohen. Acht Juden hatten sich noch am Morgen der Razzia das Leben genommen. Mehreren Hundert war es gelungen, sich zu verstecken, nur Ehepartner arischer Personen wurden verschont.
Am 23. Oktober setzte sich ein aus neun Zügen bestehender Konvoi mit etwa 6.500 Gefangenen in Bewegung. 4.500 weitere Juden aus dem Südwesten Deutschlands, dem Saarland, aus Baden und der Pfalz waren ebenfalls im Rahmen dieser Aktion verhaftet worden. Nachdem der Transport bei Kehl den Rhein überquert hatte, kam er nachts in Chalon-sur-Saône an, einem Ort, der direkt an der Demarkationslinie lag, die Frankreich nach der Niederlage in eine vom Dritten Reich besetzte Zone im Norden des Landes und eine sogenannte »freie« Zone im Süden unterteilte, die von der begrenzt autonomen französischen Regierung mit Sitz in Vichy kontrolliert wurde. Anders als die Deutschen es sich ausgemalt hatten, legte Vichy, das inzwischen ein eigenes »Judenstatut« zu deren Diskriminierung eingeführt hatte, Protest ein. Vor vollendete Tatsachen gestellt, ließen die französischen Behörden jedoch die Züge in die »freie« Zone einfahren, in der die Deutschen theoretisch kein Sagen hatten, wobei sie deutlich darauf hinwiesen, dass es außer Frage stand, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen durfte.
Nach zwei Tagen, während derer sie der Brutalität der SS ausgeliefert waren, kamen die Passagiere, von denen viele hohen Alters waren, im Lager Gurs im Südwesten Frankreichs an. In diesem von Vichy verwalteten Internierungslager befanden sich Juden und Nicht-Juden aller Nationalitäten – mit Ausnahme der französischen, die entweder von den Nazis deportiert wurden oder aber vom französischen Regime in der »freien« Zone verhaftet worden waren. In Gurs gab es weder Hinrichtungen noch Folter, aber Hunderte der Häftlinge starben aufgrund der Lebensbedingungen, sie verhungerten oder kamen vor Kälte um in diesen fensterlosen Baracken, in denen es weder sanitäre Anlagen noch fließendes Wasser gab, in die der Regen eindrang und wo das Bettzeug aus mit Stroh gefüllten Säcken bestand, die auf den schlammigen Boden geworfen waren. Irma Wertheimer, die Ehefrau von Siegmund Löbmann, erkrankte schwer und wurde Ende November 1941 in ein Hospital in Aix-en-Provence transportiert. Siegmund wurde in das nahe gelegene Internierungslager Les Milles überführt, um in ihrer Nähe sein zu können.
Aus Gurs zu fliehen war verhältnismäßig einfach, da dessen Umzäunung nur zwei Meter hoch und weder elektrisiert noch mit Wachtürmen verstärkt war. Dennoch gab es wenige Fluchtversuche, da die größere Herausforderung erst noch folgte: ein langes, angsterfülltes Versteckspiel mit der Polizei. Vermutlich weil ein solcher Ausbruch mit Kindern und älteren Eltern unvorstellbar war, zogen viele Gefangene die Familie der Freiheit vor.
In Gurs hatten religiöse und humanitäre Verbände die Erlaubnis erhalten, Nahrung zu liefern, medizinische Versorgung anzubieten und den Alltag der Inhaftierten zu erleichtern. Eine von ihnen, die internationale jüdische Hilfsorganisation HICEM, half den Juden dabei, die nötigen Unterlagen für die Einreichung einer Emigrationsanfrage zusammenzustellen. Jene, denen dies gelang, baten den Vorsteher des Lagers, nach Marseille, diesem großen französischen Hafen am Mittelmeer, überführt zu werden, hegten sie doch die Hoffnung, sich von dort aus nach Übersee einschiffen zu können. So gelangten im April 1941 schließlich auch Julius und Mathilde Löbmann mit ihrem Sohn Fritz sowie Wilhelm Wertheimer und seine Frau Hedwig mit ihrem Sohn Otto nach Marseille. Dank der Unterstützung der Mitarbeiter aus der Gedenkstätte des Lagers Les Milles, einer der Vorzeigeinstitutionen in Frankreich, um die jungen Generationen für dieses Gedenken zu sensibilisieren, konnte ich den weiteren Weg der Mitglieder dieser Familie nachzeichnen.
Die Männer kamen nach Les Milles, das unter der Verwaltung von Vichy stand und wo zahlreiche Künstler und Intellektuelle wie etwa Golo Mann und Lion Feuchtwanger interniert waren. Die Frauen und Kinder wurden in zu Unterbringungszentren umfunktionierten Hotels in der Innenstadt von Marseille geschickt.
Hedwig und Otto, der damals neun Jahre alt war, wurden ins Hôtel Bompard gebracht, Mathilde und Fritz, damals zwölf Jahre alt, ins Hôtel Terminus les Ports. Man litt an Unterernährung, an Hygienemangel, an Ungeziefer, an mangelnder Kleidung und Kälte in diesen Häusern, in denen die Stromversorgung und das Wasser rationiert waren und deren Besitzer oft nicht die geringsten Skrupel hatten, die vom französischen Staat ausgezahlten Aufwandsentschädigungen in die eigene Tasche zu stecken und nur einen Bruchteil den Gästen zugutekommen zu lassen. Außerdem war man dem Gutdünken widerwärtiger Figuren wie dem Arzt Félix Roche-Imbart ausgesetzt, der seiner sadistischen Lust frönte, die Unterbringung erkrankter Gäste in Hospitälern und Sanatorien zu verhindern und ihnen den Besuch von Ehegatten zu verbieten. Trotz allem waren im Vergleich zum Lager in Gurs die Lebensbedingungen deutlich bessere. Internationale Hilfsorganisationen gaben Kindern Unterricht und richteten für die Mütter Nähkurse ein, vor allem aber konnten die meisten Frauen sich frei in der Stadt bewegen, am Strand spazieren gehen und weiterhin versuchen, die notwendigen Behördenwege zu erledigen, um auswandern zu können.
Laut Archiv des Lagers Les Milles muss Hedwig versucht haben, für ihre Familie amerikanische Visa zu erhalten. Was wahrscheinlich auch für Mathilde gilt. Sie kamen zu spät. Kurz zuvor war ein solches Ziel noch umsetzbar, dank des amerikanischen Vizekonsuls in Marseille, Hiram Bingham IV, der Visa und gefälschte Papiere beschaffte. Oder aufgrund der Hilfe des amerikanischen Journalisten Varian Fry, dem es gemeinsam mit einem großen Netzwerk an Unterstützern gelungen war, mehr als 2.000 Juden aus Frankreich herauszuschleusen, unter denen sich hauptsächlich Künstler, Intellektuelle und Wissenschaftler wie Claude Lévi-Strauss, Max Ernst, Hannah Arendt oder Marc Chagall befanden. Als Reaktion, aber auch auf Druck des Vichy Regimes hin, entzog das Aussenministerium in Washington dem Konsulat die Entscheidungshoheit in Sachen Visavergabe, versetzte Hiram Bingham IV nach Portugal und konfiszierte den Pass von Varian Fry.
Hedwig Wertheimers und Mathilde Löbmanns Bestrebungen zur Emigration scheiterten im Sommer 1942, sie wurden mit ihren Söhnen nach Les Milles überführt, wo sie wieder auf ihre Ehemänner Julius und Wilhelm trafen. Die Stimmung war bedrückend. Im Lager Drancy nördlich von Paris hatten die Deportationen nach Auschwitz begonnen. Offiziell hieß es, um die Häftlinge in Arbeitslager zu bringen. Beim Anblick der Viehwaggons, in die man ganze Familien ohne Wasser einpferchte, fragten sich viele, warum man wohl auch Kinder, die gar nicht befähigt waren zu arbeiten, in die Züge zwängte. Es war auch schon von Massakern die Rede.
Hedwig und Mathilde mussten die Gefahr gerochen haben. Wie andere Mütter auch, entschieden sie sich, ihre Söhne dem jüdischen Kinderhilfswerk anzuvertrauen. Zeugen haben von herzzerreißenden Trennungen berichtet, dem Weinen der Kinder, die man von ihren Müttern trennte, die wiederum damit zu kämpfen hatten, Haltung zu wahren, um ihre Kleinen nicht zu beunruhigen. Otto wurde ins Château de Montintin südlich von Limoges gebracht, wo sich mehrere Hundert Kinder zwischen 12 und 17 Jahren versteckt hielten, unter ihnen vor allem deutsche Juden, die dort von einem Arzt beschützt wurden. Fritz ging in eine ähnliche Anstalt, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Kinder vor der Deportation zu retten.
Im Frühling 1943 hatten die beiden Cousins das Glück, noch einmal in einem der letzten Zufluchtsorte Frankreichs vereint zu sein, der in der damals von Italien besetzten Zone im Südosten Frankreichs lag. In Izieu, einem kleinen, hoch gelegenen Dorf an den Hängen eines Arms der Rhône, hatte die polnisch-jüdische Widerstandskämpferin Sabine Zlatin gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Heim errichtet, wo sie die Kinder vor der Deportation bewahren wollte. Zum ersten Mal seit Langem konnten Fritz und Otto wieder an die Leichtigkeit der Kindheit anknüpfen. In der Gedenkstätte von Izieu zeigen Fotos diese Kinder auf einer weiten Wiese, ihr Haar im Wind, als Gruppe vor einem Haus, die Großen tragen die Kleineren auf ihren Armen, in Badehose auf einem Steg an einem See. Sie lächeln fast immer und es ist auf diesen Bildern, die Aufnahmen welcher glücklichen Kindheit auch immer sein könnten, nicht der Hauch eines Vorzeichens zu sehen.
Die italienische Besatzungszone war für Juden die sicherste, da sich die Italiener, im Gegensatz zu den Franzosen, so gut es ging weigerten, sie auszuliefern. Im September 1943 aber, nach der Kapitulation des faschistischen Italiens, kippte die Situation, da nun die Deutschen die italienische Zone in Frankreich besetzten. Die aufkommende Gefahr ahnend, machte sich Sabine Zlatin Anfang April 1944 auf, eine andere Zufluchtsstätte zu finden. Doch während ihrer Abwesenheit geschah es am Morgen des 6. April, dem ersten Tag der Osterferien, als die Kinder gerade dabei waren, ihr Frühstück vorzubereiten, dass zwei Lastwagen der Wehrmacht und ein Dienstwagen der Gestapo die 44 Jungen und Mädchen, den Ehemann von Sabine Zlatin und sechs Erzieher festnahmen und ins Lager von Drancy brachten. Der Befehl dazu stammte vom Leiter der Gestapo in Lyon, Klaus Barbie, einem Mann, der für seine an Wahnsinn grenzende Besessenheit berüchtigt war, Juden und Widerstandskämpfer zu jagen, die er dann mit hemmungsloser Leidenschaft allen möglichen Foltermethoden unterwarf, deren genialer Erfinder er sich zu sein rühmte.
Am 15. April 1944 wurden Fritz Löbmann und Otto Wertheimer, damals 15 und 12 Jahre alt, in einem Konvoi zusammen mit 30 anderen Kindern von Izieu nach Auschwitz deportiert. Am Tag ihrer Ankunft wurden sie vergast.
Zwei Jahre zuvor waren die Eltern von Otto Wertheimer, Hedwig und Wilhelm, und die Mutter von Fritz Löbmann bereits nach Drancy überführt worden. Am 17. August wurden sie mit dem Konvoi Nummer 20 verschleppt. Endstation: Auschwitz. Am 2. September war es dann Siegmund, der nach Drancy kam, er wurde am 7. September mit dem Konvoi Nummer 29 deportiert. Endstation: Auschwitz. Seine Einsamkeit wird seine Notlage nur noch schlimmer gemacht haben. Seine Frau Irma stand auf der Liste der zu Deportierenden des Lagers Les Milles, dürfte aber wohl in letzter Sekunde gerettet worden sein, und dies womöglich von Medizinern, die ihre Notaufnahme im Krankenhaus von Aix-en-Provence verlangten.
Julius Löbmann stand ebenfalls auf der Liste, war jedoch nicht auffindbar. Ihm war die Flucht gelungen. Da es so gut wie unmöglich war, aus Les Milles zu entkommen, musste Julius während einer seiner alltäglichen Wege ins nahe gelegene Dorf Saint-Cyr-sur-Mer geflohen sein, wo er als Teil eines Trosses von Zwangsarbeitern im Dienste der französischen Industrie und Landwirtschaft (GTE) arbeitete. Er muss sich wohl unversehens entschieden haben, als er begriffen hatte, dass seine Familie nicht entkommen würde. Er allein konnte fliehen, die anderen saßen im abgeschlossenen Bereich des Lagers in der Falle. Ich stelle mir vor, wie er sich von seiner Frau verabschiedet, von seinem Sohn, seinem Bruder, seinem Schwager und in der Nacht vor seiner Flucht kein Auge zugemacht hat. Und dann am eigentlichen Tag, an dem es galt, den richtigen Moment zu erfassen, um sich davonzustehlen, um in die Pinienwälder von Saint-Cyr-sur-Mer zu verschwinden oder auf dem Rückweg vom Wagen abzuspringen.
Die Chancen für einen geflohenen Juden, der ohne Geld, ohne Kontakte und ohne irgendwelche Kenntnisse über Frankreich sich selbst überlassen war, waren unter einem Regime, das mit Deutschland kollaborierte und aus freien Stücken antijüdische Verordnungen eingeführt hatte, äußerst gering. Es sei denn, das Schicksal entschied sich, großmütig zu sein und ihn mit einem dieser mutigen und mitfühlenden Franzosen zu begünstigen, die während des Krieges Juden in ihren Kellern oder auf ihren Dachböden versteckt hielten und ihnen regelmäßig heimlich brachten, was zum Überleben reichen musste. Aber selbst dieses Szenario konnte tragisch enden, wenn der Schutzengel denunziert und von der Gestapo oder der französischen Polizei verhaftet wurde und seine Schützlinge gefangen oder in ihren Löchern ohne irgendeine Hilfe zurückblieben.
Wer auf sich allein gestellt blieb, der musste schlau und verwegen sein; und schenkt man Lotte Kramer Glauben, so war Julius dies. Um nicht Gefahr zu laufen, seine Herkunft preiszugeben, gab er sich als taubstumm aus und ließ sich in einem großen Hotel an der Côte d’Azur wahrscheinlich irgendwo in der italienisch besetzten Zone zwischen Nizza und Menton als Liftboy anheuern. Ich weiß nicht, ob sein Patron geahnt hat, mit wem er es zu tun hatte, er besaß jedoch die Güte, trotz der fehlenden Papiere dieses ulkigen Kerls mit Pupillen so blau und Haaren so blond wie bei einem Deutschen ein Auge zuzudrücken.
Nach dem Einmarsch der Deutschen in die italienische Zone muss Julius miterlebt haben, wie Offiziere der Wehrmacht und der SS in dem Hotel abgestiegen sind. Wie viele Male täglich hat er wohl das Martyrium erleiden müssen, diese Männer auf ihre Etage zu fahren, in der Enge der Aufzugskabine ihre Uniformen zu streifen, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen, seine Hände zittern zu fühlen, wenn er den Knopf bediente, und sein Herz vor Angst trommeln zu spüren, dass ihm ein Blick, ein Reflex passieren mochte, ein »Bitte schön« oder ein »Danke« oder ein »Guten Morgen« – ein einziges Wort auf Deutsch und er wäre verloren gewesen. Im Sommer 1944 wurde er von diesem Druck befreit, als die Truppen der Alliierten in der Normandie und später in der Provence landeten und die Besatzer aus Frankreich verjagten. Vielleicht ging er nach Drancy in der Hoffnung, dort seine Lieben wiederzufinden, und erfuhr dann, dass alle Gefangenen nach Auschwitz gebracht worden waren. War Julius in diesem Moment bereits klar, wofür der Name Auschwitz stand?
Seit dem Sommer 1941 wussten die Briten, dass die Kommandos der SS, deren Funkverschlüsselung sie dechiffriert hatten, im Osten Europas Massaker anrichteten. In der Folgezeit gab es dafür immer mehr Indizien, die den Alliierten aus unterschiedlichen Quellen der deutschen Armee, von Vertretern der jüdischen Bevölkerung und von polnischen Widerstandskämpfern zugespielt wurden. Im Frühling 1942 zeigte sich der Daily Telegraph alarmiert: »Mehr als 700.000 polnische Juden sind bei einem der größten Massaker der Weltgeschichte ermordet worden.« Immer mehr Medien verbreiteten diese Informationen, selbst die Gaskammern wurden erwähnt. Am 17. Dezember 1942 verurteilten die Alliierten diese »bestialischen Vernichtungsmethoden« öffentlich und einhellig. Der britische Radiosender BBC übertrug die Erklärung, die wörtlich lautete: »Niemand wird niemals mehr sagen können, er habe nie etwas von Deportierten gehört. Diejenigen, die fähig sind zu arbeiten, werden in den Lagern ausgebeutet, bis sie vor Erschöpfung sterben. Die Kranken und Gebrechlichen sterben vor Kälte oder an Hunger oder werden brutal umgebracht.« Die amerikanischen, britischen und sowjetischen Regierungen wussten sogar, dass schon mehr als zwei Millionen Juden umgebracht worden und fünf Millionen aufs Schlimmste bedroht waren.
Da diese Informationen von Vichy-Frankreich zensiert wurden, wird Julius einen letzten Funken Hoffnung bewahrt haben, vor allem für seinen kleinen Fritz, diesen Jungen, der noch ein Kind war. Die Nazis würden doch wohl nicht auch noch Kinder ermordet haben. Aber an wen konnte er sich wenden und um Hilfe bitten? Seine ganze Familie, all seine Freunde waren verschwunden, und das befreite Frankreich kümmerte sich keinen Deut um die dem Tod entronnenen Juden. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Amerika zu gehen, nach Chicago, jener Stadt, in die seine Familie geplant hatte zu fliehen, bevor sie von Mannheim fortgerissen wurde.
Während der Überquerung des Atlantiks muss Julius an Bord des Schiffes, das sich von einem in Feuer und Blut versinkenden Europa entfernte, ein Gefühl tiefer Traurigkeit bei der Vorstellung übermannt haben, diese Reise nun allein angetreten zu haben, mit der sich die Seinen als letzten Ausweg voller Bitterkeit abgefunden hatten, und von der er niemals geglaubt hätte, dass sie sich eines Tages in einen unerreichbareren Traum verkehren sollte: sie alle gemeinsam auf diesem Schiff, befreit vom Untergang ihres Heimatlandes. Die Augen auf den Horizont gerichtet, an dem bald schon der ersehnte amerikanische Kontinent aufscheinen sollte, wird Julius wohl gespürt haben, dass er dort niemals das Leben mit seinem Sohn Fritz teilen würde, auch nicht mit seiner Frau Mathilde und auch nicht mit seinem Bruder Siegmund.