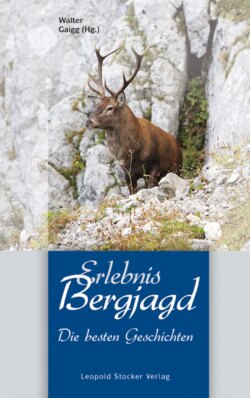Читать книгу Erlebnis Bergjagd - Группа авторов - Страница 9
W. Brenner Zwischen Nacht und Tag Auerhahnbalz im steirischen Gebirge
ОглавлениеAuf den Urhahn zu jagen, kann das schwerste oder auch das leichteste jagdliche Unternehmen sein, je nach Ablauf, jagdlichem Glück, korrekt Weidmannsheil genannt, oder je nach Revier, Wetter, Führung oder Fügung. Erlebt habe ich die Hahnjagd in der Balz in den verschiedensten und herrlichsten Formen. Hätte ich diese aber nicht alle erlebt, so müßte ich heute entweder sagen, die Hahnbalz sei ein streckenloses Vergnügen und nur ein Naturerlebnis; oder aber, daß den Urhahn zu erlegen, leicht wie Kinderspiel wäre! Ich hätte bei beiden Behauptungen recht, weil es so viele Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten der Auerhahnjagd gibt. Weil ein Auerhahn eben kein Fasan ist. Weil die Hahnjagd so unendlich viele Überraschungen für den Jäger bereithält. Weil der Auerhahn ein Erlebnis bietet, wie kaum ein anderes Wild unserer Länder. Und weil es mit der Jagd auf ihn allmählich zu Ende geht.
Seit meiner Kindheit träumte ich davon, einen, nur einen einzigen Großen Hahn zu erlegen. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Ich glaube nicht, daß ich die selbstauferlegte Enthaltsamkeit in der Zukunft aufgeben werde. Viele Jahre der zeitlichen Distanz, ein Verblassen der erlebten Stimmung und noch manches andere müßten kommen, um mich dazu zu bewegen.
Den einen Schuß, mit dem ich meinen Hahn streckte, werde ich nie bereuen. Für diesen einzigen Urhahn will ich mein Leben lang dankbar sein. Durch ihn wurde mein Heimatrecht in der Bergjagd nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch greifbar besiegelt. Das genügt mir. Was blieb, ist eine Sammlung von unvergeßlichen Erinnerungen und ein in Balzstellung präparierter Hahn in meinem Jagdhaus. Es dauerte zwei Jahre, bis ich meinen Hahn hatte. Wie fast jedes von mir erlegte Wild, verlangte auch mein Hahn eine Unmenge Geduld. Das Schicksal, mein Weidmannsheil, zögerte eben.
Man kommt auch immer mehr zur Einsicht, daß ein einziger Auerhahn als Strecke für ein ganzes Jägerleben reichen kann, ja, reichen muß! Weil es mit der Hahnjagd allmählich „vorbei“ ist, weil es immerhin noch Tausende von Jägern gibt, die nie einen Hahn erlegt haben und auch nie mehr einen erlegen werden können! Weil der Große Hahn zu einer Rarität der mitteleuropäischen Wildbahnen geworden ist, zu einem fast mythischen Recken, dessen Zukunft für die Jäger und Naturschützer nur noch Aufgaben und nicht jagdliche Streckenerfolge bereithält.
Zwischen sterbendem Winter und aufkommendem Frühling, zwischen Nacht und Tag, wiederholt sich alljährlich ein ergreifendes Wunder: Im Bergwald balzt der Urhahn. Aus der Tiefe der Erdengeschichte, aus der Ferne der ersten Schöpfungstage ertönt sein Lied mit den in ihrer Schlichtheit wundervoll steigenden Strophen, eine geflüsterte Liebeserklärung an das Leben, an die Berge und an die Wälder. Bei steigendem oder sinkendem Licht, halb in der Nacht, zwischen dunklen Fichten und weißen Schneeflächen, in den Zweigen hellgrüner Lärchen meldet das sehnsuchts- beladene Geschöpf. Vielleicht ist seine Art insgeheim schon zum Tode verurteilt; das Einzelwesen weiß aber nichts davon und singt die einfachen Strophen voller Lebensfreude und Liebeswillen.
Es gibt jetzt kein zwanzigstes Jahrhundert im Wald, nur Frühling und Sehnsucht. Der Große Hahn balzt. Er kennt kein überschwenglich buntes Lied, keine Arie der raschen Einfälle, nur einige leise perlenden Laute, stets wiederkehrende Strophen, Kompositionen höchster Schlichtheit. Morgenschimmer, verblassender Sternenhimmel, dunkel in die Dämmerung ragende Nadelzweige, Rauschen von Wasser und Wind, seufzend kühles Einatmen, dazu das Lied aus der unsichtbaren Tiefe des Frühlingswaldes, jagende Herzschläge: Der Urhahn balzt. Das ist die Abstraktion des Lebens, der Liebe und der Jahreszeit, reduziert auf ureinfache, wiederkehrende Strophen.
Stimmen, Stimmungen und Bilder von eigenartigem Reiz, in keiner Jahreszeit so wie im Frühling erlebt, selbstvergessene Sinneskraft, dionysische Ekstase in den scharfen Konturen des Föhnfrühlings gezeichnet, ein schwebendes, träumerisch verdämmerndes Lied; in nur wenigen Farben entsteht ein Bild höchster Vollendung, die überschäumende Freude am geliebten Leben: Der Urhahn balzt. Wie viele, besser gesagt wie wenige von uns erleben, erlebten noch dieses Naturwunder?
Zwischen Winter und Frühling, zwischen Nacht und Tag spielt sich alljährlich ein Schauspiel ab, ergreifend in der Einsamkeit der Szene, fast anachronistisch durch die Lebensgewohnheiten des Akteurs inmitten der Aufschließung des Bergwaldes zur Wirtschaftslandschaft. Würde er eine Vergangenheit verkörpern, die nicht mehr zurückzuholen ist, so könnte mancher ihn belächeln, so könnten andere mit einem Achselzucken über das Schicksal seiner Art zur Tagesordnung übergehen. Doch was wäre der Bergwald ohne den großen, dunklen Vogel, der im Licht der sinkenden oder erwachenden Sonne den Frühling begrüßt? Was wäre die Bergjagd ohne die brennende, tiefe Sehnsucht des Jägers nach dem geheimnisvollen Sänger?
Neue Ansichten und Absichten der Nutzung durchdringen den Bergwald. Im Tal dehnen sich die bebauten Flächen immer mehr aus; sie stoßen Tag für Tag tiefer in die Abgeschlossenheit der Gebirgswelt vor. Aus der Naturlandschaft entsteht schrittweise die Kulturlandschaft, und dennoch balzt der Urhahn – jetzt noch.
Mein herzbester Freund, Pate beim Sohn, Beistand der ersten niedergeschriebenen Erlebnisse, Hüter und Wahrer der Weidgerechtigkeit, sinnierender Dichter unserer wunderbaren jagdlichen Welt, fragte mich einmal, ob ich einen Großen Hahn erlegen möchte. In einer in der Nähe seines Reviers liegenden Jagd wäre ein Hahn frei, lautete die Nachricht, ich könnte sofort kommen.
„Tagwache! Aufstehen!“ – eine völlig fremde Stimme brummte in meinem Zimmer. Eine rätselhafte Figur macht Licht; es dauerte einige Minuten, bis ich die in der langen Unterhose umhergeisternde Gestalt als den Oberförster Bacher und den eigenen Standort als das Bett im Gästezimmer des Forsthauses der Malteser auf der Hebalm identifizierte.
„Zwei Uhr vorbei, wir müssen uns beeilen“, brummte die verrauchte Stimme. Der wuchtige Mann polterte im Zimmer umher. Nicht um die Welt, ich bin doch erst vor einigen Minuten eingeschlafen! – haderte der eigene schläfrige Geist. Es gibt wahrlich keinen Berufsjäger auf dieser Erde, für den man früh genug aufstehen könnte. Eben wollte ich mich wieder zur Wand drehen und die Augen schließen, da fiel mir der Hahn ein – und schon war ich draußen aus dem Bett. Ich richtete mich zur ersten Pirsch auf den Großen Hahn. Das Zimmer war ungeheizt, ich fröstelte vor dem Waschtisch. Gähnend schlüpfte ich in die Kleider, suchte lange nach dem rechten Wollstutzen. Das Gesicht bekam ein kaltes, der Magen in der Küche ein heißes Wasser, mit Teeblättern, Zucker und etwas Obstbrand angereichert. Dann verteilte ich vier Patronen auf verschiedene Rocktaschen, hängte die Flinte um und schwenkte den Loden darüber.
„Gemma!“ Die Dachsbracke begleitete uns bis zur Gartentür, dann traten wir aus dem Lichtkegel der Lampe hinaus in die Nacht. Die Sterne blinkten zwischen den dunklen Spitzen des Nadelwaldes. Von Süden wehte ein warmer, milder Nachtwind, der „Jauk“. Kleine Geräusche begleiteten uns, unsichtbare Frühlingsregungen und rinnende Schneeschmelze. Wir gingen bergauf. Einige Baumstämme knisterten im Wind. Überall murmelte Wasser, das machte es schwierig, den Hahn zu verhören. Die Lärchen trieben schon grün, doch schattseitig lag noch überall hoher Schnee.
Der Tag ruhte noch in der Ferne hinter den Bergen, als wir den bereits am Vorabend erkundeten Balzplatz erreichten. Die letzten Schritte dämpfte ein weicher Nadel- und Moosteppich. Den Loden legte ich auf einen Baumstock, ließ mich darauf nieder, lehnte die Flinte an das Knie und steckte die Hände in die Rocktasche. Der Förster rauchte neben mir eine gräßliche „Austria 3“.
Das erste Dämmerlicht kam. Aus der Tiefe der Nacht stieg ein Grau am Osthimmel auf, dann folgte ein helles Glühen, später liefen Lichtstrahlen über den Himmel. Die milde Morgenluft war prickelnd. Bis zum Sonnenaufgang blieb der Hochwald eine dunkle Wand. Die Bäume bildeten nur Silhouetten, zweidimensionale Erscheinungen ohne Tiefe, sie wirkten wie Kulissen aus Pappmaché. Mit wachsender Helligkeit erwachten dann die bisher verborgen gebliebenen Farben meiner Umwelt, und aus der Baumkulisse entstand allmählich das bekannte Bild des Waldes. Rötlich leuchteten die Stämme im ersten Morgenlicht auf, einige Zapfen strahlten wie Kerzen. Der Boden war naß und weich, im Westen erlosch der letzte Stern. Es lag etwas unendlich Traumhaftes in dieser ersten Stunde des Tages.
Wir beide konzentrierten uns besonders auf die Laute dieses Morgens. Mit geschlossenen Augen hört man besser, man riecht, atmet und spürt das Land ganz anders als mit offenen. Auch mein Begleiter saß regungslos wie eine Statue, nur zeitweise drehte er den Kopf in eine andere Richtung, um besser horchen zu können. Von Minute zu Minute wurde es im Wald lebhafter, kleine Sänger zwitscherten, der Kuckuck rief den Morgen aus, und ringsum tröpfelte, plätscherte und gluckste das Schmelzwasser.
Meine Kehle war ganz ausgetrocknet. Manchmal mußte ich schlucken, und selbst dieser kleine Laut störte mich jetzt. Alles in mir war nur ein selbstvergessenes Warten, ein angespanntes Horchen, ein Sich-Auflösen im Bergmorgen.
Fast wie ein Traum, zaghaft, leise und in längeren Abständen, ertönte zwischen dem Flüstern des Windes und dem Raunen des Wassers dann der erste Glocker. „Dck – dck“, kam es aus der Tiefe des Waldes. Der Hahn meldete.
Es waren nur einige Töne, dann wurde es wieder still. Der Jäger nickte mir einmal wortlos zu. Jetzt ertönte wieder das leise Balzlied, die zaghafte Ouvertüre. Der schwere Mann neben mir sprang lautlos auf. Er winkte mir kurz zu, und schon stand ich neben ihm. Sein Gesicht war ganz verzerrt von Aufregung und Jagdfieber. „Den können mir angehn, schau, daß d’ ihn nit verschiaßt.“ Die flüsternde Stimme klang heiser, der Mann schaute und horchte inzwischen in die Richtung des noch nicht sichtbaren Hahnes, sein Körper zitterte. Gestern noch hatte er zu mir gesagt, daß er kein Jagdfieber mehr kenne, da er so viele Hahnen erlebt oder erlegt habe! Jetzt aber „riß“ es ihn ganz ordentlich. Am liebsten hätte ich gelacht. Jetzt duzte er mich sogar, obwohl wir sonst streng per „Herr“ waren! Wir schlichen bergauf.
Erst nach etlichen Strophen, die wir ausnutzten, um ihn anzuspringen, erblickten wir ihn. Der Hahn balzte auf einer dunklen Fichte. Der sich flaschenartig verjüngende Stingel ragte in den hellen Himmel, die Schwingen hingen zwischen Zweigen herunter. Bevor ich aber auf Schußentfernung herangekommen war, ritt der Hahn ab und fiel in einiger Entfernung auf dem Boden ein. Deutlich konnte ich den Bremsflug der Schwingen hören. Dann war es so still wie zuvor.
Nach etwa hundert schleichenden, atemgespannten Gängen war ich wieder in seiner Nähe. Er tänzelte auf Kugelschußentfernung umher, schlug den Fächer auf und ließ die Schwingen bis zum Boden heruntersinken. Die Lichtung, auf der er stand, war eine breite, im Sonnenlicht leuchtende Schneefläche. Den Hintergrund bildete die dunkle Wand der Fichten. Auf dieser Naturbühne, vor dieser mächtigen Kulisse, spielte der Hahn seine einzigartige Rolle. Majestätisch glitt er über den Schnee, wie ein Fabelwesen. Der Wald, der Morgenhimmel hielten ihren Atem an, nur der meine ging schnell und stoßweise: dunkel, hell, dunkel – Wald, Schnee und Hahn. In der prachtvollen Bodenbalz hob der schwarze Vogel den weißgesprenkelten Fächer, wölbte bei jedem Schritt den grünblauen Schild, und der himmelwärts gerichtete Kopf mit den dunkelroten Rosen und dem gesträubten Kehlbart zuckte beim Schleifen.
Plötzlich verstummte er. Ich stand regungslos, balancierte auf einem Bein. Dann begann der Hahn wieder. Ich kam wieder etwas näher an ihn heran. Doch im nächsten Augenblick war der Zauber zu Ende: Eine Henne strich plötzlich polternd vor mir ab, der Hahn war gewarnt und folgte ihr. Aus war es!
An diesem Morgen und auch an den nächsten hatten wir kein Weidmannsheil. Wir bekamen zwar noch zwei Hahnen in Anblick, doch strichen sie vorzeitig ab.
Nun folgten Tage auf der Alm, die ich nie vergessen werde. Das Gebirge glitzerte und glänzte in der Frühlingssonne, der Himmel war hellblau, die Sonne brannte heiß herunter, die Schneehänge leuchteten im Licht, und ein warmer Wind weckte die Lebensgeister. Jeden Morgen und jeden Abend waren wir im Revier. Der Hochwald brauste im Föhnwind wie aufgebracht. Stämme ächzten, Äste schlugen und knisterten, es gab keinen Augenblick lang Stille. Manchmal glaubten wir, den Hahn melden zu hören, dann war es aber doch nur der Wind.
„Wie verhext!“ brummte mein Begleiter mißgelaunt. „Bei dem Wind is nix zu machen.“ Dennoch harrten wir stets bis zur Dunkelheit aus, jedoch vergeblich. Kein einziger Hahn war klar zu verhören. In der Früh strömte der Südwind, der Sonnenaufgang war unbeschreiblich schön, doch außer dem Knistern und Stöhnen des Windes im Astwerk war nichts zu hören. Bei den abendlichen Pirschgängen, beim üblichen „Verhören“ der Hahnen, hatten wir ebenso Pech. Nichts schien zu stimmen, nichts gelang.
Nun mußte ich einmal herunter vom Berg, um daheim nachzusehen. Zu dieser Zeit führte ich noch ein ziemlich „freies Leben“ als Architekt und ein Ein-Mann-Büro; die präzise Tageseinteilung eines Professors stand mir noch bevor. Ich fuhr also ins Tal, in die frühlingswarme Tiefe hinunter, dorthin, wo schon Roßkastanien und Kirschen blühten.
Es war eine Fahrt aus der Welt der winddurchrüttelten Wälder und der kargen, spätwinterlichen Almwiesen in die Fülle des Frühlings hinunter. Hinter mir glühten die Schneefelder der Koralpe, unter mir lag ein Nebelmeer auf halber Höhe, am Hang war alles farbig und frisch. Wie im südlichen Tiroler Land lagen auch hier – in der Weststeiermark – Rebengarten und Hochgebirge in unmittelbarer Nachbarschaft. Unten am Fuße des Bergstockes gedeihen Wein, Edelkastanie und Pfirsich, oben aber herrscht die Gebirgswelt mit Wäldern und Almen, mit Hirschen, Gamswild und Auerhahn. Die Aussicht war überwältigend schön, ich blickte bis zum Gleichenberger Kogel, bis zum südlichen Burgenland, bis in die Windischen Büheln hinunter.
Zur Abendpirsch war ich dann wieder im Revier auf der Hebalm. Wir verhörten die Hahnen ohne viel Erfolg. Morgens waren wir, der Förster und ich, wieder draußen, wir warteten und spitzten die Ohren. Mein Begleiter saß im Dunkeln neben mir, die Spielhahnfeder an seinem Hut bildete einen komischen Kontrast zu der unter der Hutkrempe herausragenden kräftigen Hakennase; eine Komposition von konvexen und konkaven Linien: Nase, Hutkrempe und Hahnsichel. Er schien sogar mit dem wohlentwickelten Riechorgan zu lauschen, wobei sich die mir wohlbekannten Gesichtszüge im Dunkel völlig veränderten.
Langsam kam der Morgen über dem Hochwald herauf. Das erste pastellzarte Licht erschien am Himmel. In diesem schwebenden Augenblick zwischen Nacht und Tag ertönte leise, im Abstand mehrerer dröhnender Menschenherzschläge aneinandergereiht, die knappe Ouvertüre. Der Hahn glöckelte. Bedächtig tropften die ersten Töne des Balzliedes. Dann gab es wieder Stille. Erstarrt und verzaubert empfing ich die Zeichen.
Stille.
Der Wind spielte leise im Nadelwald. Jetzt meldete der Hahn wieder, das Knappen wurde immer schneller, deutlich hörte ich den Hauptschlag. In immer rascherer Folge ertönten die Balzstrophen. Schon glaubte ich, meines Hahnes in den nächsten Minuten habhaft zu werden. Doch es kam anders. Der Hahn ritt ab, bevor ich ihn anspringen hätte können. Verhext! Und auch die nächsten Tage ging es mir bei der Hahnjagd nicht besser. Ich erlebte die Balz in ihren schönsten Formen, doch zu Schuß war ich nicht gekommen. Ich hatte dabei Zeit genug. Vom Namenstag des hl. Georg an bis Ende Mai ging ich meinem Hahn auf der Hebalm nach. Ich lebte schon mehr im Revier als daheim. Nichts half. Die Hahnbalz erlebte ich zwar intensiver als jemals gedacht, doch nicht ein einziges Mal konnte ich meine Flinte auf den dunklen Recken richten. Es kam einfach nicht dazu.
Einen Großen Hahn zu erlegen, ist die schwerste Geduldsprobe der gesamten jagdlichen Breite, war mein abschließendes Resümee über den vergangenen Frühling. Es stiegen in mir auch starke Zweifel an den Berichten anderer auf, die erzählt oder geschrieben haben, wie sie nach ein, zwei Pirschgängen ihren Hahn angesprungen und erbeutet hatten. Leute, die einen Großen Hahn erlegten, gehörten in meinen Augen nunmehr zu besonders begünstigten und glückvollen Jägern. Daß ich nie einer von ihnen war, das wußte ich schon lange vorher. Bei mir dauerte jeder jagdliche Erfolg stets eine Ewigkeit; nicht nur beim Auerhahn. Mit Bewunderung gedachte ich meines mütterlichen Großvaters, der dem preußischen Schlesien entstammte, in meinem Geburtsland Ungarn sein Leben verbrachte und von dort aus jagdliche Reisen – stets mit Erfolg! – auf den Großen Hahn unternahm. Die von ihm erlegten Hahnen standen in Balzstellung präpariert in der Diele des großelterlichen Hauses in meiner unvergessenen Heimatstadt. Als kleiner Bursche bewunderte ich sie und beneidete meinen glücklichen Großvater jedesmal, wenn ich bei den alten Herrschaften zum Mittagessen war! Würde ich jemals zu einer solchen Trophäe kommen? Es schien, als hätte die Zeit für mich keinen Großen Hahn mehr übrig gehabt!
Ein Jahr verging nach dem Hebalm-Frühling. Oft dachte ich daran, ob ich wohl nochmals Gelegenheit zur Jagd auf den Großen Hahn erhalten würde. Meine Chancen beurteilte ich recht pessimistisch. Es kam aber anders. Kaum, daß es wieder Frühling war, sprach mich ein alter Freund und Weidkamerad an. Er bot mir die Vermittlung zu einer Jagd in der Gegend von Mariazell an. Ich nahm mit Freude an. Von einem raschen Jagderfolg wagte ich nicht einmal zu träumen. Meine Frau begleitete mich, und wir nahmen auch unsere beiden kleineren Kinder mit unter dem Motto, daß es hier viel Zeit für Wandern und Besichtigen geben würde.
Wir kamen spätabends im Hotel an. Dort erwartete mich bereits die Nachricht, daß der Aufsichtsjäger des Reviers mich morgens um drei Uhr abholen würde.
Es gelang mir dann in der Früh, so lautlos hinauszuschleichen, daß meine Frau gar nicht geweckt wurde. Der mich erwartende Jäger war ein sympathischer, jüngerer Mann; wir waren bald draußen im Revier. „Gestern auf d’ Nacht hab’ i an Hahn verhört, den kriagn ma heut!“ meinte der Jäger voller Überzeugung. Ich aber dachte meinen Teil.
Es dämmerte leise, als wir den ersten Glöckler wahrgenommen haben. Nun folgten immer rascher die Balztöne. Wir sprangen los. Es war ein großartiger Anblick, als ich den Hahn entdeckte. Er stand in einer hellgrünen Lärche. Das aufsteigende Morgenlicht schimmerte durch den dünnen Vorhang der weichen Nadeln und vergrößerte noch den Körper des dunklen, wuchtigen Urvogels. Ich deutete meinem Begleiter an, daß ich den Hahn allein anspringen wolle. Er hob wortlos den Hut. Beim nächsten Schleifen sprang ich los. Knappen: Atemloses Stehen, erstarrtes Warten mit suchendem Blick. Hauptschlag: Anspannen des Körpers. Schleifen: zwei, drei rasche Schritte. Dann wiederholte sich das Spiel mit der strengen jagdlichen Choreographie im Rhythmus des Balzliedes, zehnmal, zwanzigmal, wer zählt die Strophen und Schritte, wenn er den Hahn vor sich hat, wenn er, wie von einer Urgewalt angezogen, in die Richtung der Balztöne strebt?
Wieder gab es eine Pause.
Ist der Hahn vielleicht mißtrauisch geworden? Spürte er die heranschleichende Gefahr? Hat er mich am Ende eräugt? Ich versteckte mein Gesicht hinter einem Baumstamm, damit es nicht zum Hahn hinaufleuchtete. Mein Atem fuhr dabei schwer in Rinde und Moos, ich roch Waldluft und Harzduft. Die nächste Strophe erlöste mich; nach dem Hauptschlag glitt ich weiter.
Jetzt sang der Hahn wieder, der Zweig erzitterte unter ihm wie von Leidenschaft berührt. Und wieder kam ich näher an ihn heran. Ich traute mich nicht, den großen Vogel mit sehnsuchtsvollen Augen anzustarren. Jetzt kam wieder das Schleifen, abermals kam ich näher. Nun mußte ich zu ihm hinaufblicken, zu dem dunkelgrünen Schild. Der Hahn stand tiefdunkel im Geäst, zeigte seine ganze Breite. Der helle Schnabel öffnete sich weit im Jubel des Liedes, die gesträubten Kehlbartfedern bewegten sich wie die grünen Lärchentriebe.
Beim nächsten Hauptschlag hob ich langsam die Flinte. Das letzte Schleifen ging im Schuß unter.
Schwer stürzte der Hahn durch die Äste zu Boden, im Fallen streifte er die Nadeln und schlug dann weich in der kleinen Schneemulde auf. Einige Male zuckte er noch, nachfallende Federn segelten lautlos herunter und legten sich zu ihm. Dann war es still, nur das Schmelzwasser murmelte und der Morgenwind betete leise.
Ich stand neben meinem erlegten Hahn. Ich spürte, daß ich vor einigen Sekunden aus der Unendlichkeit der Welt ein Stück herausgerissen hatte, dessen Gewicht meine Seele eben noch ertragen konnte. Ich spürte hier in der knisternden Windbrandung, daß ich den Frühling und den Hahn als ein einziges Wunder in mein Leben eingeschlossen hatte. Andacht, leidenschaftliche Freude der Erfüllung, Dankbarkeit und Mitleid hielten mich fest, hefteten meinen Blick abwechselnd auf Hahn und Himmel.
WILHELM BRENNER (1927–2011), in Steinamanger (Westungarn) geboren; stammt aus einer traditionsreichen Bürgerfamilie. Architekturstudium an der Technischen Universität von Budapest; ab 1956 freischaffender Architekt und Professor an einer höheren Schule in Graz. Autor und Mitautor mehrerer Bücher mit jagdlichen und kunstgeschichtlichen Themen; verbrachte seine ganze Freizeit in „seinem“ Revier im Burgenland; im Reinersdorfer Jagdhaus entstanden seine Erzählungen.
W. Brenners Erzählungen – eine ganz Österreich umfassende Lyrik der Landschaft – verkörpern den gelungenen Versuch, aus der traditionellen und zum Teil nur der Vergangenheit verschriebenen Jagdliteratur in die Gegenwart des jagdlichen Alltags zu gelangen. Als feinsinniger Beobachter und Erzähler schilderte er seine Erlebnisse im jagdlichen Alltag, als Jäger und Dichter der Landschaft reiste er umher und hielt seine Eindrücke fest, die zu einer Liebeserklärung an die Schönheit der österreichischen Landschaften werden.