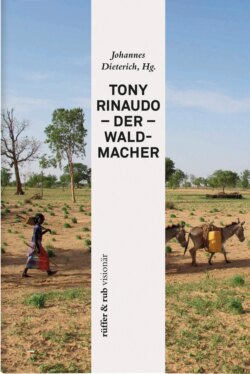Читать книгу Tony Rinaudo - Der Waldmacher - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Ist das nicht Tony?«
Johannes Dieterich
Hier könnte man ohne Weiteres »Heidi« filmen. Der Wildbach plätschert lustig vor sich hin. Glücklich mampfen die Kühe das saftige Gras. Das Kinn auf seinen Stock gestützt blickt ein Hirtenjunge verträumt ins Tal. Nur die dunkle Haut des Knaben lässt ahnen, dass hier nicht Heidis Heimat ist. Und zwei nahe gelegene, mit Gras bedeckte Hütten verraten vollends, dass sich diese Postkartenidylle auf einem anderen Kontinent abspielt, weit weg von der Schweiz. Wir befinden uns in Afrika, genauer gesagt: in den Bergen nahe der südäthiopischen Stadt Sodo.
»Wenn Sie vor zehn Jahren hier gewesen wären, würden Sie noch viel mehr staunen«, sagt Tony Rinaudo. Der australische Agrarexperte scheint vor Glück gleich zu platzen: Als der Melbourner im Jahr 2006 zum ersten Mal nach Sodo kam, sahen die Berge noch wie nach einer Naturkatastrophe aus. Statt von Bäumen und Gras war die Landschaft damals höchstens von stacheligen Büschen und Kriechpflanzen bedeckt, die Erosion hatte tiefe Furchen in die Abhänge gerissen, bei starkem Regen stürzten regelmäßig Schlammlawinen ins Tal. Sie rissen zuweilen sogar einige der afrikanischen Rundhütten mit sich: Einmal wurde eine fünfköpfige Familie unter den Erdmassen begraben.
In jener Zeit waren die Menschen in der Region Sodo noch auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen – wie im 50 Kilometer weiter südwestlich gelegenen Dörfchen Humbo, dessen Hausberg dem nackten Buckel eines Nilpferds glich. Tony Rinaudo war damals von der Hilfsorganisation World Vision nach Humbo geschickt worden, um eine der letzten noch fließenden Quellen einzufassen. Der Agrarexperte sah allerdings schnell, dass die dortige Bevölkerung ein wesentlich größeres Problem als die nicht eingefasste Quelle hatte: Mit dem ständigen Abholzen der Bäume und dem Übergrasen der Weiden hatte sie ihre eigene Lebensgrundlage zerstört.
»Wir haben oft darüber geredet, ob wir wegziehen sollten«, erinnert sich Anato Katmar, dessen drei Hektar große Farm am Fuß des ehemaligen Nilpferdbuckels liegt: »Aber wohin?« Damals lebte er mit seiner Frau und den fünf Kindern noch in eine kleine Hütte gezwängt, die Mais- und Sorghum-Ernte fiel Jahr für Jahr miserabler aus, von dem kahlen Hügel kullerten ab und zu Felsbrocken in seine Felder und zermalmten die Pflanzen. Von der Höhe herab war als einziger Laut der noch übrig gebliebenen Tierwelt das höhnische Bellen der Paviane zu hören: Die Affen fraßen jedes bisschen Grün weg, das sich auf dem nackten Hügel zeigte. Viele Abende im Jahr gingen die Katmars hungrig ins Bett.
Äthiopien gilt als das Hungerland des Kontinents schlechthin. Aus dem inzwischen über 100 Millionen Einwohner zählenden Staat am Horn von Afrika wurden einst die schlimmsten Dürrekatastrophen der Erde gemeldet. Bis Bob Geldof mit seiner »Band Aid« 1984 das Gewissen der Weltöffentlichkeit wachgerüttelt hatte, mussten eine halbe Million Äthiopier sterben. Noch heute hat das Land – wie die meisten der 55 Staaten des Kontinents – Schwierigkeiten, seine Bevölkerung zu ernähren: Während die Zahl der Hungernden in den vergangenen 25 Jahren weltweit zurückging, ist sie in Afrika weiter gestiegen. Und zwar von 181,7 Millionen Menschen im Jahr 1990 auf 232,5 Millionen im Jahr 2017.
Für die chronische Krise werden neben politischen und klimatischen Ursachen auch ökologische Einschnitte verantwortlich gemacht: allen voran die Verschlechterung der Böden und das Verschwinden der Bäume. Äthiopien, das einst zu weiten Teilen mit Wald bedeckt war, hat in den vergangenen 50 Jahren fast 90% seiner stämmigen Pflanzen verloren. Doch wenn sich Experten über eines einig sind, dann ist es die Bedeutung der Bäume für die Qualität der Böden: Sie halten die Erde fruchtbar und feucht, sorgen mit ihrem Schatten für wesentlich geringere Bodentemperaturen und brechen den Wind, der ansonsten die in der Trockenzeit zu Staub zerbröselte Erde fortträgt.
Am schlimmsten hat die ökologische Verheerung die Sahelzone heimgesucht. Dort breitete sich die Wüste bis vor zwanzig Jahren immer weiter in Richtung Süden aus, die Bäume verschwanden. Fast alle Versuche, der zunehmenden Verödung in den trockenen Landstrichen mit dem Pflanzen neuer Bäume Herr zu werden, schlugen fehl: Die meisten der teuren Setzlinge erlebten nicht einmal ihren ersten Geburtstag. »Millionen von US-Dollar wurden verschwendet«, sagt Tony Rinaudo, der einst für Wiederaufforstungsprogramme in der Sahelzone zuständig war: »Wenn ein Bruchteil unserer Setzlinge überlebte, konnten wir froh sein.«
Das soll nun allerdings Vergangenheit sein, sagt der ansonsten ausgesprochen bescheiden auftretende Australier. Der Agronom aus Melbourne will eine wesentlich erfolgreichere Methode der Wiederbewaldung und Wiederbelebung der Böden gefunden haben – und zwar zum Nulltarif. Rinaudo hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als dem Hunger in Afrika den Garaus zu machen: Seine Entdeckung könnte für den Kontinent bedeutender als Milliarden von US-Dollar an Entwicklungshilfe werden.
»Hol mich hier raus«
Als der Australier 1999 erstmals nach Humbo kam, wurde er nicht wie der Messias begrüßt. Die Dorfbewohner standen dem fremden Agrarexperten wenn nicht gar feindselig, so doch zumindest skeptisch gegenüber. Sie argwöhnten, dass das Bleichgesicht im Auftrag ausländischer Agrarkonzerne unterwegs sei. Seine Vorschläge, auf den ohnehin ausgemergelten Feldern auch noch Bäume wachsen zu lassen, die hungrigen Rinder vom kahlen Hügel fernzuhalten und den Köhlern das Schlagen von Brennholz zu verbieten, klangen unsinnig oder sogar verdächtig: Mit dem merkwürdigen Baumfreund wollte man lieber nichts zu tun haben. Anato Katmar gehörte zu den wenigen, der dem Fremden eine Chance einzuräumen bereit war: Womöglich, weil er ohnehin nichts mehr zu verlieren hatte. »Tony«, sagt Katmar, »war meine letzte Chance.« Für seine erste Kooperative musste sich Rinaudo mit einer Handvoll Farmern begnügen: Die sahen sich zu allem Überfluss auch noch dem Gespött und Misstrauen ihrer Nachbarn ausgesetzt.
Heute gibt es in Humbo sieben Kooperativen mit über fünftausend Mitgliedern, keiner von ihnen scheint mehr an Tony Rinaudos Methode zu zweifeln. Während die anderen Dörfer der Region im El-Niño-Jahr 2016 wieder einmal auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen waren, wurden in den Kooperativen am Fuß des Nilpferdrückens Überschüsse eingefahren: Sie werden zur Verteilung in bedürftigen Teilen des Landes an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) verkauft. Der Hügel selbst ist inzwischen wieder von mehr als zwei Meter hohen Bäumen bewaldet, und auf den Farmen wachsen Obstbäume, die außer Schatten auch Früchte – und hin und wieder einzelne Äste als Brennholz abwerfen. Statt seiner Rundhütte konnte sich Anato inzwischen ein richtiges Haus mit Backsteinen und Wellblechdach leisten. Außer dem obligatorischen Mais und Hirse baut er Kaffee und Bananen an, die er zusammen mit den Mangos aus dem Garten auf dem Markt verkauft. Den Erlös investierte der Farmer in die Ausbildung seiner Kinder: Die zwei Ältesten schlossen bereits ihr Studium ab, die drei Jüngsten gehen noch ins Gymnasium. Bei den Katmars gibt es inzwischen dreimal täglich zu essen: »Hunger«, sagt Vater Anato, »kennen wir nur noch aus der Erinnerung.«
Tony Rinaudo folgt den Erzählungen seines Musterfarmers mit strahlender Miene – für den Agronomen geht in Humbo ein Traum in Erfüllung. Schon Anfang der 1980er-Jahre war Rinaudo von seiner Mission »Serving in Mission« (SIM) in den Niger geschickt worden: Dort sollte er den Vormarsch der Wüste mit dem Pflanzen neuer Bäume stoppen. Mehrere Jahre lang ging der Australier als Don Quichotte der Setzlinge gegen die alles verheerenden Sandmühlen vor: Kaum 10% seiner Bäumchen hätten nach dem Einpflanzen die Hitze und die staubigen Stürme überstanden, erinnert er sich. Und falls einer der Setzlinge mal durchkam, wurde er später von Ziegen gefressen oder noch später zu Brennholz zerhackt. Schließlich hätte Rinaudo mit seiner Geduld auch fast noch den Glauben verloren: »Hol mich hier raus«, haderte er wie einst Hiob mit seinem Gott.
In der Wahrnehmung des ehemaligen Missionars ging seine Geschichte in Maradi auch biblisch weiter. Eines Tages, als Rinaudo gerade Luft an den Reifen seines Geländewagens herausließ, um besser durch die trostlose Sandlandschaft zu kommen, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Bei den grünen Trieben, die überall um ihn herum aus dem Sand sprossen, handelte es sich mitnichten – wie er bislang immer angenommen hatte – um nutzloses Kraut: Sie stellten sich bei genauerer Betrachtung vielmehr als Baumtriebe heraus. Wenn diese jedoch mitten im Sand wachsen konnten, musste sich unter ihnen ein noch intaktes Wurzelwerk befinden, folgerte Rinaudo: Und weil dasselbe Phänomen überall in der Region zu beobachten war, durfte man von einem riesigen Wurzel-Netzwerk unter dem Sand der Sahelzone ausgehen. Bäume, die gewissermaßen verkehrt herum im Wüstenboden stecken, schwante dem Agrarexperten: ein unterirdischer Wald.
Sein Damaskus-Erlebnis stellte Rinaudos Welt vom Kopf auf die Füße. Wenn man den grünen Trieben im Sand nur eine Chance gäbe, würden sie ganz von selbst zu Bäumen heranwachsen, mutmaßte er: Sein verzweifeltes Pflanzen neuer Bäume war womöglich völlig überflüssig. Alles, was man zur Regeneration der verheerten Landschaft brauchte, war ein Taschenmesser, das Rinaudo ständig mit sich trägt: Damit pflegt er die zum Verbuschen neigenden Triebe der Bäumchen zu beschneiden. Weil die Sprösslinge auf die noch im Wurzelwerk gelagerten Nährstoffe, vor allem Zucker, zurückgreifen können, wachsen sie meist in atemberaubendem Tempo zu ausgewachsenen Bäumen heran. Er habe schon oft beobachtet, wie aus einem kümmerlichen Stämmchen innerhalb von drei Jahren ein fünf Meter hoher Baum geworden sei, sagt der Australier.
Stadt der unbenützten Tankstellen
Maradi muss die Stadt mit der weltweit größten Zahl an Tankstellen pro Einwohner sein: An den Einfallstraßen der nigrischen Provinzstadt finden sich Spritstationen wie andernorts Telegrafenmasten aufgereiht. Die meisten sind allerdings nicht in Betrieb: Sie verdanken ihr Dasein lediglich einer Bestimmung der nigrischen Regierung, wonach nur derjenige eine Genehmigung zum Export von Kraftstoff ins Nachbarland Nigeria erhält, der eine Tankstelle besitzt. Mit dem kleinen Grenzverkehr lässt sich offenbar dermaßen viel Geld verdienen, dass sich der Bau einer nutzlosen Pumpstation schnellstens amortisiert: Ein Beispiel für die bürokratischen Abenteuerlichkeiten, mit denen die knapp 17 Millionen Einwohner des westafrikanischen Staats leben müssen.
Ansonsten ist Maradi wie jede andere Provinzstadt in diesen Breitengraden: zu heiß, zu staubig und dennoch rund um die Uhr lebendig. Nur die schlimmste Mittagshitze verbringen die Fahrer der allgegenwärtigen Motorradtaxis über den Tank ihrer chinesischen Maschinen ausgestreckt, während betagte Peugeots 404 weiterhin über die meist ungeteerten Straßen rumpeln und sich alte Männer auf Steinbrocken sitzend mit Brettspielen die Zeit vertreiben. Das einzige saftige Grün in der mit einem sandfarbenen Film überzogenen Stadt ist im Stadion mit seinem von der Fifa finanzierten künstlichen Rasen zu finden. Viehhirten aus der Umgebung rückten regelmäßig mit ihren Herden an, erzählen sich die Städter spöttisch: Im Glauben, dass sich in der Fußballarena frisches Gras befinde. Ansonsten haben auch die Stadtbewohner wenig zu lachen: In Maradi verfügt nicht einmal die Hälfte der Arbeitsuchenden über einen Job, die meisten der nahezu eine Million zählenden Einwohner müssen mit dem Äquivalent eines Euros am Tag auskommen. In ihren Hütten aus Wellblech gibt es meist weder fließendes Wasser noch Strom.
Die Sahelzone ist das Stiefkind des Kontinents, der selbst schon aus zerrütteten Verhältnissen stammt: In dem wenige hundert Kilometer breiten Landstrich, der sich vom Senegal im Westen des Erdteils bis zum ostafrikanischen Sudan hinzieht, scheint die Armut noch tiefer verwurzelt zu sein als der wilde Feigenbaum mit seinen bis zu 120 Metern in die Erde reichenden Trieben. Aus der Sahelzone stammt ein beträchtlicher Teil der Migranten, die ihr Glück trotz der lebensgefährlichen Reise im europäischen Nachbarkontinent suchen. Hier fällt auch den zornigen Islamisten – die den Einfluss der christlichen Weltherrscher als zumindest eine der Ursachen ihres Elends betrachten – die Rekrutierung neuer Kämpfer nicht schwer. Nicht weit von Maradi entfernt treibt die nigerianische Sekte Boko Haram ihr Unwesen, deren Name so viel wie »westliche Erziehung ist Sünde« bedeutet. Und im Norden des Nigers sind Mitglieder der Terrorgruppe »Al Kaida im Maghreb« aktiv. Westliche Militärs betrachten die Sahelzone als ein derart gefährliches Terrain, dass sie dort Tausende ihrer eigenen Soldaten stationiert haben. Doch auch die französischen, amerikanischen und deutschen Truppenkommandeure wissen, dass den wahren Gründen der Gefahr nicht mit Waffengewalt beizukommen ist. Es ist die Armut, die besiegt werden muss, und das ist Rinaudos Metier.
Hausa wie ein Esel aus Kano
»Tony, Tony!«, ruft ein älterer Mann, als er am Dorfrand von Dan Indo den Beifahrer mit der hellen Haut im Geländewagen erkennt: Kurze Zeit später ist das Fahrzeug von einem Schwarm Jugendlicher und einem guten Dutzend lachender Männer umringt. Trotz seiner inzwischen grau melierten Haare erkennt jeder den ehemaligen Missionar auf Anhieb – man klatscht in die Hände, umarmt sich und schüttelt ungläubig den Kopf. Ein stattlicher Mann stellt sich auch selbst als Tony vor: Seine Eltern haben ihn vor mehr als dreißig Jahren nach dem Australier benannt. Keinesfalls der einzige dunkelhäutige Tony im Maradi-Distrikt, wie sich im Verlauf unseres Besuchs herausstellt. Legt man als Maßstab die Ausbreitung seines Namens an, muss Rinaudo hier hervorragende Arbeit geleistet haben.
Sule Lebo, der Dorfälteste von Dan Indo, will die Hand seines Besuchers gar nicht mehr loslassen. Die beiden unterhalten sich in Lebos Muttersprache Hausa, was diesen immer wieder laut auflachen lässt: »Er kann es noch immer!«, klatscht sich der Bürgermeister auf die Schenkel. Tony spreche Hausa »wie ein Esel aus Kano«, heißt es in den kommenden Tagen immer wieder: Das ist als Kompliment gemeint.
Nach der überschwänglichen Begrüßung kommt Sule Lebo allerdings schnell zur Sache. Die vergangenen Jahre seien hart gewesen, erzählt der Dorfchef: Der Regen fiel miserabel aus, die Ernten waren schlecht, schließlich musste sich der 63-Jährige auch noch für umgerechnet EUR 400 an der Prostata operieren lassen. Um das Schulgeld seiner Kinder zahlen zu können, sah sich Lebo gezwungen, drei seiner acht Ochsen zu verkaufen – und trotzdem geht es dem Farmer mit seinen zwei Frauen und 17 Kindern heute wesentlich besser als zu Beginn der 1980er-Jahre, als er Rinaudo kennenlernte. Damals bewirtschaftete Lebo nur drei Hektar Land, heute sind es 22. Erntete er damals noch lediglich 150 Kilogramm Hirse pro Hektar, so sind es heute 500 Kilogramm. Und die rund zwanzig Ziegen und Schafe seiner Frau gab es damals auch noch nicht. Als der australische Agronom hier mit der Arbeit begann, habe man zwischen dem Dorf und der rund zwei Kilometer entfernten Teerstraße kaum einen Baum gesehen, fährt Lebo fort: Heute stehen Hunderte von ihnen über die Felder verteilt.
Der Dorfchef war einer der wenigen, der Rinaudo damals eine Chance einräumte: Dan Indo wurde zu einem der ersten Projektdörfer des ausländischen Agrarexperten. Der Feldversuch hätte kaum besser verlaufen können: Schon nach wenigen Jahren waren auf den Äckern der Dorfbewohner wieder zahlreiche Bäume herangewachsen – sie spendeten Schatten, senkten die Bodentemperatur, brachen den Wind und gaben ganz nebenbei auch noch Holz zum Hüttenbau oder Feuermachen ab. Lebos Ernteeinnahmen verdreifachten sich, allein mit dem Verkauf von Holz verdient er inzwischen jährlich rund EUR 130, für nigrische Verhältnisse eine stattliche Summe. Mit seinen zahlreichen Feldern, den Ochsen, Ziegen und Hühnern ist dem Kleinbauern der Aufstieg zum diversifizierten Farmer geglückt: Das habe er neben dem Allmächtigen vor allem Tony zu verdanken, lacht Lebo.
Ansonsten ist das Bild, das beim Abklappern mehrerer Dörfer in der rund 30 Kilometer nördlich von Maradi gelegenen Region entsteht, durchaus vielfältig. In Waye Kai verfügt Dorfchef Dan Lamso nach eigenen Worten über »so viele Bäume«, dass er sie »gar nicht mehr zählen« könne. Als Ausdruck seiner Dankbarkeit überreicht er Rinaudo zwei Hähne, die lauthals protestierend auf der Ladefläche des gemieteten Geländewagens landen. Keine zwanzig Kilometer entfernt ist die Laune schon etwas gedrückter: Hier hat sich die Zahl der Bäume auf den Feldern der Dorfbewohner in den vergangenen zwei Jahren drastisch reduziert. Um ihre der Dürre zugeschriebenen Ernteverluste auszugleichen, verkauften die Kleinfarmer große Mengen an Holz. Wenigstens seien sie so einigermaßen glimpflich über die Runden gekommen, tröstet sich Rinaudo: »Bäume können wie ein Sparkonto sein, von dem man in schlechten Zeiten zehrt.«
Irritiert zeigt sich Rinaudo von den Zuständen in Sarkin Hatsi, wo er gleich zu Beginn des Besuchs von einer Frau angebettelt wird. »Geh auf dein Feld und kümmere dich um die Pflanzen und Bäume, dann brauchst du nicht zu betteln«, bekommt die Bittstellerin zu hören: Der ehemalige Missionar will keine Almosen verteilen, sondern Bedingungen verändern. »Ist das nicht Tony?«, ruft ein Mann vom Nebenhaus, dessen Arm in einer Schlinge steckt: Damani Idi verletzte sich beim Sturz vom Dach die Schulter. Der 58-Jährige stellt sich als einstiger Musterschüler Rinaudos heraus: Er ließ auf seinen Feldern Hunderte an Akazien sprießen und machte aus ihren Kernen Kaffee. Seinen Röstbetrieb habe er inzwischen allerdings eingestellt, erzählt Idi: Sein Sieb sei kaputtgegangen. »Ach, Unsinn!«, protestiert Rinaudo: Ein neues Sieb könne höchstens ein paar Euro kosten. Dann sei er eben zu faul gewesen, würgt der Farmer weitere Nachfragen ab – offensichtlich sucht der Vater von 13 Kindern (von denen sechs bereits gestorben sind) einer substanziellen Unterhaltung aus dem Weg zu gehen. Um herauszufinden, was in dem Dorf tatsächlich vor sich geht, würde er sehr viel mehr Zeit brauchen, als ihm jetzt zur Verfügung stehe, sagt Rinaudo. Festzuhalten ist zumindest, dass sich nicht alle Probleme einer Dorfgemeinschaft mit Bäumen lösen lassen.
Von allen besuchten Dörfern macht Tambara Sofoua den besten Eindruck: Hier hat die Bevölkerung sogar eine Bürgerwehr zum Schutz vor Baumdieben auf die Beine gestellt. Ein von der Hilfsorganisation World Vision bezahlter Fachmann ist außerdem damit beschäftigt, die unter dem sperrigen Begriff »Farmer Management Natural Regeneration« (FMNR) bekannt gewordene Methode Rinaudos noch zu verfeinern: Derzeit zeigt er den Kleinbauern, wie man anderen Bäumen die Triebe eines Ziziphus mauritania aufpfropft. Denn dessen Frucht, der »Pomme de Sahel« oder Sahel-Apfel, lässt sich auf dem Markt für gutes Geld verkaufen. Während seiner Zeit in Maradi experimentierte Rinaudo auch mit der Einführung nicht einheimischer Bäume. Wegen ihres schnellen Wachstums, ihrer Resistenz gegen die Dürre und den nährstoffreichen Kernen hatte es ihm vor allem die australische Acacia colei angetan, die bereits von der nigrischen Regierung ins Land geholt worden waren. Mit deren Kernen erzielten Kleinbauern beachtliche Erfolge: Baro Yacouba aus Kumbulla begeisterte seine Nachbarn mit Akazien-Spaghetti und Akazien-Pfannkuchen. Rinaudo redet über das Thema allerdings nicht gerne: Denn unter einigen Wissenschaftlern stieß sein Baumimport auf scharfe Kritik. In fremder Umgebung hätten Bäume grundsätzlich nichts zu suchen, meinten die Bio-Fundamentalisten: Der »biologische Imperialismus« habe bisher nur Unheil angerichtet. Rinaudo ist die ideologische Debatte ein Graus. Es gebe keine »guten« oder »schlechten« Bäume, meint der Agronom: »Es kommt ausschließlich darauf an, wie man sie einsetzt und behandelt.«
Seen in der Wüste
Auf der Rückfahrt nach Maradi ziehen dunkle Wolken auf. Wenig später fängt es zu schütten an – und das noch vor der eigentlichen Regenzeit, die sich gewöhnlich eher zaghaft ankündigt. Einen derartigen Wolkenbruch habe er im Niger noch nie erlebt, schwärmt Rinaudo, während sich die Halbwüste um uns herum in eine Seenlandschaft verwandelt. Damals sei höchstens nachts Regen gefallen, fährt der Agrarexperte fort: Tagsüber sei es für Niederschläge vermutlich »zu heiß« gewesen, die vom hellen Sand reflektierte Hitze habe womöglich die Wolken vertrieben. Rinaudo ist überzeugt davon, dass sich der vermehrte Baumbestand auch auf das Mikroklima auswirkt. Er habe schon oft beobachtet, wie sich Wolken über erhitzten freien Flächen verziehen, während sie über kühleren Waldstücken abregnen. Noch steckt die mikroklimatische Forschung in den Kinderschuhen: Doch dass Bäume den Niederschlag beeinflussen, scheint inzwischen weithin anerkannt zu sein.
Tony Rinaudo freut sich, dass sein Besuch mit den ersten Niederschlägen der Saison zusammenfällt: So kann er sich, natürlich im Scherz, als Regenmacher brüsten. Wer die Afrika-Auftritte gönnerischer westlicher Besserwisser kennt, weiß Rinaudos Umgangsform mit Afrikanern zu schätzen: Er ist herzlich, ausgesprochen höflich und immer bescheiden. Ein besonderes Verhältnis verbindet ihn mit Joho, seinem ehemaligen Mitarbeiter, den er für unseren Besuch wieder als Fahrer angeheuert hat. Die beiden krümmen sich vor Lachen, als sie sich während der Fahrt an alte Zeiten erinnern – alles in Hausa, versteht sich. Joho ist stolz auf seinen weißen Beifahrer, den »Nasarra«: Fremden stellt er ihn als einen Mitarbeiter der Vereinten Nationen oder als einflussreichen Experten vor, der über das Ohr des Präsidenten verfüge. Leicht gequält lässt Rinaudo die Flunkerei großzügig durchgehen.
Zurück in Maradi wartet bereits eine Schar alter Bekannter am Tor zur Missionsstation: Sie wollen Rinaudo die Hand drücken, den Sohn vorstellen oder um Unterstützung für die Schulausbildung eines Enkels bitten. Früher war das Anwesen noch jedem zugänglich, heute wird er mit einer gut zwei Meter hohen Mauer geschützt. Dass sei sowohl der wachsenden Kriminalität wie dem sich verschlechternden Verhältnis zwischen radikalisierten Muslimen und der kleinen christlichen Minderheit zuzuschreiben, heißt es: Eine von Ereignissen anderswo in der Welt aufgebrachte Menschenmenge wollte die Missionsstation auch schon mal in Flammen setzen. Noch immer leben fünf Missionare aus Australien und den USA auf dem Anwesen: Sie sind allerdings in der Gesundheitsversorgung, nicht mit dem Pflegen von Bäumen beschäftigt.
Anderntags soll Rinaudo zu einem Livegespräch in die staatliche Radiostation kommen. Das Studio gleicht einer seit Jahren nicht mehr gereinigten Rumpelkammer: Latten hängen von der Decke, kaum eine Lampe funktioniert, wie ein braunes Laken hat sich eine schmierige Staubschicht über Möbel, Geräte und den Fußboden gelegt. Dafür läuft der australische Gast zur Hochform auf: Während des Gesprächs bricht die Studiobesatzung immer wieder in schallendes Gelächter aus. Die Erheiterung sei vor allem seinem Gebrauch alter Sprichwörter zuzuschreiben, wird Rinaudo später erklären: Er habe sein Hausa mit einem archaischen Textbuch gelernt.
Trotz des vorsintfluchtlichen Zustands der Studioelektronik scheint das Gespräch tatsächlich auch irgendwie nach außen zu dringen. Ein Farmer nach dem anderen ruft an, die alle Rinaudos FMNR-Methode preisen. Nach Erhebungen von World Vision praktizieren allein im Maradi-Distrikt gegenwärtig Zigtausende von Kleinbauern die natürliche Regenerierung: Im ganzen Land sollen inzwischen wieder 200 Millionen Bäume stehen – statt der fünf Millionen Anfang der 1980er-Jahre. Kein Wunder, dass Rinaudo nach seinem Studiogespräch bester Laune ist: »Ich glaube, mein Traum ist in Erfüllung gegangen.«
Der Platinstandard
Verglichen mit Maradis sandbraunen Landschaften sind die Hügel um die südäthiopische Provinzstadt Sodo ein grünes Paradies: »Es ist der Goldstandard unserer Projekte«, sagt Tony Rinaudo. Wenige Kilometer außerhalb des Städtchens hat eine von World Vision angeregte Kooperative Setzlinge in einem umzäunten Areal von der Größe eines Fußballfeldes angepflanzt – daneben stehen Bienenstöcke, aus denen es wie unter einer Hochspannungsleitung summt. Zunächst hätten sie hier nur Nutzbäume wie Akazien und Grevilia hochgezogen, erzählt der Koop-Vorsitzende Berata Bassa: »Bis wir auf die Idee mit den Apfelbäumen kamen.« Diese stehen heute in allen Größen über das Areal verteilt: Manche kaum einen Meter hoch, andere schon mit reifen Früchten. Die Obstbäume seien bestens zu vermarkten, fährt Bassa fort: Sowohl ihre Setzlinge wie ihre Früchte bringen für äthiopische Verhältnisse gutes Geld ein – ein Kilo Äpfel umgerechnet fast einen Euro. Noch besser läuft das Geschäft mit dem Honig: Für den Bienensirup kann man fast EUR 2 pro Kilo erwarten. Dafür lässt sich der Koop-Chef gelegentlich auch mal von einer Biene stechen: Soeben hat sich wieder eine unter Hingabe ihres Lebens für den andauernden Honig-Klau gerächt.
Von der anderen Seite des Tals schallt das Bellen von Pavianen herüber – die Affen sind wie Leoparden, Adler und Warzenschweine die neuen Sorgenkinder der Kooperative. Mit der Wiederbewaldung kämen eben auch die wilden Tiere zurück, sagt Rinaudo: Sie machen sich über die Pflanzungen der Kleinfarmer her und reißen gelegentlich mal eine Ziege oder ein Kalb. Einige Farmer schlugen bereits vor, die Eindringlinge über den Haufen zu schießen. Doch andere erfuhren vom touristischen Wert der Tiere und plädieren nun für einen kleinen Naturpark. »Das ist Entwicklung wie aus dem Lehrbuch«, sagt Rinaudo: »Eine Errungenschaft baut auf der anderen auf.«
Die wilden Tiere sind nur die jüngste Generation der Probleme, die Rinaudo & Co auf dem Weg zum Goldstandard zur Seite räumen mussten. Andere hingen mit den Köhlern zusammen, die einst Humbos Nilpferdrücken kahl geschlagen hatten. Dass sie ihr zerstörerisches Werk unter der Schirmherrschaft der »Farmer Managed Natural Regeneration« nicht fortsetzen konnten, versteht sich von selbst: Für sie musste eine berufliche Alternative gefunden werden. Rinaudo und Kebede Asafa, sein Weggefährte von der äthiopischen Forstbehörde in Addis Abeba, boten den Köhlern eine alternative Ausbildung an: Sie konnten sich zu Schneidern oder Frisörinnen umbilden lassen und wurden zusätzlich noch mit einem kleinen Salon oder einer Nähmaschine ausgerüstet. Keiner der ehemaligen Holzbrenner scheint mehrere Jahre später den Karrierewechsel zu bereuen. Mit seiner Schneiderei verdiene er heute wesentlich mehr als zuvor, sagt der 24-jährige Wadu Henok: »Und es macht auch deutlich mehr Spaß.«
Schließlich stießen Sodo und Humbo sogar noch vom Gold- in den Platinstandard auf, indem sie auch aus ihren Wiederaufforstungserfolgen noch Kapital schlagen konnten. Humbo ist mit dem in Kyoto vereinbarten »Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung« verbunden, während Sodo seine Karbon-Kredite auf dem freien Markt verkauft. In beiden Fällen handelt es sich um einen internationalen Finanzausgleich zwischen industriellen Umweltsündern und Ökoinitiativen in Entwicklungsländern. Unternehmen aus den Industrienationen, die die Atmosphäre mit hohen Mengen an Kohlenwasserstoffen belasten, können ihre ökologischen Sünden mit Zahlungen an Projekten in Staaten des globalen Südens sühnen, die etwa zur Wiederaufforstung und damit zur Säuberung der Luft beitragen. Um sich an dem CO2-Handel beteiligen zu können, muss sich ein Projekt allerdings erst einmal lizensieren lassen: ein bürokratischer Großaufwand, an dem mancher potenzielle Nutznießer bereits scheitert. Außerdem ist die Höhe der CO2-Kredite großen Schwankungen unterworfen und derzeit eher niedrig. Kein Wunder, dass die Zahl der am CO2-Handel beteiligten Wiederaufforstungsprojekte gegenwärtig ziemlich gering ist.
Immerhin haben allein die sieben Kooperativen in Humbo bis August 2017 insgesamt USD 554 681 eingenommen – für äthiopische Verhältnisse gigantische Summen. Das Geld wurde in einen Getreidespeicher, eine Maismühle und Bewässerungsanlagen investiert: lauter Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung, die aus armseligen Hütten schließlich blühende Dörfer machen werden. »Ein tolles Ergebnis«, sagt Tony Rinaudo, warnt allerdings davor, in die Bargeldmaschine zu große Hoffnungen zu setzen: »Das lenkt nur vom eigentlichen Ziel der Wiederaufforstung ab und führt leicht zu enttäuschten Erwartungen.« Dagegen sorgen wiederhergestellte Ökosysteme kostenlos für nachhaltige Entwicklung – unabhängig von den Launen des CO2-Handels.
Unterdessen breitet sich Rinaudos Methode allmählich über den gesamten Kontinent aus. Gemeinsam mit dem World Agroforestry Centre veranstaltete World Vision bereits FMNR-Konferenzen in Malawi und Kenia, zu denen Interessierte aus zahlreichen afrikanischen Staaten kamen: Sie waren von Rinaudos Vortrag dermaßen angetan, dass sie die natürliche Wiederaufforstung sogleich zu Hause ausprobierten. Mittlerweile wird FMNR in mehr als zwanzig Staaten des Kontinents praktiziert: Darunter auch im brottrockenen Somaliland, dem absoluten Härtefall. Wenn in Äthiopien der Platinstandard praktiziert wird, dann muss in Somaliland wohl vom Sandstandard gesprochen werden: Hier jagt eine Dürre die andere, mit höchstens 200 Millimeter Niederschlag fällt in der ostafrikanischen Halbwüstenregion selbst in normalen Jahren lediglich halb so viel Regen wie im Niger. »Sollte FMNR auch hier funktionieren«, sagt Rinaudo, »dann klappt es nahezu überall.«
Der Sandstandard
Ein kleiner Konvoi von Geländewagen brettert in sengender Hitze durch ein Terrain, das einer Mondlandschaft gleicht. Während der achtstündigen Holperfahrt von Somalilands Hauptstadt Hargeisa zum Roten Meer sind so gut wie keine Bäume und kaum ein grüner Farbton auszumachen: Dafür immer wieder Kinder, die am Pistenrand um Wasser betteln, oder Ziegen- und Kamelkadaver, für die jegliche Hilfe zu spät kommt. Ältere Bewohner der einstigen britischen Kolonie erinnern sich, dass auf den Hügeln ihres international nicht anerkannten Landes noch vor wenigen Jahrzehnten Bäume wuchsen und Tiere weideten. Doch längst haben die Köhler alles kahl geschlagen – außer ein paar Insekten ist hier kein wildes Tier mehr auszumachen. Holzkohle für den saudi-arabischen Markt herzustellen war eine der wenigen Tätigkeiten, mit denen Somaliländer Geld verdienen konnten: Jahr für Jahr sank der Baumbestand in dem Halbwüstenstaat um 1% – fast doppelt so schnell wie im afrikanischen Durchschnitt.
Vor uns taucht ein abgezäuntes Areal auf, dessen mannshohe Bäumchen schon von Weitem zu erkennen sind. Das Versuchsfeld sieht nicht gerade wie eine blühende Landschaft aus: Doch immerhin sind die vorsichtig beschnittenen Baumtriebe selbst in den zurückliegenden Dürrejahren weiter gewachsen – zwischen den Büschen wächst Gras, das die Dorfbewohner als Tierfutter und für die Dächer ihrer Hütten nutzen. Auch Bienenstöcke sind zu sehen, mit denen die Mitglieder der Kooperative noch im Vorjahr rund EUR 700 einnahmen: Inzwischen haben die Schwärme wegen der anhaltenden Trockenheit allerdings das Weite gesucht. »In westlichen Augen mag das schrecklich aussehen«, sagt Rinaudo: »Aber diese Büsche leben und werden beim ersten Regen ausschlagen.«
Nur wenige Kilometer entfernt hebt sich aus der trostlosen Landschaft plötzlich eine sattgrüne Oase ab: Hier experimentiert Ibrahim Muse Elim mit der FMNR-Methode. Der 56-jährige Farmer verfügt über Grundwasser, das er mit einer Pumpe aus zehn Meter Tiefe holt: Wegen der Dürre muss er Monat für Monat allerdings tiefer bohren. Am Rand seines Grundstücks hat Ibrahim ein kleines Gewächshaus für Setzlinge errichtet. Er hält die Ziegen mit improvisierten Zäunen aus dornigen Zweigen fern und lässt zwischen seinen Beeten Bäumchen wachsen. Im Glauben, dass die Bäume seinem Gemüse die Nahrung wegnähmen, habe er früher um sie herum nichts angepflanzt, erzählt der Farmer: Bis ihm Rinaudo zeigte, dass sich sein ungeschützter Boden zur Mittagszeit auf über 70 Grad erhitzt, während er im Schatten eines Baumes höchstens halb so heiß wird. Heute erntet Ibrahim fast doppelt so viel wie früher: Seine Familie isst dreimal am Tag, alle zehn Kinder gehen zur Schule, dem Ältesten konnte er kürzlich sogar seine Hochzeit finanzieren. Tony Rinaudo bückt sich zu einem Büschchen hinab, um ihm vorsichtig mit seinem abgenutzten Klappmesser die Seitentriebe zu beschneiden. »Wenn ich so etwas höre«, sagt der Waldmacher, »dann bin ich glücklich.«