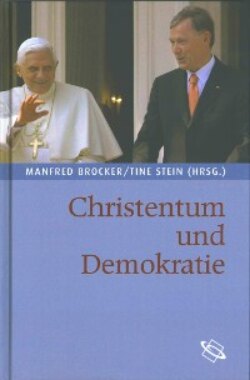Читать книгу Christentum und Demokratie - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHENNING OTTMAN
Athen und Jerusalem – eine Umwertung antiker Werte durch das christlich-jüdische Denken?
Das Wort „Polis“ begegnet im Neuen Testament 161 mal. Es hat dort aber nicht mehr die Bedeutung, die es für die Griechen einmal besaß. Bei den Griechen war die Stadt das Zentrum des Lebens. Nach dem Zeugnis des Aristoteles findet der Mensch im politischen Leben seine Ehre und Anerkennung. Zwar gab es auch ein die Politik transzendierendes Leben, wie es der bios theoretikos der Philosophen darstellt. Aber für den Normalbürger war die Politik das, was sein Leben bestimmte. Nur die kleine Zahl der Philosophen führte ein Leben apolitischer oder überpolitischer Art.
Mit dem Christentum wird dies anders. Für das Christentum gibt es zwei Städte: die irdische und die himmlische. Alle Politik wird dadurch auf eine nie dagewesene Weise relativiert. Das Zentrum des Lebens kann Politik nicht mehr sein. Entscheidend wird die Ausrichtung auf das künftige Leben und das jenseitige Heil. Der Spielraum der Politik erweitert sich. Viele Arten von Politik werden möglich, weil es eine alleinseligmachende Politik nicht mehr geben kann.
Ein Blick auf das Neue Testament zeigt, der Spielraum der Politik ist derart weit geworden, dass die Grenze des Widersprüchlichen gestreift wird. In Römer 13, 1-2 heißt es: „Jedermann sei unterworfen der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.“
Gibt Paulus damit eine Loyalitätserklärung für Rom ab, so ist Rom in der Apokalypse des Johannes das „Tier aus der Tiefe“, eine satanische, Anbetung fordernde Macht. Der Basler Theologe Cullmann (1961) hat einmal versucht, die Johannes-Apokalypse als Kritik eines totalitären Systems avant la lettre zu lesen, und er hat dabei erstaunliche Resultate erzielt.
Das Neue Testament plädiert für und gegen Rom. Es fordert Gehorsam und Widerstand. Die enorme Spannweite möglicher Politikformen bedeutet allerdings nicht, dass alle politischen Ziele und Inhalte gleichgültig geworden wären. Ein reiner Dezisionismus wird nicht verkündet, und eine complexio oppositorum, wie sie Carl Schmitt (1925) der Katholischen Kirche zuschrieb, ist nicht gleichbedeutend mit einer Politik der Beliebigkeit. Im erweiterten Spielraum der Politik gibt es Grenzen, und es gibt dort auch Hierarchisierungen, die zu beachten sind.
Das Beispiel der Zinsperikope mag pars pro toto erläutern, wie Grenzen und Hierarchisierungen zu denken sind. Als man Christus im Tempel den Silberdenar mit dem Bilde des Tiberius zeigt und ihm die Frage stellt, ob dem Kaiser Steuern zu zahlen seien, antwortet er bekanntlich: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist“ (Mt 22, 21-22). Der Merksatz drückt aus, zwischen Politik und Religion ist zu trennen. Gott und Caesar besitzen je ihr eigenes Reich. Selbst ein heidnischer Kaiser wie Tiberius verdient, dass man ihm Steuern zahlt, selbst ein Kaiser, auf dessen Münze steht: PONTIFEX MAXIMUS und DIVI AUGUSTI FILIUS (vgl. Schottroff 1984; Bünker 1989). Jesus war kein Zelot. Er war kein nationaler Befreiungskämpfer. Zum Widerstand gegen Rom hat er nicht aufgerufen. Neben der Trennung der Reiche enthält der Merksatz eine weitere Botschaft. Er fordert die Überordnung des Gottesreiches über das Reich des Caesar. Die Betonung des Merksatzes liegt auf dem zweiten Teilsatz, dass ‚Gott zu geben ist, was Gottes ist‘. In freier Übersetzung kann man die Zinsperikope etwa so umformulieren: Gebt dem Kaiser doch seine Steuermünze zurück (reddite)! Wie es sein Bild auf der Münze zeigt, gehört ihm die Münze sowieso. Wenn er sie zurückerhält, bekommt er, was ihm zusteht. Entscheidender freilich als der Gehorsam gegenüber der weltlichen Macht ist der Dienst im Reiche Gottes, ‚Gott zu geben, was Gottes ist‘.
Zur christlichen Politik gehört eine Kunst der Grenzziehung und Trennung. Zu trennen sind Weltliches und Geistliches, irdisches Glück und ewiges Heil, irdischer und ewiger Frieden, Revolution und Erlösung. Um die exakte Linie der Grenzziehung ist immer wieder gerungen worden. Jedoch sind alle Wege verfehlt, auf denen versucht worden ist, die Grenzziehung völlig aufzuheben und im Sinne des Dictatus Papae (1075) eine Hierokratie oder im Sinne Konstantins einen Cäsaropapismus zu errichten. Die Gewalten können kooperieren. Man kann sie auch parallel agieren sehen. In jedem Fall sind sie aber erst einmal voneinander zu scheiden, wenn das Spezifikum christlicher Politik in den Blick kommen soll.
Für den Christen kann Politik kein Letztes mehr sein. Christlich wird Politik zur Kunst der Regelung vorletzter Dinge, weil die Religion zuständig für das Letzte ist. Die Verteilung der Kompetenzen führt nicht nur zur Politikrelativierung, sie führt auch zu einer Politikentlastung. Politik wird entlastet von der Zumutung, zuständig für das Letzte zu sein. Wenn die Trennung von Letztem und Vorletztem gelingt, hält Religion der Politik den Rücken frei. Sie wird nach dem Wort Hermann Lübbes zur „Liberalitätsgarantie“ (1986, 325). Religion kann verhindern, dass der Staat sich ideologisch in sich schließt, sich für allzuständig erklärt.
Ein Paradebeispiel für die Unterscheidung von christlicher und antiker Politikauffassung bietet Augustinus. Sein Interesse galt mehr der Trennung der Reiche und dem Bruch mit dem imperium Romanum als dem Bestreben, Politik durch Religion zu stützen. Es ist bezeichnend, dass man bei Augustinus darüber diskutieren kann, ob er mit seiner berühmten Frage „was sind die Reiche anders als Räuberbanden?“ jedes irdische Reich verurteilt oder nur solche, denen die Gerechtigkeit fehlt (Ottmann 2004, 28 ff.). Wie dem auch sei, für den Kirchenvater hat sich Politik auf eine der Antike nicht gekannte Weise relativiert. Sie erklärt sich für ihn aus der Sündhaftigkeit des Menschen, und schon dies zwingt dazu, Politik nicht als eine Verheißung irdischer Vollkommenheiten, sondern als eine Minimierung erwartbarer Übel zu verstehen. Im Buch Genesis ist der erste Städtegründer ein Bruder-Mörder. Die Geschichte des Menschen ist ein einziger Brudermord, und nur die Verheißung eines Friedens auf Erden bringt Augustinus dazu, doch noch eine (aber auch nur eine) Parallelaktion von civitas terrena und civitas divina anzusetzen. Es ist eine Parallelaktion, welche die Differenz der Reiche nicht aufhebt, da diese bis ans Ende der Tage bestehen bleibt.
Politik als Kunst der Grenzziehung, Religion als Politikentlastung und Politikrelativierung, diese Thesen können Fragen und Einwände hervorrufen. Wo bleibt hier der Auftrag des Christen, die Welt zu gestalten? Wo bleibt das Potential christlicher Weltveränderung? Haben jene politischen Denker recht, die wie Machiavelli oder Rousseau dem Christentum vorwerfen, dass mit ihm keine anspruchsvolle Politik zu machen sei? Hat das Christentum die antike Bürgerpolitik ruiniert? Hat es das Leben derart entpolitisiert, dass jede anspruchsvolle Politik Schaden nehmen muss?
Machiavelli und Rousseau haben diese Fragen bekanntlich mit Ja beantwortet. Sie und andere Denker der Neuzeit haben, um den antiken Anspruch der Politik zu retten, auf ein Heilmittel zurückgegriffen, das im Alten Rom eine große Rolle gespielt hatte: die Zivilreligion. Hobbes empfahl sie als ein Mittel zur Schlichtung des konfessionellen Bürgerkrieges (Hobbes 1984, Kap. 42), Rousseau als ein Mittel, die Trennung von Mensch und Bürger wieder aufzuheben (Rousseau 1977, IV, 8). Aber Zivilreligion kann unter den Bedingungen der Neuzeit ein Heilmittel werden, das von einem Gift nur noch schwer zu unterscheiden ist. Auf der einen Seite kann sie ein Abglanz echter Religion sein, und nur wenn sie dies ist, hat sie einen religiös erträglichen Sinn. Auf der anderen Seite ist sie stets verdächtig, Religion für die Zwecke der Politik zu instrumentalisieren, sie zu erniedrigen zum Lieferanten des Sozialkitts oder zum Surrogat für die verlorene politische Homogenität. Wenn sie etwas von echter Religion haben soll, ist Zivilreligion nicht instrumentalisierbar. Wird sie instrumentalisiert, fehlt ihr die Würde echter Religiosität.
Der Verdacht, dass das Christentum anspruchsvolle Politik verhindert, hat einen Anhaltspunkt bereits an den ersten Jahrhunderten christlicher Geschichte. Die ersten Christen waren Fremde in dieser Welt. Sie haben sich vom üblichen Leben abgesondert. Die von den Massen geschätzten Spektakel waren ihnen verächtlich. Den Kriegsdienst wollten sie nicht leisten oder zumindest haben sie überlegt, ob sie ihn denn leisten sollten. In Tertullians Apologeticum (197 n. Chr.) heißt es: „Nichts ist uns [den Christen; H. O.] fremder als die öffentliche Angelegenheit“ („nobis ... nec nulla magis res aliena quam publica“; Apol. 38).
Derselbe Tertullian war es auch, der das Christentum nicht nur scharf abgrenzte vom Judentum, sondern auch von der griechischen Philosophie. Den griechischen Philosophen, schrieb er, werde jede Verrücktheit nachgesehen, während die Wahrheiten des christlichen Glaubens auf Unverständnis stießen. Pythagoreer etwa würden glauben, dass aus einem Maulesel wieder ein Mensch entstünde. Sokrates stelle Dämonisches (wie sein „Daimonion“) neben die Götter. Die Götter der Griechen seien sowieso nur vergöttlichte Menschen, wie es Euhemeros gezeigt habe: „Was also“, fragt Tertullian, „haben gemeinsam der Philosoph und der Christ, der Schüler Griechenlands und der des Himmels ...?“ (Apol. 46, 18). Oder an anderer Stelle: „Was hat Athen mit Jerusalem, was die Akademie mit der Kirche zu tun?“ (de praes. haer. 7).
Athen und Jerusalem, Akademie und Kirche waren zunächst voneinander getrennt. Aber die Zeit Tertullians, die Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert, ist bereits auch die Zeit des Umschlages. Bei Clemens von Alexandria etwa wird zur gleichen Zeit schon die Brücke zur griechischen Philosophie geschlagen. Zwar seien, schreibt Clemens, in der Philosophie „nicht alle Nüsse“ essbar. Aber die Philosophie einfach nur abzuwehren, ähnle der Angst der Kinder „vor Gespenstern“ (strom. VI, 80, 5). Griechische Philosophie und Christentum wurden von nun an miteinander verbunden. Das Christentum wurde nun auch für die Gebildeten attraktiv. Mit Augustinus gewinnt es einen Denker, der den Philosophen der Antike auf Augenhöhe gegenübertreten kann. In den verschiedenen Renaissancen des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit erneuert sich in der christlichen Welt immer wieder das Erbe der Antike. Athen und Jerusalem wachsen zusammen, so dass sie mit fortschreitender Geschichte nur noch schwer voneinander zu trennen sind. Als Luther in seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation (1520) seine Attacke gegen Aristoteles ritt, hatte er damit keinen Erfolg. Durchgesetzt hat sich Melanchthon, der das Erbe der Antike für den Protestantismus gerettet hat.
Christen waren und sind Fremde in dieser Welt. Gleichwohl geht das Verhältnis des Christentums zur Welt in Weltfremdheit nicht auf. Zwar ist es den Christen immer geboten, sich der Welt nicht gleichförmig zu machen. Aber das christliche Weltverständnis ist eigentlich geprägt durch eine Balance von Weltabwendung und Weltzuwendung: Abwendung von dieser zeitlichen Welt der Sünde und des Unheils, Zuwendung zur Welt, die eine an sich gute und erlöste Schöpfung ist. Diese Balance kann unterschiedlich ausfallen, in gewissen Zeiten mehr zur Weltabwendung, in anderen mehr zur Weltzuwendung neigen. Entscheidend ist jedoch, dass es immer zwei Pole sind, zwischen denen das christliche Weltverständnis oszilliert. Nietzsches Kritik an der Flucht der Christen aus dieser Welt in die „Hinterwelt“ hat diese Doppelung im Weltverständnis nicht erkannt.
Das Christentum hat die Welt verändert. Es hat die tragische Weltauffassung der Griechen durch eine neue Lehre von der Gerechtigkeit ersetzt. Eine Tragödie kann es christlich nicht mehr geben, da ein Missverhältnis zwischen der Tat und ihren Folgen nicht mehr auftauchen kann. An die Stelle der Tragödie tritt die „Göttliche Komödie“. Durch sein Liebesgebot hat das Christentum eine neue Auffassung von Mitmenschlichkeit und Brüderlichkeit gebracht, eine Zuwendung auch zum Schwachen und Hilflosen. Das Christentum hat die zyklische Zeitauffassung der Antike ersetzt durch die Vorstellung einer zielgerichteten, befristeten Zeit. Alle Geschichtsphilosophie der Neuzeit beruft sich darauf, noch in ihrer das Christentum säkularisierenden Form.
Das Christentum hat die Welt verändert. Der Prozess dieser Veränderung ist allerdings nicht leicht zu fassen. Das Wort „Verweltlichung“ ist doppeldeutig. Es kann bedeuten, dass die Religion sich so in der Welt verwirklicht, dass sie diese nach ihrem Bilde formt. Es kann aber auch bedeuten, dass sie sich in der Welt verliert, sich durch Selbst-Säkularisierung auflöst. Dies ist dem Christentum um so mehr möglich, als ihm eine Tendenz zur Säkularisierung von Anfang an innewohnt. Man sieht dies sowohl an den Folgen des Monotheismus als auch an der Geschichte der Subjektivität, am Weg christlicher Freiheit und Gleichheit in die Welt.
Der Monotheismus, ob jüdisch oder christlich, bringt die erste große Säkularisierung. Er ist eine Form der Entzauberung der Welt. Hatten die Alten die Natur mit Göttern, Dämonen und anderen numinosen Wesen bevölkert, so vollzieht der Monotheismus die große Entgötterung der Welt. Aus dem „Hain“ wird – wie Hegel einmal in anderem Zusammenhang, im Blick auf die Subjektivität und seine eigene Zeit formuliert – das „Holz“ (Hegel 1968, 317). Vom Hain zum Holz, oder sagen wir, von der Transzendenz und dem Herausziehen des Göttlichen aus der Welt zur Versachlichung und Verdinglichung der Außenwelt. Der Monotheismus ist eine der großen Kulturschwellen. Durch ihn entsteht das, was Gehlen die „FaktenAußenwelt“ nennt (Gehlen 1975, 97 ff.).
Nun teilt das Christentum den Monotheismus mit dem Judentum und dem Islam. Aber die christliche Form des Monotheismus bringt andere politische Konsequenzen mit sich, als sie im Kalifat des Islam oder in der Geschichte des auserwählten Volkes zu bemerken sind. An die Stelle der Einheit von Politik und Religion, wie sie der Kalifat fordert, tritt die Trennung der Reiche. An die Stelle der auf ein auserwähltes Volk beschränkten Religion tritt der Universalismus. Dieser folgt nicht der Formel „ein Gott – ein Volk“. Diese wird vielmehr ersetzt durch die Formel „Ein Gott – eine Menschheit“. Der Monotheismus ist, wie es schon bei den Stoikern zu bemerken ist, eine Voraussetzung des universalen Denkens. Ohne ihn hätte sich weder die Idee der einen Menschheit durchgesetzt noch das, was daraus folgt: das Menschenrecht. Zu diesem hat trotz Stoa und linker Sophistik das Altertum nicht gefunden. Es hebt den Satz Nietzsches nicht auf: „Menschenrechte gibt es nicht“, gemeint ist, gibt es nicht in der Antike (Nietzsche 1967, 578).
Der Monotheismus kann zur Theokratie neigen. Flavius Josephus, der den Begriff geprägt hat (contra Apionem II, 165-166), hatte damit etwas umschrieben, was die Griechen und die Römer nicht kannten, wörtlich eine Gottesherrschaft, de facto eine Herrschaft der Priester. Auch in der Geschichte des Christentums ist die Idee einer Priesterherrschaft des öfteren erwogen worden, und noch bei den Puritanern ist sie wiederaufgelebt. Der monotheistische Universalismus ist darüber hinaus anfällig für Reichstheologien: „Ein Gott – ein Reich“, „ein Gott – ein Kaiser“ – seit Konstantin liegen solche politisch-theologischen Analogien nahe. Sie verfehlen freilich die Spannung, die die christliche Zwei-Reiche-Lehre und der doppelsinnige Weltbegriff enthalten. Sie ziehen die Transzendenz, die die Politik entlastet, wieder in diese Welt hinein.
Die politisch-theologischen Versuchungen, denen der Monotheismus unterliegen kann, sind allerdings zu unterscheiden von der Behauptung, der Monotheismus sei eine Theologie der Gewalt, der Feindschaft, der Intoleranz, so wie dies kürzlich Jan Assmann (1998; 2000) behauptet hat. Der Monotheismus kann so, wie er die Natur entdämonisiert, auch die Politik entzaubern. So wie er das Göttliche aus der Natur zieht, kann er es auch aus der Politik ziehen. Schon im Alten Testament finden sich Spuren eines solchen Denkens. Neben den königsfreundlichen Traditionen finden sich dort auch königskritische wie beispielsweise in der Geschichte des Saul (vgl. Crüsemann 1978). Die Inthronisierung des Königtums wird dort so verstanden, dass sich Israel damit seines eigentlichen Königs und seiner Eigentümlichkeit gegenüber anderen Völkern beraubt. Wenn Gott der wahre Herrscher ist, wie kann dann ein Mensch überhaupt König sein?
Vor Gott sind nach christlicher Lehre alle Seelen gleich, und das Christentum verheißt seit seinen Anfängen eine Aufhebung der Unterschiede der Nationen, der Stände und der Geschlechter. Im Galater-Brief des Paulus heißt es: „Jetzt gilt nicht mehr Jude noch Grieche, Sklave noch Freier, Mann und Weib“ (3, 28). Man muss dies wohl so verstehen: Jetzt gilt nicht mehr vor Gott, was bisher nach Religionen, Ständen und Geschlechtern geschieden war. Vor Gott sind alle Seelen gleich. In der Welt dagegen mag es Ungleichheit geben. Im Blick auf das Seelenheil ist sie irrelevant. Fast zwei Jahrtausende später hat der Philosoph Hegel an dieses Wort des Paulus angeknüpft. Im Blick auf seine eigene Zeit schreibt er: „Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener u. s. f. ist“ (Hegel 1955, § 209 A).
Die christliche Verheißung von Freiheit und Gleichheit ist für Hegel Wirklichkeit geworden. Französische Revolution und bürgerliche Gesellschaft haben die verheißene Freiheit und Gleichheit in die Welt gebracht. Sie verwirklichen, was die Religion verkündet hat, dass der Mensch als Mensch gilt, der Mensch als Mensch frei und gleich geworden ist.
Hegels Brückenschlag über fast zwei Jahrtausende hinweg erzählt die Geschichte der Freiheit und Gleichheit aus dem Geist des Protestantismus. Die Geschichte der Subjektivität wird zu einer protestantischen Erfolgsgeschichte. Ein gerader Weg führt von der Reformation zur Revolution. Die zunächst im Inneren gewonnene Freiheit wird äußerlich. Sie geht in die Welt, und dort verändert sie das Arbeitsethos und die Wirtschaftsweise, die Gesellschaft und den Staat.
Hegel hatte den Ehrgeiz, die Versöhnung noch in den modernen Formen der „Entzweiung“ zu erkennen. Was wie der moderne „Atheismus der sittlichen Welt“ (Hegel 1955, Vorrede) dem Christentum schnurstracks entgegengesetzt zu sein scheint, bewies nur die Kraft des Geistes, sich in immer größeren Gegensätzen zu behaupten. Im Blick auf den modernen Staat und die bürgerliche Gesellschaft musste dies heißen, dass sie nicht als Gegensatz zum Christentum verstanden werden müssen. Der moderne Staat ist nicht nur ein Kind der konfessionellen Bürgerkriege und insofern das Produkt einer Notlage, die nur noch durch die Neutralisierung der Konfessionen zu bewältigen war. Der in der Moderne entstandene Freiraum fügt sich durchaus ein in die Freiheitsgeschichte des Christentums. Wo immer der Staat relativiert ist, das heißt, sich nicht als irdischer Garant des Heils aufspielt, ordnet er sich dem christlichen Verständnis von Politik und Welt ein. Den großen Spielraum der dem Christentum möglichen Politik sprengt er nicht.
Anders zu beurteilen, ist freilich eine andere Folge der Säkularisierung. Diese führt ganz und gar nicht zu einer Politikrelativierung. Vielmehr kann sich die Verweltlichung auch auf die Weise vollziehen, dass Ansprüche, die in die Religion gehören, verlagert werden in die Politik. Von dieser verhängnisvollen Form der Säkularisierung erzählen die Erfolgsgeschichten der Verweltlichung nichts. Aber wenn absolute Ansprüche der Religion in die Politik verlagert werden, dann wird die christliche Politikrelativierung aufgehoben. Dann wird Politik mit Ansprüchen belastet, die von ihr prinzipiell nicht zu erfüllen sind. Beispiele dafür liefern die neuzeitlichen Geschichtsphilosophien von Lessing über Kant und Hegel bis zu Marx. Sie übersteigern Geschichte zu einer säkularistischen Heilsgeschichte. Ein anderes Beispiel bietet die Geschichte der neuzeitlichen Souveränität. Es entsteht eine omnipotente unfehlbare Macht auf Erden, eine Nachäffung des omnipotenten unfehlbaren Gottes, und es spielt dabei keine Rolle, ob dieser Souverän eine einzelne Person oder ein Volk ist (Ottmann 1990). Neben einer gelingenden Verweltlichung des Christentums steht in der Neuzeit eine Säkularisierung, die aus dem Ruder gelaufen ist. Nur wo die christliche Kunst der Trennungen bewahrt wird, kann Verweltlichung gelingen. Nur dort kann Politik gemäßigt, pragmatisch, eine Kunst der Regelung vorletzter Dinge sein.
Literatur
Assmann, Jan: Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. München/Wien 1998.
- : Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa. München 2000.
Bünker, Michael: ‚Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!‘ – Aber: Was ist des Kaisers? Überlegungen zur Perikope von der Kaisersteuer. In: Kairos 31, 1989, 85–98.
Crüsemann, Frank: Der Widerstand gegen das Königtum: Die antiköniglichen Texte des Alten Testaments und der Kampf um den frühen israelitischen Staat. Neukirchen-Vluyn 1978.
Cullmann, Oscar: Der Staat im Neuen Testament. Tübingen 21961.
Gehlen, Arnold: Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Frankfurt a. M. 31975.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hg. v. Johannes Hofmeister. Hamburg 1955.
– : Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität, in der Vollständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobische, und Fichtesche Philosophie. In: Hartmut Buchner/Otto Pöggeler (Hg.), Jenaer Kritische Schriften. Hamburg 1968, 313–414.
Hobbes, Thomas: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Hrsg. und eingeleitet von Iring Fetscher. Übers. v. Walter Euchner. Frankfurt a. M. 1984.
Lübbe, Hermann: Religion nach der Aufklärung. Graz 1986.
Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente Herbst 1877. In: Giorgio Colli/Mazzino Montinari (Hg.), Kritische Gesamtausgabe. Vierte Abteilung, zweiter Band. Berlin 1967, 577–581.
Ottmann, Henning: Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man die politischen Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch erklären kann. In: Volker Gerhardt (Hg.), Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns. Stuttgart 1990, 169–188.
– : Geschichte des politischen Denkens. Bd. 2/2: Das Mittelalter. Stuttgart/ Weimar 2004.
Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes. In: ders., Politische Schriften. Paderborn 1977, Bd. 1, 59–208.
Schmitt, Carl: Römischer Katholizismus und politische Form. Stuttgart 1984 (nach der Ausgabe 1925).
Schottroff, Luise: ‚Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört‘ und Gott, was Gott gehört“. Die theologische Antwort der urchristlichen Gemeinden auf die gesellschaftliche und politische Situation. In: Jürgen Moltmann (Hg.), Annahme und Widerstand. München 1984, 15–58.