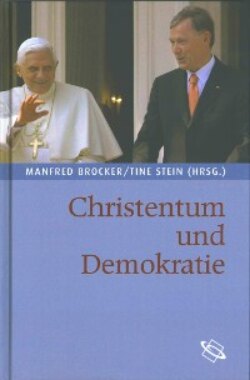Читать книгу Christentum und Demokratie - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTHEO KOBUSCH
Nachdenken über die Menschenwürde
„Ich appelliere hierbei an das alte Vorurteil, daß im Wissen Wahrheit sei, daß man aber vom Wahren nur insofern wisse, als man nachdenke, nicht so, wie man gehe und stehe“ (Hegel).
1. Der Begriff der Menschenwürde – in reduzierter Form
Das Denken des Menschen ist wesentlich „Nachdenken“. Wir denken immer sowohl hinter der Wirklichkeit als auch ihren Deutungen her. Wir kommen zu spät, um sie, die Welt des wirklichen Seins wie die Welt der Begriffe, erst hervorbringen zu können. Die Griechen haben das empfunden und gedacht, indem sie das menschliche Denken „Epinoia“ nannten, und Hegel hat eben dies nachempfunden, indem er vom „Nachdenken“ (z. B. göttlicher Gedanken in der Logik) sprach. Nachdenker ist der Mensch auch, insofern er beim Denken die Sprache benutzt und die in ihr geprägten Begriffe. Die Begriffe einer Sprache repräsentieren das immer schon Gedachte, das Vorgedachte. Wir können mit ihm nicht umgehen wie mit anderen Instrumenten. Vielmehr haben wir zur vorgegebenen Sprache ein sittliches Verhältnis. Das bedeutet, dass die Sprache uns im Modus des sittlichen Seins vorgegeben ist. Wir sind ihr verpflichtet, auch ihren Inhalten.
In jüngster Zeit häufen sich die Versuche philosophischerseits, das unliebsame Erbe besonders metaphysischer Begriffe loszuwerden, bzw. sie mit neuem Inhalt zu füllen. Die Begriffe der Person und der Menschenwürde sind dafür das beste Beispiel. Im Falle des Personbegriffs, dessen hoffnungslose Verstricktheit in metaphysische Geschichten von den Kritikern wohl durchschaut ist, wird schlicht deswegen seine Abschaffung gefordert- als sei es Sache der Philosophie, die Purifizierung der Sprache durch Auslöschen der Begriffe durchzuführen. Der Begriff der Menschenwürde erlebt zur Zeit ein ähnliches Schicksal. Er wird, wie die Begriffe der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit, als „Leerformel“ oder „Worthülse“ angesehen, die deswegen angeblich beliebig mit „höchstpersönlichen Wert vorstellungen“ angefüllt werden könnten (Birnbacher 2004, 249). Doch das Gegenteil ist der Fall. Der Begriff der Menschenwürde ist so reich an Bedeutung und mit so vielen auch metaphysischen Implikationen ausgestattet, dass er Gefahr läuft, nicht mehr verstanden zu werden. Deswegen muss man ihn erneut nachdenken, d. h. seine historischen Implikationen aufzudecken versuchen. Andererseits wird dem Begriff der Menschenwürde gerade aufgrund seiner – meist falsch verstandenen – metaphysischen Herkunft eine allgemeingültige Begründbarkeit abgesprochen (Wetz 2004, 230 f.). Die Gottebenbildlichkeit oder andere metaphysische bzw. religiöse, also weltanschaulich gefärbte Begründungen der Menschenwürde – wie man sich heute leichtfertig ausdrückt, als sei die Metaphysik eine Weltanschauung – seien heute einem pluralistischen Gemeinwesen oder gar einer multikulturellen Weltöffentlichkeit nicht mehr vermittelbar. Deswegen kann allein eine „anthropologisch fundierte Würdeauffassung“ damit rechnen, grenzübergreifend anerkannt zu werden. Eine solche Auffassung begreift die Menschenwürde als eine negative Norm, als das Verbot der Demütigung und kränkenden Missachtung des Menschen, als „Gestaltungsauftrag“, der sich nicht so sehr am Gesunden, Erfolgreichen, Schönen und Starken als vielmehr am Kranken, Gescheiterten, Hässlichen und Schwachen orientiert (Wetz 2004, 233). Diese Anthropologisierung des Würdebegriffs ist die Grundlage zahlreicher, neuerlich erhobener Stellungnahmen (Werner 2004, 194).
Indes, bedarf es wirklich eines Beweises, dass der Ausgangspunkt für diese Stellungnahmen, die angeblich neue Sensibilität für das Kranke und Schwache, in jenem christlich-metaphysischen Denken verankert ist, das sie als weltanschauliche Einseitigkeit zu umgehen trachten? Und wenn diese Antimetaphysiker, die vor der Metaphysik wie vor einem Pestbehafteten fliehen, vielleicht nicht die große Tradition der Ecclesiastes-Kommentierung wahrgenommen haben, wo die Nichtigkeit der Welt besonders eindrucksvoll beschrieben wird, und vielleicht auch nicht jene mittelalterlichen Erkenntnislehren, in denen die Schwäche der menschlichen Vernunft wie nirgendwo sonst dokumentiert ist, oder auch nicht die verschiedenen Variationen der Erbsündenlehre und Christologie von Augustinus bis Kant, die das Kranke und Leidende der menschlichen Natur bewusst gemacht haben, ganz abgesehen von den Sozialphilosophien des frühen Christentums – haben sie denn nicht wenigstens ihren Nietzsche gelesen? Ganz in die Nähe dieser anthropologisch fundierten Würdeauffassung gehören auch jene Vorschläge, die im Namen einer so genannten interessenzentrierten Konzeption der Moral die Würde als die Anzeige grundlegender Bedürfnisse bzw. des einen Bedürfnisses nach Respekt verstehen (Baumann 2003).
Schließlich müssen in diesem Zusammenhang die Konzeptionen eigens erwähnt werden, die von vorneherein die Menschenwürde ihres ursprünglichen absoluten Charakters entkleiden. Das sind solche, die die Menschenwürde an das Kriterium der Selbstachtung binden oder sie von einer bestimmten Fähigkeit oder einem Interesse abhängig machen wollen (Luhmann 1965). Andere bestimmen sie als ein „höchstes Sollen“ (Höffe 2002, 114) oder als einen moralischen Anspruch, aber ist sie nicht vielmehr die Grundlage allen Sollens, also das Wollenkönnen? Wieder andere verstehen sie als ein Prinzip oder als ein bestimmtes Recht oder als ein Ensemble von Grundrechten, z. B. als das Grundrecht, nicht erniedrigt zu werden (Balzer/ Rippe/Schaber 1998, 28–30), und das, obwohl die traditionelle Würdediskussion immer unterschieden hat zwischen dem, was die Würde wirklich und ihrer ursprünglichen Bedeutung nach ist, nämlich ein ausgezeichneter Wert, und dem, was wir die Grundrechte nennen. Mit Recht hält Jean-Yves Goffi den einheitlichen Sinn des traditionellen Würdebegriffs fest: „Je définirai donc ainsi la dignité selon les modernes: c’est une valeur attacheé à tout être humain, du simple fait qu’il est un àtre rationel de liberté, c’està-dire qu’il est capable d’exercer sa raison pratique“ (Goffi 2000, 252).
Die genannten Ansätze werfen in Wirklichkeit mehr Fragen auf als sie beantworten können. Nicht nur, weil in der Liste der angeblichen würderelevanten Bedürfnisse notorisch das Bedürfnis auf Wahrheit fehlt, das – wider den schlimmen Satz aus dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx: „Das Bedürfnis nach Wahrheit ist kein wahres Bedürfnis“ – als das eigentliche Grundbedürfnis des Menschen anzusehen ist (Oeing-Hanhoff 1985). Vor allem aber kann so die Würde des Menschen kaum mehr in ihrer grundlegenden Funktion für jegliche Form des Selbstverhältnisses gedacht werden. Die Anthropologisierung des Würdebegriffs ist, wie auch im Folgenden gezeigt werden soll, die unzulässige Reduzierung einer ursprünglichen Bedeutung. Sie hat ihn seines ursprünglich absoluten Charakters beraubt und damit auch der unbedingten Forderung der Achtung der Menschenwürde theoretisch den Boden entzogen. Was in der Tradition zusammenging, das konstruiert die anthropologische Deutung der Menschenwürde zum Gegensatz. Denn in der Tradition gingen immer die metaphysische und die anthropologische Fundierung der Menschenwürde Hand in Hand. Giovanni Pico della Mirandola und Pascal – das war nie ein Widerspruch. Die Menschenwürde selbst aber ist – gemäß diesen neuen Vorstößen, die nicht auf das Fach der Philosophie beschränkt sind – zu einem Gut unter Gütern geworden, zu einem Bedingten, d. h. bedingt Gewollten, zu einem Relativen. Wollen wir das wirklich durch den Begriff der Menschenwürde ausdrücken? Oder wollen wir durch ihn nicht gerade etwas Unvergleichliches, etwas Unbedingtes, etwas Absolutes zur Geltung bringen? Die anthropologische Würdedeutung ist in Wirklichkeit der Totengräber des Würdebegriffs. Weiß sie aber eigentlich, wer da zu Grabe getragen wird? Wir müssen erneut über den Begriff der Menschenwürde nachdenken, auch über sein verpflichtendes historisches Erbe.
2. Das Verlierbare und das Unverlierbare der Menschenwürde
Wenn wir die Reduktionen des Menschenwürdebegriffs durch die Philosophie und andere Fächer zunächst beiseite legen und uns an die offiziellen oder gar promulgierten Texte wie Art. 1, Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes halten, werden wir unvermittelt mit einem Widerspruch konfrontiert, den zu lösen eine philosophische Aufgabe ist. Denn dieser Artikel sagt einerseits aus, dass die Würde des Menschen „unantastbar“ sei und andererseits, dass es die Aufgabe aller staatlichen Gewalt sei, diese Würde zu schützen und zu achten. Pollmann hat den Widerspruch klar und präzis auf den Punkt gebracht: „Wieso muss geschützt werden, was doch im Prinzip unverlierbar ist?“ Und selbst wenn dieser erste Artikel so zu verstehen wäre, wie die Verfassungsrechtler vorschlagen, dass die Würde unter gar keinen Umständen angetastet werden dürfe, bleibt der Widerspruch, dass von einem Absoluten und einem Relativen oder von einem ausnahmslos Gleichen und einem Graduellen im gleichen Atemzug die Rede ist (Pollmann 2005, 611).
Tatsächlich sind die beiden Elemente des Würdebegriffs im deutschen Grundgesetz zu unterscheiden. Sie werden von den meisten Forschern auch auseinander gehalten. Selbst so verschieden argumentierende Philosophen wie Höffe oder Wetz oder Birnbacher oder auch Habermas sind sich darin einig, dass der Begriff der Würde zwei Momente in sich birgt. Nach Höffe kann der „unstrittige Grundgehalt“ der Menschenwürde nur vor dem Hintergrund der zwei Bedeutungen des Würdebegriffs, nämlich des „komparativen“ und „absoluten“, als solcher bewusst werden (Höffe 2001, 66 f.). Für Wetz ist die Menschenwürde einerseits ein „abstraktes Wesensmerkmal“, durch das der Einzelne als Mensch schon einen unbedingten Wert besitzt, andererseits ein Wert, „den die Menschen einander zusprechen“ und durch die „Achtung“ konstituieren, ein „Gestaltungsauftrag“ (Wetz 2004, 228 f.). Birnbacher unterscheidet entsprechend zwischen einer Menschenwürde im starken Sinne, die prinzipiell „unabwägbar“ ist, und der Menschenwürde im schwachen Sinne, die bloß abwägbare Rechte und Pflichten zur Folge hat und von beiden noch einmal die so genannte Gattungswürde, die, obwohl aus finsterster Metaphysikzeit stammend, in der modernen Diskussion immer wichtiger wird (Birnbacher 2004). Habermas schließlich übernimmt diese Sicht der Dinge, indem er die „Würde des menschlichen Lebens“ als ein Abwägbares und so prinzipiell Verfügbares von der grundrechtlich geschützten „unantastbaren“ personalen Menschenwürde unterscheidet (Habermas 2001, 67 ff.).
Mit dieser Unterscheidung zwischen dem Unverlierbaren, Unabwägbaren, Unverfügbaren und Absoluten der Menschenwürde einerseits und ihrem komparativen, verfügbaren und verlierbaren Element andererseits geht eine Differenz in der Interpretation des Würdebegriffs einher, die von fundamentaler Wichtigkeit ist. Wird die Würde des Menschen nämlich als ein Absolutes angesehen, so kann sie auch nur in einem minimalistischen Sinne verstanden werden, insofern sie ein Minimum an materialen Grundgütern beinhaltet. Die Bedeutung des Begriffs der Menschenwürde ist aus dieser Sicht auf jenes Minimum beschränkt, wodurch der Mensch als Mensch konstituiert ist. Was ist dieses Minimum, das wir durch den Begriff der Würde ausdrücken wollen? Die Formel „Mensch als Mensch“, die erst in christlicher Zeit nachweisbar ist, gibt einen Hinweis. Sie ist ja nicht im Sinne der besonders von Maihofer in seiner Rechtsontologie thematisierten „Als-Seinsweisen“, d. h. nicht als eine bestimmte Rolle zu verstehen, die der Mensch spielte. Vielmehr deutet diese Formel der Aufklärungsphilosophie an, dass der Mensch, insofern er ein Wesen der Freiheit und kein Naturding ist, als Bedingung der Möglichkeit aller Rollen, die der Mensch spielen kann, zu denken ist.
Deutlich geht das aus jener Philosophie hervor, die den Begriff des Menschen als Menschen zum ersten Mal ins Zentrum des Denkens rückte. Christian Wolff hat eine neue Disziplin kreiert, in der die Prinzipien des Naturrechts behandelt werden: die „Philosophia Practica Universalis“, die ganz eng mit dem Naturrecht von 1740 und den Institutiones juris naturae et gentium von 1750 verbunden ist. Der eigentliche Gegenstand dieser Abhandlungen ist der „homo moralis“. Der „homo moralis“ ist der eigentliche Mensch, der Mensch als Mensch. Es ist eine der großen Errungenschaften des Naturrechts, diese Abstraktion, oder wie Wolff selbst sagt, diese nützliche Fiktion des moralischen Menschen, d. h. des Menschen als Menschen oder des Menschen als eines Freiheitswesens geleistet zu haben und die Bestimmungen zu benennen, die ihm als solchem zukommen (Wolff, Ius naturae § 70). Das dem Menschen als Menschen zukommende Recht muss ein angeborenes, universales Recht sein, denn es ist nicht abhängig von irgendeinem hinzu erworbenen Status oder vom Alter oder von Umständen anderer Art, sondern „was dir ein angeborenes Recht ist, dasselbe ist es auch für mich“ (I, § 31).
Was Wolff eigentlich sagen will, ist, dass „im moralischen Sinne“, d. h. im Hinblick auf die ursprünglich jedem Menschen gegebene Freiheit, „die Menschen gleich sind, deren Pflichten und Rechte dieselben sind“. Die eigentliche Natur des Menschen ist also seine Freiheit. Deswegen kann Wolff auch sagen, dass „die Menschen als Menschen von Natur aus gleich sind“ (Wolff, Institutiones § 70). Gleichheit und Freiheit sind gleichursprüngliche Bestimmungen des Menschen als Menschen. Deswegen entspricht es auch ganz dem Geist dieser Philosophie, wenn neuerdings die Menschenwürde als das Recht des Menschen verstanden wird, Rechte haben zu können (vgl. Enders 1997, 117). Man müsste im Sinne der Aufklärungsphilosophie bzw. des Naturrechtsgedankens hinzufügen: und Pflichten. Rechte und Pflichten haben kann nur der Mensch. Alle bestimmten Rechte, auch das Recht auf Leben, sind diesem absoluten Grundrecht untergeordnet. Doch schon das Recht auf Leben ist ein spezifisches Menschenrecht. Bereits Hegel verweist zur Begründung für das Recht auf Leben auf das besondere Verhältnis, das der Mensch zu seinem Leib hat: „Ich habe diese Glieder, das Leben nur, insofern ich will; das Tier kann sich nicht selbst verstümmeln oder umbringen, aber der Mensch“. Deswegen kann der Mensch ein Recht auf Leben haben, die Tiere haben kein Recht auf ihren Körper, auch nicht auf ihr Leben, „weil sie es nicht wollen“ (Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts § 47). Nur der Mensch kann Rechte haben, weil er frei ist, nicht aber das Tier. Also kann auch das Tier keine Würde besitzen, jedenfalls dann nicht, wenn die Würde als ein Moment unserer Freiheit verstanden wird. Genauer gesagt ist sie das erste Moment aller Freiheit, das, was Hegel abstrakte oder formelle Freiheit nennt, die jeglicher konkreten Form der Freiheit und damit allen Inhalten momenthaft zugrundeliegt.
In diesem Sinne hatte schon vor fast drei Jahrzehnten der Moraltheologe Bruno Schüller (1978) die These vertreten, dass die Würde der Person ein transzendentales Prinzip der Sittlichkeit sei, das weder durch bestimmte Handlungsweisen, noch durch bestimmte empirische Mängel verletzt werde. Gegen diese Position hat Robert Spaemann geltend gemacht, dass das „apriorische Prinzip der Sittlichkeit seine Wirklichkeit nur hat in der empirischen Existenz konkreter Menschen“. Deswegen seien auch bestimmte Handlungsweisen, wie die Tötung unschuldiger Menschen, die sexuelle Exhibition in Peep-Shows und die Retortenproduktion immer mit der Menschenwürde unvereinbar. Wer so handelt, entäußere sich seiner Würde. Die Menschenwürde ist nach dieser Sicht nur in dem Sinne unantastbar oder „unverlierbar“, „daß sie von außen nicht geraubt werden kann“, während sie „durch den, der sie besitzt“, vernichtet werden kann. „Nicht Maximilian Kolbe und nicht Kaplan Popieluszko haben ihre Würde verloren, sondern deren Mörder“ (Spaemann 1987).
So richtig es nun ist, dass die beiden durch ihren Heroismus sicher nicht ihre Würde eingebüßt, sondern sie durch ihn eher sichtbar gemacht haben- was aber könnte es bedeuten, dass ihre Mörder durch die Mordhandlung ihre Menschenwürde verloren haben sollen? Soll es etwa bedeuten, dass diese Mörder, weil sie ja ihre Menschenwürde verloren haben, einer wilden Lynchjustiz überlassen werden dürften anstatt, wie es allen Menschen zusteht, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden? Das kann nicht die Meinung von Spaemann sein. Im Hintergrund scheint die auch für eine ganze Tradition repräsentative These des Thomas von Aquin zu stehen, nach der sich der Mensch durch die Sünde mehr und mehr von der Würde seiner Natur entfernt (Quodl. V 1, 2). Doch diese These macht allererst offenbar, dass es der neuplatonische Würde-Begriff ist, von dem hier die Rede ist. Im neuplatonischen Sinne kann ein Mehr und Weniger der Würde, ihr Abnehmen und ihr völliger Schwund und in diesem Sinne auch ihr Verlust gedacht werden. Im Sinne Kants kann es aber keine Stufung der Würde geben. Sie ist der in der Freiheit begründete Wert der Person und nur der Person. Kann die Person sie also verlieren? In dieser Frage kann man vernünftigerweise nur der Meinung einer sehr langen Tradition sein, die immer davon ausging, dass es ein schlechthin unverlierbares Element unserer Freiheit gibt, das nicht einmal durch die Schandtaten des Subjekts selbst in seiner Existenz gefährdet ist. Der Mensch kann – mit Kant gesprochen – die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person „verletzen“, er kann sie „verleugnen“, aber nicht verlieren. Deswegen spricht Kant auch ausdrücklich von der „unverlierbaren Würde“ (Kant, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre § 11).1
Die minimalistische Interpretation der Menschenwürde meint zuletzt dieses Unverlierbare, Unabwägbare, Unverfügbare, Absolute und Unbedingte als das selbst abstrakte Moment konkreter Freiheit. Es ist jene ursprüngliche Abständigkeit zu sich, die konkrete Selbstdarstellungen, Selbstverzichtleistungen und Selbstrelativierungen des Subjekts erst ermöglicht. Auf diesem Grundgedanken beruhen die Entwürfe über die individuelle Menschenwürde von Seelmann (2003). Diesem minimalistischen Würdeverständnis steht jene klassische Interpretation der unantastbaren Menschenwürde gegenüber, dergemäß sie eine materiale Grundnorm darstellt, aus der sich die Verfassungsprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit und der Demokratie als einer Fundamentalprämisse herleiten lassen, so dass der Sinn des modernen, auf dieser Grundnorm fußenden Staates darin besteht, jene Erhaltungs- und Entfaltungsbedingungen des Menschlichen zu schaffen, „welche nach unserem heutigen Verständnis für ein menschenwürdiges Dasein des Menschen frei von Verknechtung und Ausbeutung, frei von Furcht und Not, unverzichtbar sind“ (Maihofer 1968, 35). Dieses materiale Verständnis der Menschenwürde bewegt sich offenkundig im Reich des Mehr oder Weniger, des Relativen, Abwägbaren, Verfügbaren und Verlierbaren. Es geht aber darum, beides, das Verlierbare wie das Unverlierbare, als Wesensmomente endlicher Freiheit zu erkennen.
Vorgedacht wurde diese Unterscheidung zwischen dem Verlierbaren und Unverlierbaren unserer Freiheit in der christlichen Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Eine große Tradition, die von Irenäus, Clemens von Alexandrien oder Origenes bis ins hohe Mittelalter reicht, hat zwischen dem „Bild“ und „Gleichnis“ als zwei Momenten des inneren Menschen unterschieden (vgl. Crouzel 1956, 67–69, 218–245; Frensch 2000, 213 ff.; Meyer-Drawe 2002). Bild Gottes ist der Mensch danach als das durch die erste Schöpfung Geschaffene, Gleichnis Gottes aber durch die selbsttätige Vollendung des Menschen (vgl. Clemens, Stromata II 22, 131, 6). Wie so oft hat auch in diesem Falle Origenes den schul- und traditionsbildenden Grundgedanken formuliert: Was die Philosophen, d. h. vor allem Platon, die Verähnlichung mit Gott nannten, das hatte doch schon Moses im Buch Genesis im Blick, als er über die erste Erschaffung des Menschen berichtete mit den Worten: „Und Gott sprach: Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bild und nach unserer Ähnlichkeit“. Wenn Moses dann aber im nächsten Vers sagt: „Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie“, hat er nicht etwa in schludriger Weise die Ähnlichkeit vergessen, sondern durch das Verschweigen der „Ähnlichkeit“ darauf hinweisen wollen, dass der Mensch zwar die „Würde des Bildes“ (imaginis dignitas) bei der ersten Schöpfung empfangen hat, dass aber die Vollendung der „Ähnlichkeit“ in seine eigenen Hände gelegt ist (Origenes, De principiis III 6, 1, p. 280, 10).
Für die Kirchenväter, besonders für die griechischen, war es ganz evident, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen in seiner Freiheit besteht. Deswegen bezeichnen die biblischen Begriffe des „Bildes“ und des „Gleichnisses“ Momente der Freiheit. Das Bild meint die Freiheitsausstattung, das Gleichnis die Freiheitsverwirklichung. Wir könnten sagen: Bild Gottes ist der Mensch dadurch schon, dass er als unsterblicher, freier Geist, der Kinder zeugen und Häuser bauen kann, erschaffen wurde. Gleichnis Gottes aber wird er durch seinen aktuellen Willen, d. h. durch seine Freiheit, die ihn Gott ähnlich oder dem Tier ähnlich macht. Die Gleichnishaftigkeit kann somit verlorengehen, die Bildhaftigkeit nicht (Gregor Nyss., De creatione hominis 28, 13). Die menschliche Freiheit hat etwas Verlierbares, insofern der menschliche Wille fehlbar und schwach ist und einen Hang zur Sünde hat. Sie hat aber auch etwas Unverlierbares, insofern sie ein absolutes Beisichsein darstellt, das aller menschlichen Verfügbarkeit entzogen, der Dingwelt enthoben und Grund der individuellen Besonderheit ist. Da die Freiheit aber der Grund der Würde des Menschen ist, enthält auch sie diese beiden sie konstituierenden Momente: das Unverlierbare und das Verlierbare. Wenn wir von der Unantastbarkeit der Würde sprechen, meinen wir dieses unverlierbare, absolute, unbedingte, unverfügbare, unvergleichbare und unschätzbare Element unserer Freiheit. Wenn wir aber sagen, dass die Würde des Menschen zu schützen ist, dann meinen wir jenes anfällige, menschlicher Willkür und Verfügungsgewalt ausgesetzte, situationsabhängige, umstandsbedingte und in materiellen Gütern manifestierbare Element unserer Freiheit.
3. Menschenwürde und Metaphysik
Doch der mit der Idee der Menschenwürde verbundenen bzw. in ihrem Begriff enthaltenen historischen Implikationen sind noch mehr, als sich heutige Verfassungsrechtler und Philosophen träumen lassen. Sie liegen im Begriff der Menschenwürde bzw. der Würde überhaupt verborgen und sind metaphysischen Inhalts. Wie sollte man auch sonst die Anwesenheit des Absoluten in den Verfassungen unserer Tage erklären, wenn nicht durch die Bezugnahme auf eine metaphysische Tradition? Denkt man dem historischen Gebrauch dieses Begriffs der Würde als eines absoluten Wertes genauer nach, wird man mindestens zwei Traditionen unterscheiden müssen, die miteinander zu vermischen die Konfusion der Begriffsbedeutung noch erhöht. Da ist einmal die neuplatonisch-christliche Tradition des Würde-Begriffs. In diesem Sinne betet die Kirche seit frühester Zeit: „Gott, der du die Würde der menschlichen Natur wunderbar gegründet und noch wunderbarer erneuert hast“ (Leo I., Sacramenta Romanae Ecclesiae, PL 55, 146 B). Das bekannteste Zeugnis für diesen neuplatonischen Begriff der Würde des Menschen ist die 1486 entstandene Oratio de hominis dignitate des Giovanni Pico della Mirandola, die in ihren entscheidenden Aussagen auf dem Denken der Kirchenväter beruht (vgl. Kobusch 2006). Die Würde ist nach dieser Vorstellung eine allgemeine Qualität alles Seienden, die jedoch in gestufter Form der toten Materie, dem Lebendigen und schließlich dem Vernünftigen zukommt.
Von der neuplatonischen Tradition ist eine andere zu unterscheiden, nach der allein der Mensch (und andere vernunftbegabte Wesen) Würde besitzt. In der Philosophie Kants hat diese These ihre stichhaltigste Begründung und dadurch jene allgemeine Geltung erlangt, durch die sie auch als der intellektuelle Hintergrund des deutschen Grundgesetzes identifizierbar ist (Enders 1997, 20). Vermischt man diese Traditionen oder hält man – im Sinne einer philosophia perennis – das Eine für die Fortsetzung des anderen, so kann der Widerspruch auftreten, dass einerseits der Menschenwürde als einem den Menschen vor der außermenschlichen Natur auszeichnenden Rang das Wort geredet wird, andererseits jedoch auch dem Tier als einem „Mitgeschöpf“ – und wenn ihm, dann auch der Pflanze – Würde zugesprochen wird (Ottmann 1999). Wodurch der Begriff der Menschenwürde am meisten Bestimmtheit erlangt, ist – nach Kant – der Gegensatz zum Begriff des Preises. Würde und Preis aber sind verschiedene Formen des „Wertes“. Bisweilen setzt Kant den lateinischen Oberbegriff valor mit hinzu, um anzudeuten, in welcher Tradition er sich weiß (Kant, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre § 11). Es ist die Tradition des Naturrechts, die spätestens seit Samuel Pufendorf (De existimatione § 2) den Wert der Sachen, den Preis, geflissentlich von dem Wert der Person im allgemeinen Leben (existimatio), d. h. ihrem guten Ruf, ihrem Renommée, ihrer Reputation, die Georg Friedrich Meier (Recht der Natur § 139) dann auch die „Achtung“ nennt, unterschieden hat.
Was jedoch für das Verständnis des Würdebegriffs in diesem Zusammenhang das Wichtigste ist und von den Kant-Interpreten bis hin zu den gelehrten Kommentaren notorisch übersehen wird, betrifft den ontologischen Charakter des Wertes und damit sowohl der Würde als auch des Preises. Der Wert ist nämlich ein Gewolltes. Im Reich des Gewollten, d. h. der Zwecke, hat nach Kant alles einen Wert, entweder wie die „Sachen“ einen endlichen, den Kant den „Preis“ nennt, oder einen absoluten Wert, d. i. „Würde“, die der Person als solcher zukommt. Beide Arten des Wertes sind im Menschen selbst zu entdecken. Der Mensch als „homo phaenomenon“ hat kaum mehr Bedeutung als ein Tier und insofern nur einen gemeinen Wert (pretium vulgare). Allerdings erhöht seine Verstandesbegabtheit seinen Gebrauchswert, seinen „Preis“, insofern er als Ware angesehen wird, die ge- und verkauft werden kann, ohne jedoch jenen ausgezeichneten Wert (pretium eminens) je erreichen zu können, den das Geld als allgemeines Tauschmittel besitzt. Ganz anders steht es mit dem Menschen als „homo noumenon“ betrachtet, d. h. als Person. Die Person ist für Kant, der damit einer großen mittelalterlichen Tradition folgt, ein moralischer Begriff, d. h. kein Begriff, der ein Naturding bezeichnet. Der Mensch als moralisches Wesen sieht denn auch die Naturdinge weder als Ursachen oder Triebfedern noch als Gegenstände des Wollens an, „vielmehr tritt an deren Stelle nur die moralische Person der Menschheit“ (Der Streit der Fakultäten; Bd. 7, 72). Was den Menschen als Menschen ausmacht, ist daher auch nicht sein Verstand – der verschafft ihm vielmehr nur einen höheren Verkaufswert -, sondern die Moralität und die ihr zugrunde liegende Freiheit.2 Das Wesen aber, das in diesem Sinne frei ist, so dass es sollen, d. h. das Gebot des moralischen Gesetzes wahrnehmen und nach diesem Gesetz auch für zurechnungsfähig gehalten werden kann, ist die Person.
Indem Kant die Person als Wesen der Freiheit versteht, übernimmt er die Grundthese einer jahrhundertelangen, gleichwohl heute nahezu vergessenen metaphysischen Tradition, die die Welt der Freiheit und in ihrer Mitte die Person von der Welt des Naturhaften unterschieden hatte (vgl. Kobusch 1997). Als ein Schlüsselsatz dieser Metaphysik der Freiheit kann angesehen werden, was bei Pufendorf steht, aber auch in der mittelalterlichen Philosophie belegbar ist: „libertas inaestimabilis res est“. D. h. die Freiheit entzieht sich jeder quantifizierenden Wertschätzung, die Person infolgedessen auch (Kobusch 1997, 31). Das Merkwürdigste in diesem Zusammenhang ist aber, dass ein Hinweis Kants auf diese Tradition von der bisherigen Kantforschung kaum wahrgenommen wurde. In der Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, die in besonders reichem Maße die Rezeption traditioneller Begrifflichkeit des Naturrechts und bestimmter metaphysischer Traditionen verrät – deren Aufarbeitung eigentlich die Sache solcher Arbeiten ist, die sich als „Kommentar“ verstehen –, sieht sich Kant an markanter Stelle gezwungen, „einen Schritt hinaus zu tun, nämlich zur Metaphysik“, genauer gesagt zur Metaphysik der Sitten. Dies geschieht, um die notwendige Verknüpfung zwischen dem Begriff des Willens eines vernünftigen Wesens überhaupt (also einschließlich des göttlichen Willens) und dem kategorischen Imperativ als einem objektiv praktischen Gesetz einsichtig zu machen. Das entscheidende Verbindungsglied stammt aus der traditionellen Metaphysik der Sitten, die bei Pufendorf „Ethica universalis“, bei Christian Wolff „Philosophia practica universalis“, in der Wolff-Schule auch „Metaphysica moralis“ genannt wurde. Was Kant in Bezug auf die Metaphysik der Sitten vorgegeben war, war somit nicht bloß – in der Gestalt der „Metaphysica moralis“ des Israel Canz – ein „erratischer Einfall“, wie Brandt (1990, 74) gesagt hat, sondern eine Tradition der Metaphysik, die als Disziplin unter verschiedenen Namen noch nicht sehr lange existierte, deren Wurzeln aber bis ins Mittelalter zurückreichten.
Ihr Gegenstand ist der Mensch als Mensch oder der Mensch als Person. Auf diese Grundidee der traditionellen Metaphysik der Sitten, d. i. die Idee der Person greift Kant an entscheidender Stelle zurück, nämlich da, wo er den Grund des praktischen Gesetzes aufzeigen will. Er sagt selbst: „Gesetzt aber, es gäbe etwas, dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hat, was, als Zweck an sich selbst, ein Grund bestimmter Gesetze sein könnte, so würde in ihm, und nur in ihm allein, der Grund eines möglichen kategorischen Imperativs, d. i. praktischen Gesetzes, liegen“. Dann folgen die berühmten viel zitierten Bestimmungen des absoluten Wertes der Person und des relativen Wertes der Sachen. So wichtig die inhaltliche Bestimmung des Personbegriffs ist, so wichtig ist doch auch die Funktion dieses Versatzstückes aus der traditionellen Metaphysik der Sitten. Die Lehre vom absoluten Wert der Person, die jedem vernünftigen Willen, auch dem göttlichen, wenn nicht Achtung (als der für endliche Vernunftwesen angemessenen Form der Schätzung), dann eine andere Form der Wertschätzung hervorruft,3 liegt der Vorstellung von einem möglichen kategorischen Imperativ zugrunde. Das oberste praktische Prinzip beruht auf dem metaphysischen Grundsatz von der Person als einem mit Würde ausgestatteten Wesen, oder wie Kant selbst das ausdrückt: „wenn aber aller Wert bedingt, mithin zufällig wäre, so könnte für die Vernunft überall kein oberstes praktisches Prinzip angetroffen werden“ (Kant, Bd. 4, 428). Deswegen ist auch die Formulierung des praktischen Prinzips, die sich aufgrund der Idee des Menschen als eines Zweckes an sich ergibt, gar nicht mehr bloß formal, sondern mit dem Zentralbegriff der traditionellen Metaphysik des Moralischen, nämlich dem der Person angefüllt: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“ (429). Die Kant-Forschung scheint die Brisanz und Problematik dieser Bezugnahme auf, bzw. den „Schritt“ hinaus in die Metaphysik der Sitten gar nicht recht deutlich erkannt zu haben. Die vorliegenden Kommentare lassen den Leser völlig im Stich.4 Einzig Brandt und Horn haben sich mit dieser merkwürdigen Bezugnahme Kants auf die Metaphysik der Sitten eingehend auseinandergesetzt. Wie Horn in seiner intensiven Studie über die Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs zu zeigen sucht, ist der in der Autonomie des Menschen begründete absolute Wert der Person nur für ein menschliches Bewusstsein, d. h. er erscheint als „unüberbietbar hochwertiges Ziel“ nur aus menschlicher Perspektive. Damit aber verliert sie konsequenterweise den Charakter eines „metaphysisch-objektiven Gutes“ (Horn 2004, 211 f.). Doch worin besteht dann der Schritt hinaus in die Metaphysik der Sitten? Kant hat zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der absolute Wert der Person auch für das höchste Wesen der Beurteilungsmaßstab ist. Nach Brandts (1990) Interpretation bezeichnet der von Kant angezeigte „Schritt“ (Kant, Bd. 4, 426) den Übergang von der philosophia practica universalis zur Metaphysik der Sitten. Und zwar bestehe dieser Schritt allein darin, dass der Begriff eines Willens von vernünftigen Wesen überhaupt gewonnen wird. Doch das kann nicht sein. Denn die populäre sittliche Weltweisheit, von der zur Metaphysik der Sitten übergegangen wird, ist nicht identisch mit der philosophia practica universalis. Und der entscheidende Begriff, der durch den Übergang gewonnen wird, ist nicht der des vernünftigen Willens überhaupt, sondern der des Zwecks an sich, bzw. der Person. Der Begriff der Person ist aber ganz ohne Zweifel ein metaphysischer Begriff für Kant. Nicht von ungefähr gehört auch er zu den der Metaphysik der Sitten in ihren beiden Teilen vorangestellten, aber ihnen gemeinsamen Begriffen. Dort steht zudem unter IV der „Einleitung“ hinter dem Titel der Metaphysik der Sitten in Klammern: „philosophia practica universalis“. Das zeigt mit aller Deutlichkeit, dass Kant seine eigene Metaphysik der Sitten als die kritische Fortsetzung dieser Tradition, die er durch seinen Lehrer Martin Knutzen schon früh hatte kennenlernen können, verstanden hat (Kobusch 1997, 99).
Dem widerspricht weder die in der Vorrede zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten geäußerte methodologische Kritik an der „allgemeinen praktischen Weltweisheit“ noch der ihr von Kant – wie Brandt (1988, 180 ff.) das wahrscheinlich gemacht hat – quasi in den Mund gelegte vitiöse Zirkel im letzten Abschnitt der Schrift. Doch nicht nur die Idee von der Person und der ihr zukommenden Würde stammt aus der traditionellen Metaphysik der Sitten. Auch die Vorstellung von einem „Reich der Zwecke“ (Kant, Bd. 4, 433), d. i. einem Reich der Personen, das Kant auch das Reich der Freiheit oder das Reich der Sitten oder das Reich der Gnade nennen kann, stammt offenkundig aus der Tradition der Metaphysik der Sit- ten.5 Gottfried Wilhelm Leibniz, der den Einfluss dieser Metaphysik des Moralischen erfahren hat, hat schon im Discours de Métaphysique und in den Briefen an Arnauld die Idee einer moralischen Welt, d. h. einer Welt von Personen oder Ichs entwickelt, die er in seinen späten Schriften Principes de la Nature et de la Grace und in der so genannten Monadologie unter dem Titel einer „moralischen Welt“ innerhalb der „natürlichen Welt“ bzw. des Reichs der Gnade oder Freiheit wiederaufgenommen hat.
Kant hat das Reich der Gnade mit dem Reich der Zwecke direkt gleich- gestellt.6 Im Reich der Freiheit sind nach Kant alle vernünftigen Wesen vereint. Die endlichen Personen, die als autonome Wesen sich selbst das moralische Gesetz geben, zugleich aber doch auch dem Gesetz unterworfen sind, heißen Glieder des Reichs der Zwecke. Dasjenige Wesen jedoch, das nicht dem Willen eines anderen unterworfen ist, wird hier, im Reich der Freiheit, das „Oberhaupt“ genannt. Leibniz hat auch diese Vorstellung vorbereitet: Nach seiner Lehre ist Gott für die materiellen Substanzen dasjenige, was die aristotelische Tradition immer lehrte, nämlich die gemeinsame Ursache aller Wesen. Im Verhältnis zu den Geistern aber, d. h. auch im Verhältnis zu den Personen erscheint Gott im Reich der Gnade als das „Oberhaupt“. Was der unbewegte Beweger im Reich der Natur ist, das ist das Oberhaupt im Reich der Personen (vgl. Schneider 1967; Kobusch 1998; Timmermann 2004, 132). In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch nicht ganz unangebracht darauf hinzuweisen, dass es Leibniz war, der Kenntnis hatte von der gerade entstandenen „Ontologie“ oder „Metaphysik des Rechts“, so dass Kant auch mit dem für die Rechtslehre in Erwägung gezogenen Titel einer „Metaphysik des Rechts“ (Metaphysik der Sitten, Vorrede) schon auf dieses neue Genre Bezug nimmt (Kobusch 1997, 240 f.). Aus all dem ergibt sich aber – was durch eine genauere Prüfung der Grundlegung und der Metaphysik der Sitten noch erhärtet werden könnte –, dass die Kantische Metaphysik der Sitten und die in ihrem Zentrum stehenden Begriffe der Person und der Menschenwürde angemessen nur vor dem Hintergrund der Tradition der Metaphysik des Moralischen verstanden werden können. Als Person versteht Kant das Subjekt einer moralisch-praktischen Vernunft. Eben als solches ist der Mensch über allen Preis erhaben und niemals bloß ein Mittel zum Zweck. Vielmehr ist er selbst der Zweck allen Wollens, d. h. ein Zweck an sich. Deswegen hat der Mensch als Person gar keinen endlichen Wert, sondern ist als ein Zweck an sich zu schätzen. Eben dies, den inneren Wert des Menschen, sofern er als Person angesehen wird, nennt Kant die „Würde“, „wodurch er allen andern vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnöthigt“ (Bd. 6, 435).
Indem Kant den Preis als den endlichen, relativen, quantitativ abschätzbaren und austauschbaren Wert einer Sache und die Würde als den unendlichen, absoluten, inkommensurablen und unersetzbaren Wert der Person gegenüberstellt, hat er zwei Lehrstücke aus der oben erwähnten Tradition der Ontologie des Moralischen, die auch weite Teile des Naturrechts beeinflusst und bestimmt hat, kunst- und wirkungsvoll zur Geltung gebracht. Da die begriffliche Unterscheidung zwischen Preis und Würde erstmals bei Seneca belegbar ist, wird in der Kantforschung ein direkter Einfluss auf Kant angenommen (vgl. Forschner 1998, 37). Doch scheint das wenig wahrscheinlich zu sein. Vielmehr verraten die zitierten einzelnen Differenzierungen des Begriffs des Wertes (pretium vulgare, pretium usus, pretium eminens), denen an anderer Stelle noch die Unterscheidung zwischen dem Marktpreis und dem Affektionspreis hinzugefügt ist,7 dass Kant hier eine durchaus im Zusammenhang der Metaphysik des Moralischen entwickelte, im Naturrecht breit aufgenommene, auch bei Nettelbladt, Achenwall und G. F. Meier nachweisbare Preislehre aufgenommen hat (Kobusch 1997, 81 ff.). Ferner ist die enge Verbindung zwischen dem Begriff der Person und dem der Würde bei den Stoikern nicht belegbar. Es gibt aber eine in der mittelalterlichen Christologie grundgelegte Lehre, nach der die menschliche Person ein moralisches Wesen ist (und somit nicht nur Naturwesen), dem als solchem die „Würde“ im Sinne einer hervorragenden Eigenschaft zukommt oder besser: dessen Würde in einer besonderen Wertschätzung zu erkennen ist (Kobusch 1997, 23–30). Kants Würdebegriff steht insofern nicht am Anfang einer neuzeitlichen Geschichte, sondern stellt den Höhepunkt einer im Mittelalter beginnenden Lehre vom moralischen Sein dar, die selbst bis in unsere Tage wirkt (anders: Jaber 2003, 126).
4. Menschenwürde und Achtung
Die Formulierungsverbesserung im vorletzten Satz deutet auf eine sachliche Problematik hin, die beim Nachdenken über die Menschenwürde notwendigerweise in den Blick kommt. Wenn der Mensch als Person, d. h. der Mensch als Mensch mit Kant einen absoluten Wert hat, fragt es sich, worin dieser absolute Wert begründet liegt. Die Antwort Kants ist allüberall bekannt: Es ist die Freiheit selbst, genauer die Art der Gesetzgebung, nämlich die Autonomie, die unbedingten und unvergleichbaren Wert besitzt. Der absolute Wert der Person, der in ihrer Autonomie begründet ist, kann aber nur im Modus der Achtung erfasst werden. Die Achtung als die dem absoluten Wert der Person angemessene Wertschätzung besteht aber – konkret und negativ – darin, dass eine Person niemals zum bloßen Objekt gemacht werden darf. Der Begriff der Achtung impliziert somit ein „Totalinstrumentalisierungsverbot“ (Braun 2004, 87 ff.). Kein Geringerer als Arthur Schopenhauer hat den Kantischen Begriff der Menschenwürde einer Fundamentalkritik unterzogen. Der Begriff der Würde im Sinne eines in der Freiheit begründeten „unbedingten, unvergleichlichen Wertes“ scheint nämlich, wie auch der des „absoluten Gutes“, selbstwidersprüchlich zu sein, weswegen er einer hohlen Hyperbel gleicht, in deren Innerem als nagender Wurm die contradictio in adiecto nistet, denn ein Wert ist immer ein Vergleichbares und somit also ein Relatives (vgl. Kobusch 1997, 187). Doch diese Kritik ist ganz unberechtigt. Denn keine andere Disziplin außer der Metaphysik der Sitten und ihren Vorgängerinnen – der Ethica universalis, der Philosophia practica universalis, der Metaphysica moralis – hat ein so waches Bewusstsein dafür entwickelt, dass Werte allgemein, auch die Würde als absoluter Wert, sich – nicht in jedem Falle in ihrer Existenz – einem Wertbewusstsein oder einer Wertschätzung verdanken.
Diese Wertschätzung des absoluten Wertes – der ja nur deswegen „absolut“ genannt wird, weil er mit anderen Gegenständen nicht verglichen werden kann – heißt bei Kant die Achtung. Die Würde der Person ist immer nur im Modus der Achtung. Da, wo Würde ist, ist auch diese Form der Wertschätzung. Die Achtung konstituiert nicht die Würde, aber nur sie vermag sie zu erkennen. Kant sagt ausdrücklich: „Diese Schätzung giebt also den Werth einer solchen Denkungsart als Würde zu erkennen und setzt sie über allen Preis unendlich weg, mit dem sie gar nicht in Anschlag und Vergleichung gebracht werden kann, ohne sich gleichsam an der Heiligkeit derselben zu vergreifen“ (Bd. 4, 434). Auch der endliche Wert, der Preis, ist nur im Modus des „öffentlichen Urteils“ über den Wert der Sache (Bd. 6, 288). Offensichtlich übernimmt auch in dieser Frage Kant die Position der traditionellen Metaphysik des Moralischen, nach der sich sogar die gesamte Welt der „entia moralia“, zu der auch und vor allem die Person, das Geld, die Schuld, alles, was mit unserer Freiheit zu tun hat, gehört, einer Wertschätzung verdankt. Petrus Aureoli, der hier repräsentativ für diese Tradition stehe, sagt: „Esse enim morale non consistit in re extra, sed in aestimatione hominum“ (Petrus Aureoli, In IV Sent. d. 14 q. 1 a. 4, ed. Rom 1605, II 134 aE). Suárez, Pufendorf und andere Vertreter dieser Metaphysiktradition haben zudem deutlich gemacht, dass die Welt des Moralischen nicht mit jenen Kategorien zu fassen ist, die Aristoteles mit Blick auf die Welt der Natur gewonnen hatte. Daher kann man im Sinne der Tradition der Metaphysik der Sitten auch nicht sachgemäß sagen, dass die Würde der Person „zukomme“, denn das Zukommen bezeichnet in der aristotelischen Tradition das Verhältnis einer Eigenschaft zu einer Substanz, der sie inhäriert. Doch weder ist der Preis eine der Sache anhaftende noch die Würde eine der Person zukommende Eigenschaft – möglicherweise im Unterschied zum Recht, das traditionell eine „qualitas moralis“ genannt wurde oder zu den Grundrechten, die in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung „inherent rights“ heißen. Vielmehr haben beide, der Preis wie die Würde, ihren Grund in einer bestimmten Form der Wertschätzung. Der angemessene Ausdruck der Wertschätzung gegenüber der Würde der Person ist die Achtung – jedenfalls seitens endlicher, genauer gesagt: sinnlichkeitsbedingter endlicher Wesen, also der Menschen.
Im Begriff der Achtung liegt das Bewusstsein der Unterordnung des Willens unter das moralische Gesetz, das mir gebietet, eine Person niemals bloß als Mittel zu gebrauchen, und somit eine Art der Demut vor dem reinen Gesetz. Deswegen kann die Achtung auch nicht als die Ursache des Gesetzes, sondern muss als eine Wirkung desselben angesehen werden (Kant, Bd. 4, 405). Kurzum: Die Achtung ist jene Form der Wertschätzung, die nur menschlichen Personen und niemals dem höchsten Wesen oder reinen Geistern ohne Sinnlichkeit „beigelegt“ werden kann (Bd. 5, 75). Kant hat uns diesen alten Begriff der Wertschätzung näher gebracht, indem er ihn gewissermaßen übersetzte mit dem der Anerkennung. Die Achtung ist deswegen auch die Anerkennung einer Würde an anderen Menschen, d. h. eines unvertauschbaren Wertes (Bd. 6, 462).
Doch was ist die Ursache für die Existenz der Würde des Menschen, wenn es die Achtung als sinnlichkeitsbedingte Wertschätzung nicht sein kann? Auch wenn uns an dieser Stelle der metaphysischen Spekulation die Kantische Systematik und Begrifflichkeit verlässt, muss doch auch diese Frage im Sinne eines Nachdenkens über die Menschenwürde erschöpfend, d. h. bis zu einer befriedigenden Antwort durchdacht werden. Als Ursache für die Existenz der Würde, also des absoluten Wertes des Menschen, kommt, da auch die Existenz des Preises, also des endlichen Wertes, auf die Wertschätzung eines endlichen Bewusstseins als Ursache zurückzuführen ist, nur irgendeine Form der Wertschätzung, d. h. der Anerkennung in Frage.
In dieser Situation kommt uns die Philosophie Hegels zu Hilfe, dessen Rechtsphilosophie ohnehin, auch nach zeitgenössischen Einschätzungen, die legitime Fortführung und Erbschaft der Kantischen Metaphysik der Sitten ist. Nach Hegels Lehre können zwei Äußerungsformen der Anerkennung angenommen werden, nämlich die Ehre und die Liebe. Die Liebe führt zu Ende, was doch schon in der Ehre als dem Bedürfnis, sich anerkannt, d. h. die Unendlichkeit der eigenen Person in einer anderen aufgenommen zu sehen, angelegt ist (Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik; Bd. 14, 182). Das Christentum hat nach Hegel das Bewusstsein von dem unendlichen Wert des einzelnen Individuums in unsere Welt gebracht. Bei den Griechen war der „Mensch als solcher noch nicht anerkannt in seinem unendlichen Werte und seiner unendlichen Berechtigung“ (Hegel, Enzyklopädie I, § 163). Das Christentum dagegen enthält die Lehre, „daß die Subjektivität einen unendlichen Wert hat“ (§ 147), weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Es ist somit das Christentum, nach dem das Individuum als solches einen unendlichen Wert hat, indem es Gegenstand und Zweck der Liebe Gottes ist, an sich zur höchsten Freiheit bestimmt (III, § 482; Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. 19, 500). Es war auch das Christentum, bzw. die christliche Philosophie des Mittelalters und die Christologie des Suárez – so kann man, so muss man Hegel beipflichten – die die Vorstellung und den Begriff, d. h. das Bewusstsein vom „unendlichen Wert“ der Person allererst geweckt hat, indem sie die Erlösungstat Christi als ein Werk von „unendlichem Wert“ bezeichnet, der in der physischen Welt nicht vorkommen kann, sondern Kennzeichen des Moralischen ist und zuletzt in der „unendlichen Würde seiner Person“ gründet.
Daher kann es keinen Zweifel geben: Im Moralischen liegt per se ein unendlicher Wert beschlossen (Bonaventura, III Sent. d. 32 a. un. q.5, ed. Quaracchi III 705b). Die Würde der Person als absoluter Wert ist so für uns vernünftige Sinneswesen nur im Modus der Anerkennung, die Kant die Achtung nennt, konstituiert aber wird sie durch jene Form der Anerkennung, die Hegel die göttliche Liebe nennt. Die spekulative Ethik des 19. Jahrhunderts hat diesen Gedanken Hegels aufgenommen und der göttlichen Liebe den Charakter des Schöpferischen bescheinigt (vgl. Kobusch 1997, 210–216), weil sie von sich her das Wollen anderer Freiheit ist. Die menschliche Person, die in diesem Zusammenhang auch die „hypostasierte Freiheit“ genannt worden ist, weil sie Abstand von sich gewinnen und das üben kann, was Goethe die „Entsagung“ nennt, ist das von der göttlichen Liebe gewollte und durch sie geadelte Wesen. Deswegen sagen wir, dass es unendlichen Wert, also Würde besitzt.
Von all diesen metaphysischen Gedanken, die im Begriff der Menschenwürde ursprünglich und immer schon implizit enthalten waren, scheint bei den modernen Entwürfen eines anthropologischen Menschenwürdebegriffs Abstand genommen worden zu sein. Über die Legitimität oder Illegitimität eines solchen Abstraktionsvorgangs mögen andere urteilen. Was jedoch dem anthropologischen Rasiermesser dieser Art zum Opfer fällt, das sollte hier in Erinnerung gerufen und in ihr auch bewahrt werden.
Literatur
Augustin, Angela: Argumentationsmuster: Menschenwürde im Zusammenspiel von Recht und Philosophie. In: Ralf Stoecker (Hg.), Menschenwürde. Annäherung an einen Begriff. Wien 2003, 103–118.
Balzer, Philipp/Rippe, Klaus Peter/Schaber, Peter (Hg.): Menschenwürde vs. Würde der Kreatur. Freiburg/München 1998.
Baumann, Peter: Menschenwürde und das Bedürfnis nach Respekt. In: Ralf Stoecker (Hg.), Menschenwürde. Annäherung an einen Begriff. Wien 2003, 19–34.
Birnbacher, Dieter: Menschenwürde – abwägbar oder unabwägbar? In: Matthias Kettner (Hg.), Biomedizin und Menschenwürde. Frankfurt a. M. 2004, 249–271.
Brandt, Reinhard: Der Zirkel im dritten Abschnitt von Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Hariolf Oberer/Gerhard Seel (Hg.), Kant. Analysen – Probleme – Kritik. Würzburg 1988, 169–191.
– : Kant als Metaphysiker. In: Volker Gerhardt (Hg.), Der Begriff der Politik. Stuttgart 1990, 57–94.
Braun, Kathrin: Die besten Gründe für eine kategorische Auffassung der Menschenwürde. In: Matthias Kettner (Hg.), Biomedizin und Menschenwürde. Frankfurt a. M. 2004, 81–99.
Crouzel, Henri: Théologie de l’Image de Dieu chez Origéne. Paris 1956.
Dreier, Horst: Bedeutung und systematische Stellung der Menschenwürde im deutschen Grundgesetz. In: Kurt Seelmann (Hg.), Menschenwürde als Rechtsbegriff. Stuttgart 2004, 33–48.
Enders, Christoph: Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung. Tübingen 1997.
Forschner, Maximilian: Marktpreis und Würde oder vom Adel der menschlichen Natur. In: Henning Kössler (Hg.), Die Würde des Menschen. Erlangen 1998, 33–59.
Frensch, Michael: Weisheit in Person. Das Dilemma der Philosophie und die Perspektive der Sophiologie. Schaffhausen 2000.
Goffi, Jean-Yves: Des droits á la valeur: La question des êtres de nature. In: Dennis Müller/Hugues Poltier (Hg.), La dignité de l’animal. Genève 2000, 249–258.
Habermas, Jürgen: Die Zukunft der menschlichen Natur. Frankfurt a. M. 2001.
Hegel, Georg W. F.: Werke in 20 Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832–1845 neu edierte Ausgabe. Redaktion: Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel. Frankfurt a. M. 1969–1971.
Höffe, Otfried (Hg.): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Ein kooperativer Kommentar. Frankfurt a. M. 1989.
– : Wessen Menschenwürde? In: Christian Geyer (Hg.), Biopolitik. Die Positionen. Frankfurt a. M. 2001, 65–72.
– : Menschenwürde als ethisches Prinzip. In: ders./Ludger Honnefelder/Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hg.), Gentechnik und Menschenwürde. Köln 2002, 111–141.
Horn, Christoph: Die Menschheit als objektiver Zweck. In: Dieter Sturma (Hg.), Kants Ethik. Paderborn 2004, 195–212.
Jaber, Dunja: Über den mehrfachen Sinn von Menschenwürde-Garantien. Frankfurt a. M. 2003.
Kant, Immanuel: Gesammelte Schriften, hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1902 ff.
Kaulbach, Friedrich: Immanuel Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Darmstadt 1988.
Kobusch, Theo: Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild. Darmstadt 21997.
– : Person und Subjektivität: Die Metaphysik der Freiheit und der moderne Subjektivitätsgedanke. In: Reto Luzius Fetz/Roland Hagenbüchle/Peter Schulz (Hg.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität. Berlin/New York 1998, 743–761.
– : Die Würde des Menschen – ein Erbe der christlichen Philosophie. Loccum 2006.
Ladwig, Bernd: Ist „Menschenwürde“ ein Grundbegriff der Moral gleicher Achtung? Mit einem Ausblick auf Fragen des Embryonenschutzes. In: Ralf Stoecker (Hg.), Menschenwürde. Annäherung an einen Begriff. Wien 2003, 35–60.
Löhrer, Guido: Menschliche Würde. Wissenschaftliche Geltung und metaphorische Grenze der praktischen Philosophie Kants. Freiburg/München 1995.
Luhmann, Niklas: Grundrechte als Institution: ein Beitrag zur politischen Soziologie. Berlin 1965.
Maihofer, Werner: Rechtsstaat und menschliche Würde. Frankfurt a. M. 1968.
Meyer-Drawe, Käthe: Entbildung – Einbildung – Bildung. In: Rudolf Behrens (Hg.), Ordnungen des Imaginären. Theorien der Imagination in funktionsgeschichtlicher Sicht. Hamburg 2002, 181–194.
Oeing-Hanhoff, Ludger: „Bedürfnis“. In: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, hrsg. von der Görres-Gesellschaft. Freiburg i. Br. 1985. Bd. 1, 600–604.
Ottmann, Henning: Der Begriff der Menschenwürde. Warum er unverzichtbar und warum er problematisch ist. In: Beat Sitter-Liver (Hg.), Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im globalen Kontext. Freiburg (Schweiz) 1999, 43–62.
Pollmann, Arnd: Würde nach Maß. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 53, 2005, 611–619.
Schaber, Peter: Menschenwürde und Selbstachtung. Ein Vorschlag zum Verständnis der Menschenwürde. In: Emil Angehrn/Bernard Baertschi (Hg.), Menschenwürde. La Dignité de l’Être Humain. Basel 2004, 93–106.
Schneider, Hans-Peter: Justitia Universalis. Quellenstudien zur Geschichte des „christlichen Naturrechts“ bei Gottfried Wilhelm Leibniz. Frankfurt a. M. 1967, 429–451.
Schönecker, Dieter/Wood, Allen W.: Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Ein einführender Kommentar. Paderborn 2002.
Schüller, Bruno: Die Personwürde als Beweisgrund in der normativen Ethik. In: Philosophie und Theologie 53, 1978, 538–555.
Seelmann, Kurt: Menschenwürde zwischen Person und Individuum. Von der Repräsentation zur Selbstdarstellung? In: Jus humanum. Grundlagen des Rechts und Strafrechts. Berlin 2003, 301–316.
Spaemann, Robert: Über den Begriff der Menschenwürde. In: ders., Das Natürliche und das Vernünftige. München 1987, 77–106.
Stoecker, Ralf: Selbstachtung und Menschenwürde. In: Emil Angehrn/Ber- nard Baertschi (Hg.), Menschenwürde. La Dignité de l’Être Humain. Basel 2004, 107–119.
Timmermann, Jens (Hg.): Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Göttingen 2004.
Werner, Micha H.: Menschenwürde in der bioethischen Debatte – Eine Diskurstopologie. In: Matthias Kettner (Hg.), Biomedizin und Menschenwürde. Frankfurt a. M. 2004, 191– 220.
Wetz, Franz J.: Die Würde der Menschen ist antastbar. Stuttgart 1998.
– : Menschenwürde als Opium fürs Volk. Der Wertstatus von Embryonen. In: Matthias Kettner (Hg.), Biomedizin und Menschenwürde. Frankfurt a. M. 2004, 221–248.
1 Löhrer (1995, 349) stimmt der Meinung Spaemanns zu. Doch sie entspricht nicht der Lehre Kants. Der Kantischen Lehre entsprechend dagegen sagt Höffe (2002, 132): „Auch ein Verbrecher bleibt Zweck an sich selbst, behält also Würde“.
2 Vgl. Kant, Der Streit der Fakultäten (Bd. 7, 72): „Diese Moralität und nicht der Verstand ist es also, was den Menschen erst zum Menschen macht.“
3 Vgl. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Bd. 4, 439): Und „was (...) den absoluten Werth des Menschen allein ausmacht, darnach muß er auch, von wem es auch sei, selbst vom höchsten Wesen beurtheilt werden“.
4 Vgl. Kaulbach 1988, 74; Schönecker/Wood 2002; Höffe 1989; Timmermann 2004.
5 Vgl. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Bd. 6, 82. Der Streit der Fakultäten, AA VII 69; Kritik der reinen Vernunft B 840. Vgl. auch J. G. Canzius, Disciplinae morales omnes, Frankfurt/Leipzig 1752 (Nachdr. in: Chr. Wolff, Gesammelte Werke, III 32, Hildesheim/New York 1994), §§ 181/182 (1315): „regnum morum“. Noch nach J. G. E. Maaß, Grundriß des Naturrechts, § 27 (S. 19) – einer Naturrechtslehre im Geiste Kants – ist der Gegenstand der „reinen practischen Philosophie“, d. h. der Metaphysik der Sitten, ein Reich der Freiheit überhaupt.
6 Vgl. Kant, Antwort an Eberhard (Bd. 8, 250): „(...) dem Reiche der Gnaden (dem Reiche der Zwecke in Beziehung auf den Endzweck, d. i. den Menschen unter moralischen Gesetzen) (...)“.
7 Vgl. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Bd. 4, 434 f.