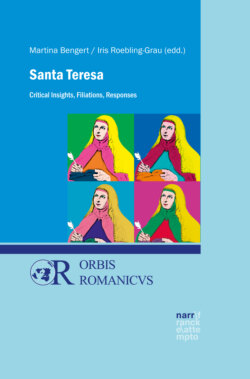Читать книгу Santa Teresa - Группа авторов - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Unterscheidung der Geister in den Schriften Teresas von Ávila und ihre Rezeption bei Edith Stein
ОглавлениеMICHAEL PLATTIG O.CARM.
„Unterscheidung der Geister“ meint eine Grundhaltung, die im ersten Brief an die Thessalonicher, dem ältesten Dokument des Neuen Testaments, in 5,21 so beschrieben wird: „Prüft alles, und behaltet das Gute!“1 Für Paulus gehört zum Christsein die Ausbildung eines kritischen Bewusstseins oder, um es mit einem biblischen Begriff zu sagen, einer kritischen Wachsamkeit. Kritisch meint dabei das wache und aufmerksame Bewusstsein, das nicht einfach alles und jedes übernimmt, sondern alles prüft und das Gute behält. Es geht letztlich um die positive kritische Haltung des Christen bzw. der Christin dem Leben, den Erlebnissen, den Situationen des Lebens und Sterbens sowie der Welt gegenüber. Dieser kritische Geist der Unterscheidung kommt nicht irgendwie zum Christsein hinzu, sondern gehört zur Wesensbestimmung des Christentums.
Gerade hinsichtlich der Erfahrung, oder richtiger gesagt des Erlebens von Menschen, wurde die Unterscheidung der Geister bedeutsam. Das religiöse Erleben, das durch seine Einordnung und Versprachlichung im Zusammenhang des Lebenskontextes von Menschen zur Erfahrung wird, ist nicht gleich eine Glaubenserfahrung oder gar eine Erfahrung des Heiligen Geistes, sondern genau dies bedarf der Prüfung. Dabei geht es nicht um sogenannte inquisitorische Maßnahmen, die besonders heute von bestimmten Gruppen jeder Infragestellung von Erfahrungen sofort unterstellt werden. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage nach dem Guten, um die Prüfung von allem, um das Gute und nicht das Schlechte zu behalten.
Dabei steht nicht die Frage von gut oder böse, von moralisch richtig oder falsch im Vordergrund. Das ist nur ein Aspekt. Die Fragestellung ist breiter, nämlich, was den Menschen in seiner Entwicklung in seinem Menschsein und vor allem in seiner Beziehung zu Gott hilft, ihn voranbringt, was positives Wachstum bedeutet und was diesem widerspricht. Der kritische Umgang mit Erfahrungen ist unabdingbar, denn eine Selbsttäuschung, eine Projektion oder eine Einbildung führt den Menschen nicht weiter, sondern lässt ihn unablässig um sich selbst kreisen.
Da die Ausbildung eines kritischen Bewusstseins angestrebt wird, können nicht einfache, allgemeingültige Prinzipien entwickelt werden. Die Frage nach der Unterscheidung der Geister ist, da der (einzelne) Mensch im Mittelpunkt steht, vielschichtig und mannigfaltig. Ziel ist das Hineinwachsen in eine Haltung, in eine Art und Weise des kritischen reflektierten Umgangs mit sich selbst, mit seinem Gottesverhältnis, mit den Nächsten und mit der Welt.
Das alte Mönchtum wie es in den Apophthegmata Patrum2 erscheint war skeptisch gegenüber religiösen Erfahrungen, weil es sich leicht um Täuschungen handeln konnte. Es wurde als besonders geschickte List des Teufels angesehen, sich in Gestalt eines Engels oder Christi selbst zu zeigen und fromme Dinge wie das Aufstehen zum Beten oder das soziale Tun zu fordern. Dahinter, so die Erfahrung der Väter und Mütter der Wüste, verbirgt sich eine Strategie, den Menschen müde zu machen, ihn ständig zu überfordern, damit er die Freude am Leben verliert und der Akedia, dem Überdruss, anheimfällt. Grundsätzlich formuliert es der angesehene Wüstenvater Abbas Poimen: „Alles Übermaß ist von den Dämonen.“3 Daher geht der Rat der Väter und Mütter der Wüste immer dahin, derartige religiöse Erlebnisse nicht zu beachten und nicht ernst zu nehmen, dann verschwinden sie von selbst oder entlarven sich als vom Bösen initiiert.4 Sogar die Gestalt Jesu Christi kann der Teufel annehmen: Als der vermeindliche Christus erscheint, antwortet der Altvater: „,Ich will hier Christus nicht schauen, sondern in jenem Leben erst.‘ Als der Teufel dies hörte, verschwand er.“5
Johannes vom Kreuz teilt grundsätzlich diese kritische Haltung des Mönchtums und geht noch einen Schritt weiter, denn für ihn ist letztlich die Überwindung der Bezogenheit des Menschen auf religiöse Erfahrungen das Ziel. Die Abhängigkeit von religiöser Erfahrung macht den Menschen mit der Zeit unfrei und behindert vor allem das Erwachsenwerden im Glauben. Johannes spricht von geistlicher Habgier: „Auch haben viele dieser Anfänger manchmal eine große geistliche Habgier, denn man kann fast nie feststellen, daß sie mit dem Geist, den Gott ihnen gibt, zufrieden sind. Sie sind ganz untröstlich und gereizt, weil sie in den geistlichen Dingen nicht den Trost finden, den sie darin finden möchten.“6
Die Fixierung des Menschen auf den eigenen Genuss oder den fühlbaren Trost führt dazu, dass er im Wachstum stecken bleibt. Den Weg zur Befreiung und zum Wachstum beschreibt Johannes daher als Entwöhnungsprozess und als Krisenerfahrung:
Die Umgangsform der Anfänger auf dem Weg zu Gott ist noch sehr von Unzulänglichkeit, Eigenliebe und Wohlgeschmack durchsetzt. Gott aber will sie weiterführen und aus dieser unzulänglichen Liebe zu einer höheren Stufe der Gottesliebe heraufholen und sie von der unzulänglichen Übungsweise im Sinnenbereich und den Gedankengängen befreien, womit sie so berechnend und unangebracht Gott suchten, wie wir sagten. Er möchte sie in die Übung des Geistes stellen, wo sie sich ausgiebiger und schon mehr befreit von Unvollkommenheiten mit Gott austauschen können. […] Da Gott spürt, daß sie bereits ein klein bißchen gewachsen sind, nimmt er sie von der süßen Brust weg, damit sie nun erstarken und aus den Windeln herauskommen, läßt sie von seinen Armen herab und gewöhnt sie daran, auf eigenen Füßen zu gehen. Dabei verspüren sie etwas ganz Neues, denn für sie hat sich alles auf den Kopf gestellt. 7
Zum Erwachsenwerden in der Gottesbeziehung gehört die Überwindung der kindlichen Fixierung auf die „Trosterfahrungen“. Johannes sieht dafür den Grund in Gottes Handeln selbst, nämlich in der Inkarnation, d.h. seiner Menschwerdung. Wer besondere Erfahrungen und Offenbarungen sucht, dem könnte Gott antworten und sagen:
Wenn ich dir doch schon alles in meinem Wort, das mein Sohn ist, gesagt habe und kein anderes mehr habe, was könnte ich dir dann jetzt noch antworten oder offenbaren, was mehr wäre als dieses? Richte deine Augen allein auf ihn, denn in ihm habe ich dir alles gesagt und geoffenbart, und du wirst in ihm noch viel mehr finden, als du erbittest und ersehnst. […] [E]r ist meine ganze Rede und Antwort, er ist meine ganze Vision und Offenbarung.8
Teresa von Ávila steht auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte den geistlichen Erfahrungen positiver gegenüber als Johannes vom Kreuz. Teresa hatte ihn, der den Karmelitenorden verlassen und Karthäuser werden wollte, dafür gewinnen können, die von ihr für die Frauenklöster angestrebte Reform beim männlichen Zweig in Angriff zu nehmen. Es klingt fast ein wenig trotzig, wenn Teresa schreibt:
„Offenbar löst es bei manchen Menschen einen Schrecken aus, wenn sie von Visionen und Offenbarungen auch nur reden hören. Ich verstehe weder den Grund, warum man das für einen so gefährlichen Weg hält, wenn der Herr eine Seele so führt, noch wo diese Verkrampfung herkommt.”9
Trotzdem kennt Teresa natürlich die Gefahr der Täuschung, weshalb sie ihre Schwestern ermutigt, ihre Erfahrungen mit dem Beichtvater, heute würde man besser sagen, mit dem geistlichen Begleiter, zu besprechen: „In allem braucht es Erfahrung und einen Lehrmeister, denn wenn die Seele bis zu diesen Grenzen gelangt ist, werden ihr viele Dinge begegnen, über die sie sich mit jemanden besprechen sollte.“10 Es braucht auch die kritische und kluge Reflexion der Erfahrung:
So ist es sehr wichtig, dass der Lehrmeister gescheit sei – ich meine, mit gutem Urteilsvermögen – und dass er Erfahrung habe. Wenn er dazu noch studiert ist, dann ist das ein glänzendes Geschäft. Wenn man aber diese drei Voraussetzungen nicht zusammen finden kann, sind die beiden ersten wichtiger, denn Studierte kann man sich immer noch holen, um sich mit ihnen auszutauschen, wenn man das brauchen sollte. Ich meine nur, dass an den Anfängen theologische Bildung wenig nützt, wenn sie kein inneres Beten halten. Ich will nicht sagen, daß sie sich mit Studierten nicht besprechen sollten, denn einen Geist, der sich nicht von Anfang an auf die Wahrheit stützt, hätte ich lieber ohne inneres Beten. Und es ist etwas Großes um die theologische Bildung, denn diese belehrt uns, die wir nicht viel wissen, und spendet uns Licht, und wenn wir dann zu den Wahrheiten der Heiligen Schrift gelangt sind, tun wir, was wir sollen. Vor unerleuchteter Frömmigkeit bewahre uns Gott!11
Teresa selbst formuliert Kriterien der Unterscheidung, die sie zum Teil sicher aus der geistlichen Tradition bezieht wie z.B. ihre Lektüreempfehlungen12 für die Schwestern zeigen, die aber immer auch mit ihrer eigenen Praxis und Erfahrung verknüpft sind und ihre Handschrift tragen.
Nach allem, was ich sehe und aus Erfahrung weiß, ist nämlich nur glaubwürdig, daß es von Gott stammt, wenn es mit der Heiligen Schrift übereinstimmt, doch sobald es auch nur ein bißchen davon abweicht, dann hätte ich, glaube ich, eine unvergleichlich größere Gewißheit, daß es vom Bösen stammt, als ich sie jetzt habe, daß es von Gott stammt, wie groß ich diese auch haben mag. Dann braucht man nämlich nicht mehr nach Anzeichen zu suchen oder wessen Geist es ist, weil dies ein ganz klares Zeichen ist, um zu glauben, daß es vom Bösen stammt. Wenn mir dann die ganze Welt versicherte, daß es von Gott stammt, würde ich es nicht glauben.13
In der Tradition der Unterscheidung der Geister gilt: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ (Mt 7,16) Früchte des Geistes sind in erster Linie Gottes- und Nächstenliebe. So heißt es in Teresas Wohnungen der inneren Burg: „Das sicherste Zeichen, ob wir diese beiden Dinge halten, ist meines Erachtens die treue Einhaltung der Nächstenliebe, denn ob wir Gott lieben, kann man nie wissen (auch wenn es deutliche Anzeichen gibt, um zu erkennen, ob wir ihn lieben), die Liebe zum Nächsten erkennt man aber sehr wohl.“ 14
An etwas späterer Stelle im selben Werk verknüpft sie das Bemühen um die Einübung der Tugenden mit dem Kriterium des Wachstums:
Ich sage noch einmal, dass es dazu notwendig ist, euer Fundament nicht nur mit Beten und Kontemplation zu legen, denn wenn ihr euch nicht um Tugenden bemüht und sie nicht immer wieder einübt, werdet ihr Zwerginnen bleiben. Und gebe Gott, dass es nur daran liegt, dass ihr nicht wachst, denn ihr wisst bereits, dass abnimmt, wer nicht zunimmt. Ich halte es jedenfalls für unmöglich, dass die Liebe, wo es sie denn gibt, sich damit begnügt, auf der Stelle zu treten.15
Die Liebe ist der Motor des Wachstums und sie zeigt sich vor allem als Nächstenliebe im Vehalten, dem Anderen gegenüber.
„Dazu ist das innere Beten da, meine Töchter, dazu dient diese geistliche Vermählung, dass ihr immerfort Werke entsprießen, Werke!“ 16
Klingt das nicht sehr nach der „Werkerei“, die die Reformatoren gerade zur Zeit Teresas der kirchlichen Lehre vorwarfen? Geht es nicht wieder darum, sich den Himmel zu verdienen? Ganz im Gegenteil. Die Werke werden nicht geleistet zu irgendeinem Zweck oder um sich etwas zu verdienen, sondern die Werke entspringen der Gottesbeziehung. Weil der Mensch sich als so geliebt von Gott erfährt, kann er gar nicht anders als diese Liebe weiterzugeben in Übung der Tugenden und in Werken. Nicht umsonst sind die Zitate den „Siebten Wohnungen“ der Inneren Burg Teresas entnommen, d.h. dem innersten Zentrum, in dem die Vereinigung mit Gott erfolgt. Wenn sich der Mensch wirklich von diesem allmächtigen Gott als geliebt erfährt, dann können alle ‚Gotteskomplexe‘ wegfallen, dann braucht er nicht zu beweisen, dass er jemand ist, dass er etwas vermag. Der Mensch hat dann zutiefst verstanden, dass der Himmel nicht verdient werden kann, dass er ihm aber von einem liebenden Gott geschenkt wird. Und aus dieser Überzeugung entsteht die Gelassenheit und die Freiheit der Kinder Gottes, die Freiheit zum unverkrampften Einsatz für die Menschen und zur absichtslosen, nicht ausbeuterischen Liebe des Nächsten.
Ein geistliches Erleben an sich zu beurteilen ist nicht möglich, weil es nicht wirklich kommuniziert werden kann. Deshalb hat die spirituelle Tradition immer nur Folgen der geistlichen Erfahrung, die eben schon zitierten „Früchte“, in den Blick genommen. Teresa von Ávila treibt das Kriterium gleichsam auf die Spitze, wenn sie bezüglich einer Vision konstatiert:
Ob eine Vision gut oder schlecht ist, liegt ja nicht an ihr selbst, sondern an dem, der sie sieht und sie sich mit Demut zunutze macht oder nicht. Wenn Demut vorhanden ist, wird keine Vision schaden, auch wenn sie vom Teufel stammt, wenn aber keine Demut vorhanden ist, wird sie auch keinen Nutzen bringen, selbst wenn sie von Gott ist. Wenn nämlich das, was einen demütig machen muss – aus der Gewissheit, dass man diese Gnade nicht verdient, einen hochmütig werden lässt, dann ist man wie die Spinne, die alles, was sie frisst, in Gift verwandelt, im Gegensatz zur Biene, die alles zu Honig macht.17
Das bedeutet, dass für Teresa das unterscheidende Kriterium die Haltung der Person ist, mit der sie der Erfahrung begegnet, wie sie damit umgeht. Letztlich ist es dann zweitrangig, vielleicht sogar egal, woher die Erfahrung kommt, allein entscheidend ist, welche Folgen sie zeitigt und welche Früchte sie hervorbringt. Teresa vertritt damit einen sehr radikalen Ansatz in Bezug auf die Bedeutung der Früchte für die kritische Betrachtung geistlicher Erfahrungen.
Einen weiteren Gegenstand für Unterscheidungen bildet die sehr geschätzte „Gabe der Tränen“, d.h. dass Menschen beim Gebet, bei der Betrachtung, in geistlichen und/oder liturgischen Vollzügen zu Tränen gerührt werden.18 Teresa stellt hierzu in ihrer Lebensbeschreibung sowie in einem Brief an ihren engen Vertrauten Pater Hieronymus Gracián fest:
Die Liebe zu Gott besteht nicht darin, die Gabe der Tränen zu haben oder diese Wohlgefühle und dieses zärtliche Gefühl, was wir uns doch meistens herbei wünschen und womit wir uns trösten, sondern darin, ihm in Gerechtigkeit, Starkmut und Demut zu dienen.19
[…] doch soll man nicht meinen, dass nicht betet, wer leidet, wo er es doch Gott immer wieder hinhält, ja oft betet der viel mehr als einer, der sich allein den Kopf zerbricht und dann meint, Inneres Beten sei, wenn er sich ein paar Tränen herausgepresst hat.20
Geistliche Tränen sind nach Meinung der geistlichen Tradition meist gut, aber nicht heilsnotwendig. Tränen bedürfen der Unterscheidung, sie sind ambivalent und dürfen nicht als Auszeichnung besonderer Frömmigkeit oder als Beweis der Erhörung missverstanden werden. Sie müssen kritisch betrachtet werden hinsichtlich ihres Ursprungs, der Umstände ihres Auftretens, der damit verbundenen Motive, der Verfassung des Menschen und seiner eventuellen aktiven Beteiligung an ihrem Auftreten. Schließlich stellt sich auch hier die klassische Frage nach den Folgen der Tränen, die zu betrachten und zu unterscheiden sind, nicht die Tränen selbst.
Im Weg der Vollkommenheit möchte Teresa zur oben skizzierten kritischen Haltung auch ihre Schwestern ermuntern, besonders gegenüber Personen – es sind wohl meist Kleriker gemeint – die die Schwestern zu beeinflussen suchen, diese subsummiert sie sogar unter dem Begriff des ‚Bösen‘, womit gewöhnlich der Teufel gemeint ist. Für Teresa zeigte sich dieser allerdings sehr konkret in falschen und manipulativen Absichten.
Hütet euch also, Töchter, vor manchen Demutsempfindungen, die euch der Böse in Form von großer Unruhe über die Schwere vergangener Sünden einflüstert: ‚Ob ich es wohl verdiene, mich dem Sakramente zu nähern?‘ ‚Ob ich mich wohl richtig vorbereitet habe?‘ ‚Ich tauge nicht, um unter guten Menschen zu leben‘ – so ähnliche Gedanken, die man durchaus schätzen soll, wenn sie mit innerer Ruhe und Wonne und dem guten Gefühl verbunden sind, die die Selbsterkenntnis mit sich bringt. Wenn sie aber mit Verwirrung und Unruhe und seelischer Bedrängnis und der Unfähigkeit zur Beruhigung der Gedanken verbunden sind, dann glaubt, dass es eine Versuchung ist, und haltet euch nicht für demütig, denn das kommt nicht davon.21
Die Selbstzweifel und Selbstkritik entspringen nicht einem Prozess kritischer Selbsterkenntnis, sondern werden von aussen eingegeben. Zweifel werden gesät wo es eigentlich nichts zu bezweifeln gibt. Teresa selbst nimmt diese kritische Haltung ein, wenn sie sich grundsätzlich bei Gott über die Stellung der Frauen in der Kirche und den in ihrer Zeit üblichen Umgang mit ihnen beschwert:
Du, Herr meiner Seele, dir hat vor den Frauen nicht gegraut, als du durch diese Welt zogst, im Gegenteil, du hast sie immer mit großem Mitgefühl bevorzugt und hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern, denn es war da deine heiligste Mutter, durch deren Verdienste – und weil wir ihr Gewand tragen – wir das verdienen, was wir wegen unserer Schuld nicht verdient haben. Reicht es denn nicht, Herr, dass die Welt uns eingepfercht und für unfähig hält, in der Öffentlichkeit auch nur irgend etwas für dich zu tun, was etwas wert wäre, oder es nur zu wagen, ein paar Wahrheiten auszusprechen, über die wir im Verborgenen weinen, als dass du eine so gerechte Bitte von uns nicht erhörtest? Das glaube ich nicht, Herr, bei deiner Güte und Gerechtigkeit, denn du bist ein gerechter Richter, und nicht wie die Richter dieser Welt, für die, da sie Söhne Adams und schließlich lauter Männer sind, es keine Tugend einer Frau gibt, die sie nicht für verdächtig halten. O ja, mein König, einmal muss es doch den Tag geben, an dem man alle erkennt. Ich spreche nicht für mich, denn meine Erbärmlichkeit hat die Welt schon erkannt, und ich bin froh, dass sie bekannt ist, sondern weil ich die Zeiten so sehe, dass es keinen Grund gibt, mutige und starke Seelen zu übergehen, und seien es Frauen (nur weil es Frauen sind). 22
Kein Wunder, dass dieser Text der Zensur zum Opfer fiel und in der 2. Fassung des Weges der Vollkommenheit (Handschrift von Valladolid) ganz fehlt.
Bei ihren Überlegungen zur Gründungstätigkeit erhält Teresa Unterstützung von Christus selbst:
Als ich einige Tage nach dem, was ich gerade sage, darüber nachdachte, ob die wohl Recht haben, denen es schlecht erscheint, dass ich zum Gründen hinausgehe, und ob es nicht besser sei, wenn ich mich immer dem Beten hingäbe, verstand ich: Solange man lebt, liegt der Gewinn nicht darin, sich mehr Genuss an mir zu verschaffen, sondern meinen Willen zu erfüllen. Mir schien dann, dass wohl das der Wille Gottes sei, was der hl. Paulus über die Zurückgezogenheit der Frauen sagt (Tit 2,5) – was man mir vor kurzem gesagt hatte und ich auch früher schon gehört hatte. Da sagte er mir: Sag ihnen, dass sie nicht nur auf einem Text der Schrift herumreiten, sondern auch andere anschauen sollen, und ob sie mir denn die Hände binden könnten.23
Teresas Reisen in Spanien, um neue Klöster zu gründen, war jahrelang Anlass zu heftigem Widerspruch, da man darin einen Verstoß gegen die strengen Klausurgesetze des Konzils von Trient sah.24 Teresa trifft im eben zitierten Text eine kluge Entscheidung. Sich auf eine sachliche Diskussion einzulassen – die sie als Frau verlieren müsste – wäre unklug, so verteidigt sie sich mit dem Hinweis auf den Willen Gottes. Mit dieser Antwort, die in einer sakralisierten Gesellschaft noch viel mehr Bedeutung und Gewicht hatte als heutzutage, sagt Christus (oder lässt Teresa Christus sagen), was sie als Frau nicht sagen darf, aber sehr wohl denkt.25 Christus ist der Herr seiner Kirche und deshalb lässt er sich von deren Vertretern nichts verbieten, nicht die Hände binden. Interessant ist der moderne Umgang mit der Schrift, den sie pflegt bzw. den ihr Christus empfiehlt, nämlich die Worte der Schrift nicht isoliert, sondern im Kontext der ganzen Schrift zu betrachten.
Teresa ist auch klug bezüglich ihrer Schriften. Sie legt sich nicht eindeutig fest, um im Falle eines Verhörs durch die Inquisition einen ‚Interpretationsspielraum‘ zu haben. Mit ironischem Unterton schreibt sie, wie sie mögliche Unsicherheiten bezüglich der Unterscheidung der Geister rhetorisch artikuliert:
Bei schwierigen Dingen benutze ich, auch wenn ich etwas zu verstehen meine und die Wahrheit sage, immer den Ausdruck „meines Erachtens“, denn falls ich mich irren sollte, bin ich gerne bereit zu glauben, was von sehr studierten Leuten gesagt wird. Denn mögen sie diese Dinge auch nicht selbst erlebt haben, so ist großen Gelehrten doch so ein „Ich-weiß-nicht-was“ zu eigen; denn da Gott sie als Licht für seine Kirche hat, gibt er ihnen dieses, sofern es sich um eine Wahrheit handelt, damit diese anerkannt wird.26
Das nicht sicher von Teresa stammende, ihr jedoch immer zugeschriebene Gedicht „Nada te turbe“ 27 spitzt die Fragestellung der Unterscheidung der Geister noch einmal zu:
| Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa, Dios no se muda. La pacientia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada la falta: solo Dios basta. | Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Alles vergeht, Gott ändert sich nicht. Die Geduld erlangt alles. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott nur genügt. |
„Solo Dios basta“ – Allein Gott oder Gott nur genügt. Nichts kann an die Stelle Gottes treten, nichts kann die letzte Sehnsucht des Menschen stillen als Gott allein, weshalb alle Güter, alle Menschen, alle Beziehungen der Menschen, unter diesem Vorbehalt stehen, sie bleiben nicht, sie vergehen, der einzige, der bleibt, ist allein Gott.
Teresa hat nicht Theologie studiert und kommt trotzdem durch Lektüre geistlich-theologischer Werke, durch regelmäßigen Austausch mit führenden Theologen ihrer Zeit sowie durch ihre eigene reflektierte Erfahrung und ihre Fähigkeit zu kritischem Denken zu Kriterien der Unterscheidung der Geister, die ihr eine theologische Reflexion ermöglichen. Ob Lebensgestaltung, geistliches Leben, mystische Erfahrung, Struktur ihrer neu gegründeten Gemeinschaften, ihr Umgang mit den Schwestern, ihr Umgang mit kleinen und großen Autoritäten, ihre Strategie bei der Gründung ihrer Konvente – alles entspringt einer kritisch reflektierenden Betrachtung der Dinge vor dem Hintergrund ihrer engen und freundschaftlichen Gottesbeziehung und ist gerade auch deshalb als wirkliche Unterscheidung der Geister zu beschreiben. Diese ist nämlich nicht einfach ein rationales Abwägen von Argumenten, sondern ein im Herzen angesiedelter Prozess des Erwägens, in den rationale, aber auch emotionale und intuitive Erkenntnisse einfließen und der immer eingebettet ist und bleibt in den lebendigen Dialog mit Gott. Diesen beschreibt Teresa klassisch in ihrer Vida: „Denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.“ 28