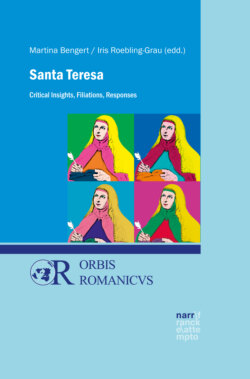Читать книгу Santa Teresa - Группа авторов - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Bedeutung Teresas von Ávila für Edith Stein
ОглавлениеDie Wirkungsgeschichte der Werke Teresas ist vielfältig und international, sie reicht mit großer Lebendigkeit bis in unsere Tage. Teresa hatte bis zu ihrem Tod am 4. Oktober 1582 bereits 16 Frauenklöster ihrer Reform in Spanien gegründet und sehr schnell entstanden Klöster in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Ihre Werke wurden bereits 1588 von Luis de León herausgegeben und zügig in andere Sprachen übersetzt. Aus dieser Wirkungsgeschichte und in Bezug auf das Thema der Unterscheidung der Geister soll eine für Deutschland und die jüngere deutsche Geschichte wichtige Karmelitin ausgewählt werden, Edith Stein bzw. Sr. Teresia Benedicta a Cruce wie sie mit ihrem Ordensnamen hieß. Zunächst ein sehr kurzer biographischer Abriss zur Einordnung: 1
Am 12.10.1891, dem jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur, wurde Edith Stein in Breslau geboren. Sie wuchs in ihrer jüdischen Familie auf und bekannte sich zum Judentum. 1911 macht sie Abitur und studiert zuerst in Breslau Germanistik und Geschichte und dann ab 1913 in Göttingen zusätzlich Philosophie und Psychologie. In dieser Zeit verliert sie ihren Glauben und bezeichnet sich rückblickend als Atheistin. 1915 Staatsexamen und freiwilliger Rot-Kreuz-Dienst im Seuchenlazarett in Mährisch-Weißkirchen. Im folgenden Jahr wird Edith Stein Assistentin bei Edmund Husserl an der Universität Freiburg, bei dem sie auch zum Dr. phil. promoviert wird (Thema: „Zum Problem der Einfühlung“). Ab 1918 arbeitet Dr. Stein wissenschaftlich weiter und versucht bis 1932 insgesamt vier Mal vergeblich zur Habilitation an einer deutschen Universität zugelassen zu werden. Was sich in den Jahren ihrer Promotion und ihrer wissenschaftlichen Arbeit, nicht zuletzt durch Begegnungen mit gläubigen Kolleginnen und Kollegen anbahnte und immer mehr verdichtete kommt 1921 nach der Lektüre der Autobiographie Teresas von Ávila zum Durchbruch. Edith Stein wird am 1.1.1922 in Bergzabern getauft. Von 1923 bis 1931 arbeitet sie als Lehrerin am Lyzeum und der Lehrerinnenbildungsanstalt St. Magdalena in Speyer.
1932 bis 1933 ist sie Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Dieses eine Jahr in Münster ist für Edith Stein entscheidend, denn sie muss erfahren, dass ihre Lehrtätigkeit aufgrund ihrer jüdischen Abstammung zunehmend eingeschränkt und schließlich im April 1933 verboten wird. Diese Entwicklung führt dazu, dass ihr Wunsch, Karmelitin zu werden, den sie seit ihrer Taufe hegte, nun neue Aktualität gewinnt. Nach Gesprächen mit ihrem Begleiter Erzabt Walzer von Beuron ringt sie mit Gott in der Ludgerikirche in Münster um die richtige Entscheidung: „Am 30. April, es war der Sonntag vom Guten Hirten, wurde in der Ludgerikirche das Fest des hl. Ludgerus mit 13stündigem Gebet gefeiert. Am späten Nachmittag ging ich dorthin und sagte mir: ich gehe nicht wieder fort, ehe ich Klarheit habe, ob ich jetzt in den Karmel gehen darf. Als der Schlusssegen gegeben war, hatte ich das Jawort des Guten Hirten.“2
Schließlich tritt Edith Stein am 14. Oktober 1933 in den Kölner Karmel ein, wird am 15.4.1934 eingekleidet und erhält den Namen Schwester Teresia Benedicta a Cruce („Teresia vom Kreuz gesegnete“). Dieser Name sollte sich auf grausame Weise erfüllen. Wegen zunehmender antijüdischer Hetze übersiedelt Edith Stein an Sylvester 1938 in den Karmel von Echt in den Niederlanden. Als Racheakt für ein Wort der Holländischen Bischöfe gegen die Nationalsozialisten werden in den Niederlanden mehrere getaufte Juden, vornehmlich Ordensleute, am 2.8.1942 von der Gestapo verhaftet und im Sammellager Westerbork interniert, unter ihnen Edith Stein und ihre Schwester Rosa. Einige Tage später erfolgt der Transport nach Auschwitz, wo sie am 9.8.1942 in der Gaskammer getötet wird. Am 1.5.1987 wird sie durch Papst Johannes Paul II. selig und am 11.10.1998 heiliggesprochen.
Die autobiographischen Aufzeichnungen unter dem Titel Aus dem Leben einer jüdischen Familie3 hat Edith Stein nicht vollenden können, es gibt jedoch einen kurzen Bericht von ihrer Hand, der die Vorgeschichte ihres Eintritts in den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen schildert mit dem Titel: „Ein Beitrag zur Chronik des Kölner Karmel – Wie ich in den Kölner Karmel kam.“ Den Text hat Edith Stein am 4. Adventssonntag 1938 in Köln verfasst. Es ist ein geistliches und ein zeitgeschichtliches Dokument. Es gibt persönliche Einblicke in die dunkelste Epoche deutscher Geschichte und gleichzeitig gibt es Zeugnis von einem Menschen, der konsequent seiner erkannten Berufung folgt. Es ist ein Text voll geistlicher Klarheit und voll Frieden inmitten einer immer bedrohlicher werdenden gesellschaftlichen und politischen Situation. Dabei entsteht nicht der Eindruck von Weltflucht. Edith Stein ist sich der Situation und ihrer Bedeutung bewusst, sie schreibt diesen Text knapp zwei Wochen bevor sie nach Echt flüchten muss und nach den Pogromen der Reichskristallnacht (9./10.11.1938).
Die Autobiographie Teresas von Ávila, ihre Vida, wird für Edith Stein auf der Suche nach ihrem Weg höchst bedeutsam und führt sie zu einer Lebensentscheidung. In ihrem Suchen nach dem wahren Glauben unterscheidet Edith Stein zwei Wegstrecken: Das Christentum war ihr nahe gekommen durch die Begegnung mit der befreundeten Protestantin Anne Reinach und ihrem Umgang mit dem Tod ihres Mannes im ersten Weltkrieg. Das war im Frühjahr 1918. In einem Brief an Roman Ingarden schreibt sie am 10.10.1918:
Ich weiß nicht, ob Sie es aus früheren Äußerungen schon entnommen haben, dass ich mich mehr und mehr zu einem durchaus positiven Christentum durchgerungen habe. Das hat mich von dem Leben befreit, das mich niedergeworfen hatte und hat mir zugleich die Kraft gegeben, das Leben aufs neue und dankbar wieder aufzunehmen. Von einer ‚Wiedergeburt‘ kann ich also in einem tiefen Sinne sprechen.4
Die zweite Wegstrecke betrifft ihr Ringen um die konfessionelle Zugehörigkeit, sie besucht evangelische und katholische Gottesdienste und hat Kontakt zu Personen beider Konfessionen. Die Entscheidung nicht nur für die katholische Kirche, sondern für den Eintritt in ein Karmelitinnenkloster, fällt nach der Lektüre der Vida Teresas in einer Nacht. Dabei ging es wie oft in der Unterscheidung der Geister nicht um eine Entscheidung zwischen gut oder schlecht: Edith Stein hatte sehr gute Erfahrungen mit protestantischen Christen gemacht, sondern es ging um die Entscheidung für den jetzt – für sie und nicht allgemeingültig – richtigen Schritt in ihrer Glaubens- und Lebensentwicklung. Natürlich gingen dieser Nacht, die ihr Leben umkrempelte, zahllose kleine Schritte, Bemühungen, Überlegungen, Auseinandersetzungen etc. voraus und doch war das Buch Teresas entscheidend. Edith Stein schreibt selbst darüber:
Seit fast 12 Jahren war der Karmel mein Ziel. Seit mir im Sommer 1921 das Leben unserer hl. Mutter Teresia in die Hände gefallen war und meinem langen Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende gemacht hatte. Als ich am Neujahrstage 1922 die hl. Taufe empfing, dachte ich, daß dies nur die Vorbereitung zum Eintritt in den Orden sei. […] Ich mußte in Geduld warten. So wurde mir auch von meinen geistlichen Beratern immer wieder versichert. Das Warten war mir zuletzt sehr hart geworden. Ich war ein Fremdling in der Welt geworden. Ehe ich die Tätigkeit in Münster übernahm und nach dem ersten Semester hatte ich dringend um die Erlaubnis zum Eintritt in den Orden gebeten. Sie wurde mir verweigert mit dem Hinweis auf meine Mutter und auch auf die Wirksamkeit, die ich seit einigen Jahren im katholischen Leben hatte. Ich hatte mich gefügt.5
Nach dem Eintritt ins Kölner Karmelitinnenkloster 1933 verfasst Edith Stein weiter bedeutende philosophische und theologische Abhandlungen, darunter auch kleinere Schriften zu besonderen Anlässen oder Gestalten. Interessant ist in diesem Kontext ihre kleine Schrift zu Teresa von Ávila, die Edith Stein im Februar 1934 in Köln verfasst hat. Im Vorwort schreibt sie:
In unserer Zeit, in der sich die Ohnmacht aller natürlichen Mittel zur Bekämpfung des alle Länder niederdrückenden Elends so sichtbar erwiesen hat, ist wieder ein ganz neues Verständnis für die Kraft des Gebetes, der Sühne und der stellvertretenden Genugtuung erwacht. Daher der Zudrang des gläubigen Volkes zu den Stätten des Gebetes, daher auch das allenthalben aufflammende Verlangen nach beschaulichen Klöstern, deren ganzes Leben dem Gebet und der Sühne gewidmet ist. So wird auch von dem stillen Karmel, der noch vor einigen Jahren ein nur wenigen bekanntes Land war, auf einmal an allen Ecken und Enden gesprochen. In den verschiedensten Landesteilen ist der Wunsch nach Neugründungen aufgetaucht. Man fühlt sich fast zurückversetzt in die Zeit, da unsere heilige Mutter Theresia, die Stifterin des reformierten Karmel, Spanien von Norden nach Süden und von Westen nach Osten durchzog, um neue Weinberge des Herrn zu pflanzen. Man möchte etwas vom Geist dieser großen Frau, die in einem Jahrhundert der Kämpfe und Wirren eine wunderbare Aufbauarbeit geleistet hat, auch in unsere Zeit hineintragen. Möge sie selbst ihren Segen dazu geben, daß dieses kleine Bild ihres Lebens und Wirkens wenigstens einige Strahlen ihres Geistes aufnehmen könne und in die Herzen der Leser hineintrage; dann würde wohl der Wunsch erwachen, sie aus den Quellen – aus dem reichen Schatze ihrer eigenen Werke – näher kennen zu lernen; und wer erst einmal gelernt hat, aus diesen Quellen zu schöpfen, der wird nicht müde werden, sich immer wieder Mut und Kraft daraus zu holen.6
Gerade im letzten Satz scheint Edith Steins eigene Erfahrung mit Teresas Schriften durch. Am Ende der kleinen Schrift unterstreicht Edith Stein noch einmal die Bedeutung Teresas:
Ludwig von Leon hat von Theresia gesagt: ‚Ich habe die Heilige zu ihren Lebzeiten weder gesehen noch gekannt. Heute aber, wiewohl sie im Himmel ist, kenne ich sie und sehe ich sie in ihren zwei lebendigen Abbildern, ich meine ihre Töchter und ihre Schriften. […]“ In der Tat gibt es wenige Heilige, die uns menschlich so nahe kommen wie unsere heilige Mutter. Die Schriften, die sie auf Befehl ihrer Beichtväter im Gehorsam mitten zwischen all ihren Lasten und Arbeiten niederschrieb, wie sie ihr in die Feder kamen, gelten als klassische Meisterwerke der spanischen Literatur. In einer unvergleichlich klaren, schlichten und wahrhaftigen Sprache berichten sie von den Wundern der Gnade, die Gott in einer auserlesenen Seele gewirkt hat, erzählen von dem unermüdlichen Wirken einer männlich kühnen und starken Frau, enthüllen die natürliche Klugheit und himmlische Weisheit, die tiefe Menschenkenntnis und den urwüchsigen Humor eines reichen Geistes, die unendliche Liebesfülle eines bräutlich-zarten und mütterlich-gütigen Herzens. In der großen Ordensfamilie, die sie begründet hat, schauen alle, denen die übergroße Gnade geschenkt wurde, ihre Söhne und Töchter zu heißen, mit dankbarer Liebe zu ihrer heiligen Mutter empor und kennen kein anderes Verlangen als von ihrem Geist erfüllt zu werden, an ihrer Hand den Weg der Vollkommenheit bis ans Ziel zu wandeln.7
Der Weg Edith Steins vollendete sich in den Grauen des KZs Auschwitz-Birkenau. Teresa von Ávila blieb ihr beständige Wegbegleiterin bis dahin. In unterschiedlichen Situationen ihres Lebens half ihr das Vorbild der heiligen Spanierin, Entscheidungen zu treffen, Orientierung zu finden, zu unterscheiden und ihren Weg zu finden.