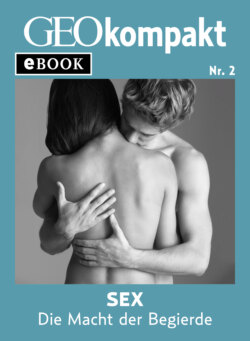Читать книгу Sex: Die Macht der Begierde (GEOkompakt eBook) - Группа авторов - Страница 8
Von Ralf Berhorst
ОглавлениеDie Anstrengungen, die Tiere auf sich nehmen, um Sex zu haben, sind erstaunlich. Zu Frühjahrsbeginn füllt sich beispielsweise die Prärie im US-Bundesstaat Wyoming mit Hunderten Beifußhühnern. Die Männchen beginnen schon bald zu tänzeln, spreizen ihre Schwanzfedern zum Fächer, rasseln mit den Halsfedern und pumpen den Luftsack an Hals und Brust auf, aus dem sie dann die Luft mit einem Knall entweichen lassen. Tagelang präsentieren sie sich auf diese Weise den paarungsbereiten Weibchen, bis die sich endlich jeweils für einen von ihnen bevorzugten Tänzer entscheiden.
Oder Danaus gilippus, ein rotbrauner Edelfalter, ebenfalls aus Amerika. Er stülpt zur Werbung Haarpinsel an seinem Hinterleib aus, die Lockstoffe verströmen. Dann flattert er vor einem Weibchen auf und ab und versucht dessen Fühler im Flug mit den betörenden Pheromonen zu bestreichen, um es für sich zu gewinnen.
Oder der Seidenlaubenvogel aus dem Osten Australiens. Er baut vor dem Sex eine kunstvolle Laube aus Farnen und Ästen, schmückt sie mit allerlei blauen Gegenständen, etwa Beeren, Blüten – aber auch mit Zivilisationsmüll wie blauen Strohhalmen, Kugelschreibern oder Batterienhülsen. Erst wenn er mit seinem Werk zufrieden ist, lässt der Vogel das Gebäude von dem begehrten Weibchen inspizieren.
Unermüdlich scheinen Eifer und Erfindungsreichtum, wenn es darum geht, einen Sexualpartner anzulocken. So suchen Nachtigallen durch ihre Gesangskunst und ein möglichst großes Repertoire an Melodien zu beeindrucken. Karibische Muschelkrebse erzeugen im Meer gezackte Lichtblitze. Und eine bestimmte Buntbarsch-Spezies schaufelt mit dem Maul eine Unterwasser-Sandburg auf, die die eigene Körperlänge um ein Mehrfaches übertrifft.
Kommt es nach all diesen Anstrengungen dann endlich zum ersehnten Akt, verausgaben sich viele Arten dabei bis zur völligen Erschöpfung.
Männliche Stabschrecken etwa halten sich bis zu zehn Wochen lang auf dem Rücken des größeren Weibchens fest, damit Rivalen nicht zum Zuge kommen.
Das Staffelschwanz-Männchen, ein kaum faustgroßer australischer Singvogel, verliert bei einem einzigen Paarungsakt acht Milliarden Spermien.
Habichte und Fischadler paaren sich mehr als 100-mal mit einem einzigen Weibchen, um den Samen möglicher Nebenbuhler aus dem Feld zu schlagen.
Viele Nagetiere versiegeln nach der Begattung die Geschlechtsöffnung des Weibchens vorsorglich mit einem Drüsensekret, das aushärtet und wie ein Keuschheitspfropf wirkt.
Und um ganz sicherzugehen, klammern sich männliche Libellen nach der Begattung so lange auf dem Weibchen fest, bis es mit dem Eierlegen beginnt. Erst dann ist der Sexualakt für sie vorbei.
Angesichts dieses enormen Aufwands, den viele Arten für die Fortpflanzung betreiben, rätseln Evolutionsbiologen seit Jahrzehnten über die Frage: Warum überhaupt hat die Natur eine so kräftezehrende Vermehrungsmethode wie die Sexualität „erfunden“? Und: Was genau ist Sex?
Zumindest über die Antwort auf die zweite Frage herrscht heutzutage weitgehend Einigkeit: Es handelt sich beim Sex um die Übertragung von Erbgut von einem Individuum auf ein anderes – mehr nicht. Gleichgültig, ob nun Insekten miteinander kopulieren, Würmer, Vögel oder Menschen.
Alles andere ist nur Beiwerk: die Lust und die Liebe, die Eifersucht und die Raserei, die langwierigen Rituale davor, die Erschöpfung danach.
Am Ende zielen diese Anstrengungen stets auf nichts anderes als einen Prozess, den das menschliche Auge allenfalls unter dem Mikroskop beobachten kann: Sex führt zur Verschmelzung der DNS zweier Lebewesen – zur Kombination jener Erbinformationen also, die im Kern fast jeder Körperzelle gespeichert sind und sämtliche Lebensprozesse steuern. Beim Menschen sind diese Erbinformationen auf 23 Chromosomen (oder DNS-Stränge) verteilt.
Von jedem Chromosom existiert eine zweite Variante. So haben menschliche Körperzellen nicht nur 23, sondern 46 Chromosomen. Kommt es zu einer Beschädigung des einen Datenspeichers, kann die Zelle auf die Variante zurückgreifen.
Dies ist eine Überlebensversicherung – aber auch ein gravierendes Problem: Denn würden zwei normale menschliche Körperzellen mit ihren 46 Chromosomen verschmelzen, entstünde logischerweise ein Embryo mit 92, in der nächsten Generation sogar einer mit 184 Chromosomen und so fort.
Irgendwann würde der Zellkern vor lauter DNS platzen.
Bevor daher in Hoden oder Eierstöcken Keimzellen gebildet werden, sorgt ein mehrstufiger Prozess für eine Halbierung des doppelten Chromosomensatzes. Das Ergebnis sind Zellen ohne Sicherheitskopien: weibliche Eizellen und männliche Spermien mit je 23 Chromosomen.
Verschmelzen die beim Sex miteinander, stimmt die Rechnung wieder: Es entsteht eine befruchtete Zelle mit 46 DNS-Fäden, aus der dann der Embryo wachsen kann. Jedes Kind erbt also eine Hälfte seiner Erbinformationen von der Mutter, die andere vom Vater.
Für Verliebte mag diese Form der Verschmelzung eine romantische Wunschvorstellung erfüllen. Aus emotionsfreier biologischer Sicht aber scheint sie den Sex mit einem erheblichen Nachteil zu belasten: Mütter und Väter geben nur die Hälfte ihres eigenen Erbguts weiter. In der Enkel-Generation lebt also nur noch ein Viertel der eigenen Gene fort.
Ein preußischer Untertan, der um 1700 Kinder zeugte, hätte zehn Generationen später mit seinen heute lebenden Nachfahren weniger als ein Tausendstel seiner eigenen DNS gemein.
Subjektiv mag ein Mensch zwar das Gefühl haben, in seinen späten Nachfahren fortzuleben – aber er teilt diese Verwandtschaft mit Abertausenden seiner Zeitgenossen. So ist jede Ahnentafel eigentlich das Schaubild einer genetischen Verlustbilanz.
Es ist geradezu paradox: Genau betrachtet dient Sex eben nur sehr eingeschränkt der Fortpflanzung von etwas Eigenem. Vielmehr bewirkt die ständige Verschmelzung dessen Verdünnung und Verwässerung in immer homöopathischere Dosierungen – bis hin zum völligen Verschwinden.
Damit aber widerspricht der Sex scheinbar jenem Grundsatz der Evolutionstheorie, nach dem Lebewesen nur das eigene Erbgut fördern.
Denn in der Evolution waltet ein striktes Erfolgsprinzip: Jedes Individuum ist bestrebt, sich möglichst erfolgreich zu vermehren – die Selektion im Überlebenskampf ist geradezu definiert als direktes Ergebnis des eigenen Fortpflanzungserfolgs. Als Ergebnis der Weitergabe des eigenen Erbguts.
Der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins spricht sogar von „egoistischen Genen“. Demnach sind alle Organismen – ob nun Einzeller, Edelfalter oder Mensch – nichts anderes als „Behälter“ für DNS: Körperhüllen, in denen die Erbsubstanz „egoistisch“ danach trachtet, sich möglichst oft zu vervielfältigen und in neuen Körperhüllen weiterzuleben.
Genau das aber ist bei der sexuellen Vermehrung nur begrenzt der Fall. Umso rätselhafter erscheint es, weshalb die Verschmelzung als eine Variante der Fortpflanzung zweier Wesen einst überhaupt entstanden ist – und wieso sie nicht wieder verschwand.
Zumal die Natur zeigt, dass es auch ohne Sex geht – mit viel weniger Aufwand und der vollständigen Weitergabe des eigenen Erbguts.
Bei diesen Vermehrungs-Varianten geht nicht eine einzige Erbinformation der elterlichen DNS in der nächsten Generation verloren – eine ideale Lebenswelt also für „egoistische Gene“.
Es gibt drei Formen der nichtsexuellen Vermehrung:
1. Die Querteilung. Sie ist so alt wie das Leben selbst: Seit Jahrmilliarden verdoppeln Bakterien ihre Erbsubstanz und schnüren sich in der Mitte ein, bis schließlich zwei Zellen entstehen.
2. Die Knospung. Ein Teil des Mutter-Organismus schnürt sich ein, bis er abfällt. Aus diesem Körperfragment wächst ein neues Individuum heran.
Auch vielzellige Tiere vermehren sich durch Knospung: Im Süßwasser lebende Hydra-Polypen etwa bilden kleine Auswüchse an ihren Körpern, die alsbald davonschwimmen. Aus ihnen reifen kleine eigenständige Polypen heran. Mitunter verliert ein Seestern einen Arm, an dem mit der Zeit neue Arme wachsen, bis nach wenigen Wochen ein vollständiger neuer Seestern über den Meeresboden kriecht. Und Kartoffeln, Erdbeeren und viele andere Pflanzen vermögen Knospen und Stecklinge zu produzieren, aus denen neue Gewächse gedeihen.
3. Fragmentierung. Dabei zerfällt der gesamte Körper, etwa von Flechten oder Cyanobakterien, in Einzelteile. Aus jedem Fragment wächst wieder ein vollständiges Lebewesen.
Eine weitere Variante, bei der alle Gene weitergegeben werden, ist die Jungfernzeugung. Bei dieser – von Biologen „unisexuell“ genannten – Form der Fortpflanzung wächst aus einer unbefruchteten Eizelle im Leib des Muttertiers ein Tochterindividuum heran. Männliche Spermien sind für diesen Vorgang nicht notwendig, die keimfähigen Eizellen entwickeln sich auch mit einfachem Chromosomensatz.
Viele Insektenarten, Krebse, manche Fische, Eidechsen und zuweilen sogar Truthühner sind fähig, sich auf diese Weise zu vermehren.
All jene Spezies, die asexuelle oder unisexuelle Fortpflanzung betreiben, müssen für Partnersuche, Balz und Kopulation weder Zeit noch Energie aufwenden. Und dennoch gibt es kein einziges höheres Tier (wie Vogel, Schlange oder Säuger), das sich etwa durch Querteilung vermehrt. Und in der gesamten Natur sind nur rund 1000 Arten bekannt, die sich durch Jungfernzeugung fortpflanzen – im Vergleich zu Abermillionen Spezies, die Sex haben.
Trotz aller augenscheinlichen Nachteile muss also das Prinzip der sexuellen Verschmelzung den jeweiligen Spezies einen so großen Vorteil sichern, dass es sich bei fast allen heute existierenden Arten durchgesetzt hat.
Um eine Erklärung für das Mysterium Sex zu finden, richten Naturwissenschaftler ihren Blick tief in die Vergangenheit des Lebens.
Vor rund 1,5 Milliarden Jahren – so vermuten jedenfalls manche Forscher – gab es bereits eine Urform sexueller Begegnung.
Damals existierten nur Bakterien und Einzeller, die sich durch Querteilung und Knospung vermehrten. Manchmal aber, infolge eines evolutionären Zufalls, übertrug ein Bakterium einen Teil seines Erbguts auf ein anderes. Der Empfänger konnte auf diese Weise etwa ein beschädigtes Stück der eigenen DNS ersetzen oder an zusätzliche Erbinformationen gelangen.
Dazu bildete das Spender-Bakterium eine schlauchförmige Verbindung und schleuste DNS in die benachbarte Zelle. Das Empfänger-Bakterium baute die Erbinformationen in sein eigenes Erbgut ein. Es kam zu einer Verschmelzung.
Am Anfang hatte Sex also nichts mit Vermehrung zu tun, sondern: mit Reparatur.
Im Laufe der Entwicklungsgeschichte ging die Methode des DNS-Austausches auch auf andere Spezies über, etwa auf Pantoffeltierchen oder andere Einzeller mit Zellkern. Wie genau, das können sich die Forscher noch immer nicht erklären. Ganz offensichtlich aber war die Vereinigung von Anfang an ein Erfolgsrezept: Millionen Jahre später bildete sie die Grundlage aller drei großen Organismenreiche: der Pflanzen, Tiere und Pilze.
Denn während die Knospung nur identische Klone des „Muttertieres“ hervorbrachte, erschuf die sexuelle Verschmelzung von Erbinformationen immer neue DNS-Kombinationen. Die Durchmischung war so etwas wie eine Innovationsschmiede für das Erbgut einer Art.
Eine Revolution, die bis heute einen immensen Vorteil mit sich bringt.
Denn durch den Sex können sich Individuen leichter an Lebensbedingungen anpassen, die sich im Laufe von Jahrtausenden ja ständig ändern: Temperatur und Klima wandeln sich, die Evolution bringt neue Feinde hervor, Konkurrenten machen einer etablierten Art plötzlich Reviere streitig; neue Krankheiten bedrohen eine Spezies.
Viren etwa versuchen auf immer neuen Wegen in die Zellen eines Wirtsorganismus einzudringen und sich dort zu vermehren, Bakterien besiedeln Schleimhäute und andere Gewebe. Das jeweilige Abwehrsystem des Wirts versucht dann, die Eindringlinge zu erkennen und zu vernichten.
Bakterien vermehren sich aber extrem rasch – einige bringen es auf bis zu 50 Generationen pro Tag. Durch Sonnenlicht und chemische Prozesse treten bei ihnen manchmal zufällige Veränderungen des Erbguts auf; zwar kommt es nur bei einer von zehn Millionen Zellteilungen zu einer Mutation. Und doch: Bakterien vervielfältigen sich unter günstigen Bedingungen so rasant, dass an einem Tag Tausende Genmutanten entstehen.
Die Mutationen können nun durch Zufall bewirken, dass ein Bakterium das Immunsystem des Wirts austrickst. Indem es zum Beispiel eine andere Oberfläche ausbildet oder sich mit Schleim tarnt und so von den Abwehrzellen des Wirts nicht erkannt wird.
Wenn in einer solchen Situation alle Individuen einer Wirts-Art genetisch identisch sind, können neue aggressive Bakterien nach und nach die gesamte Spezies auslöschen. Denn die Wirte haben ja alle das gleiche Immunsystem und sind nicht mehr in der Lage, die trickreichen Krankheitserreger abzuwehren.
Sex dagegen bedeutet Varietät. Und die erhöht die Überlebenschancen: Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden immer ein paar Mitglieder einer Population neue Viren und Bakterien abwehren können – und so überleben.
Doch auch die Krankheitserreger verändern sich fortwährend. Es beginnt eine Art Wettkampf, der zu immer neuen Erbgut-Mischungen führt.
Heute gehen die meisten Biologen davon aus, dass genau dies das Erfolgsgeheimnis der sexuellen Vermehrung ist: Sie bietet einen größeren Abwehrschutz gegen Krankheitserreger – etwa Parasiten, die gefährlichsten Feinde der Menschen, Tiere und Pflanzen.
Der vermeintliche Nachteil ist also in Wahrheit ein Vorteil: Nur weil jedes Individuum beim Sex nicht mehr als die Hälfte seiner eigenen DNS preisgibt, ist die Durchmischung möglich.
Hier greift, ganz anders als von vielen Wissenschaftlern zunächst vermutet, eine Regel der Evolutionstheorie: das Überleben des Bestangepassten.
Unter den Bedingungen der natürlichen Selektion setzen sich nämlich immer jene Arten durch, die andere aus dem Feld schlagen. Die geschickter vor Feinden auszuweichen vermögen, sich damit schneller fortpflanzen und verbreiten, schneller wachsen.
So lässt sich auch begründen, wieso es exakt zwei Geschlechter gibt: weil es überaus effizient ist. Es wäre viel komplizierter, müssten für jede Befruchtung drei oder gar fünf verschiedene Keimzellen aus unterschiedlichen Organismen miteinander verschmelzen.
ENTSTANDEN IST DER UNTERSCHIED der Geschlechter vermutlich durch eine Art Arbeitsteilung beim Sex: In Vielzellern spezialisierten sich einige Zellen zu Keimzellen. Verschmolzen sie miteinander, entstand neues Leben.
Als das Prinzip der Zellverschmelzung erst einmal existierte, war es vorteilhaft, dass es zwei Sorten von Keimzellen gab: große Zellen (Eizellen) mit genügend Nährstoffreserven für den heranwachsenden Embryo sowie möglichst kleine Zellen (Spermien), die sich schnell bewegen, um die große Zelle zu erreichen und zu befruchten. Je kleiner die Spermien waren, desto weniger Energie verbrauchten sie bei ihrer Suche nach einer Eizelle.
Heute verteilen sich die Rollen „männlich“ und „weiblich“ aber nicht immer auf zwei verschiedene Wesen: In der Natur gibt es eine Vielzahl von Zwittern, so bei Schwämmen, bei Würmern und Egeln, Käferschnecken und Muscheln, Seepocken und einigen Fischen. Auch die meisten Blütenpflanzen sind doppelgeschlechtlich.
Nur wenige Zwitterwesen vermögen sich jedoch selbst zu befruchten. Die meisten gehen ganz klassisch – wie Männchen und Weibchen auch – auf Partnersuche.
Die karibischen Sägefische etwa treffen sich in der Dunkelheit und gesellen sich zu Paaren. Der eine krümmt dann seinen Leib, spreizt die Flossen und zittert mit ihnen. Der Partner schwimmt nach oben und stößt eine Spermienwolke aus. Der untere Fisch laicht Eier, die sich mit den herabsinkenden Spermien vermischen und nach der Befruchtung im Meer davontreiben.
Danach beginnt das Werben von vorn – diesmal mit vertauschten Geschlechterrollen.
Doch solch ein Doppelspiel ist aufwendig, es lohnt sich nur bei Arten, die etwa weit verstreut leben: Treffen sich zwei Individuen, kommt es in jedem Fall zur Fortpflanzung.
Vermutlich wegen der hohen Kosten hat die Evolution einen effizienteren Weg eingeschlagen und Spezialisten ausgebildet: Männchen und Weibchen. Die einen verlegten sich auf die Produktion von Spermien, die anderen steuerten die Eizellen bei.
Fortan waltete zwischen den Geschlechtern ein Auswahlprinzip, das schon Darwin auffiel: Fast immer sind es die Weibchen, die sich für ein werbendes Männchen entscheiden – nicht umgekehrt. Und: Die zukünftigen Muttertiere gehen bei der Wahl eines Partners sehr sorgfältig vor.
Moderne Forschungen bestätigen den Befund: Jenes Geschlecht, das den höheren Aufwand in die Aufzucht der Nachkommen investiert, muss bei der Partnersuche sehr gewissenhaft vorgehen. Ein Fehlgriff wäre fatal.
Denn Eizellen sind kostbar und selten; Spermien dagegen im Überfluss vorhanden.
So werden etwa die maximal 300 Eizellen einer Menschenfrau schon vor der Geburt angelegt und verharren bis zum Beginn der Pubertät in einem Ruhestadium. Sie liegen also bereit, ehe sie dann Monat für Monat abgerufen werden. Ein zeugungsfähiger Mann jedoch produziert Tag für Tag Abermillionen Spermien.
Diese Konstellation findet sich auch bei etlichen Wirbeltieren – daher die Auswahltests, denen sich Widder und Büffel, Beifußhühner, Seidenlaubenvögel und Fischadler vor ihren Partnern unterziehen müssen.
Oft favorisieren Weibchen männliche Tiere mit auffälligen, teils hinderlichen Ornamenten: die Rothirschbullen mit ihren riesigen Geweihschaufeln, die Löwen mit ihren mächtigen Mähnen, die Buckelzirpen, die bizarre Rückenschilder ausbilden.
Für viele Männchen ist ihre Pracht und Werbekunst nicht ungefährlich: Hahnschweif-Widafinken etwa bilden in Balzzeiten derart lange Schwanzfedern aus, dass sie in ihrem Flug stark behindert sind und ihren Fressfeinden kaum entkommen.
Den bei ihrer Paarung bunt leuchtenden Buntbarsch-Männchen lauern Fischreiher auf und können sie so viel leichter erlegen. Und unter Virginia-Leuchtkäfern, die einander bei der Balz bestimmte Blinksignale zusenden, gibt es räuberische Arten, welche die Blinkmorsezeichen perfekt imitieren, auf diese Weise die Leuchtkäfer anlocken und sie dann verspeisen.
Erst 1975 formulierten die israelischen Biologen Amotz und Avishag Zahavi eine Erklärung für dieses den Regeln der Evolution scheinbar widersprechende Phänomen: die Handicap-Theorie.
Demnach kann sich nur ein besonders fittes Männchen das Risiko eines hervorstechenden Ornaments leisten.
Das Schmuckelement, sagen die beiden Forscher, zeige dem Weibchen, dass es ein vor Gesundheit strotzendes Männchen vor sich hat.
Gefiederschmuck und Farbenpracht etwa signalisieren große Widerstandsfähigkeit gegenüber Parasiten. So leuchtet der Kamm des Hahns rot, weil er gut durchblutet ist; nur bei kranken Tieren ist er blass und bläulich.
Beim Menschen – wie bei Mäusen – ist zudem für die Partnerwahl der Körpergeruch ausschlaggebend. Er gibt Auskunft über die Zusammensetzung des Immunsystems und kann vom Gegenüber unbewusst entschlüsselt werden.
Auch ein symmetrischer Körperbau deutet auf ein starkes Abwehrsystem hin – und hat sich vermutlich deshalb zum Schönheitsideal entwickelt.
Statistische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Mensch für bestimmte Zahlenverhältnisse empfänglich ist. Männer bevorzugen Frauen, deren Hüfte etwa ein Drittel mehr Umfang aufweist als die Taille. Die Fettverteilung an diesen Körperpartien hängt mit der Menge des weiblichen Sexualhormons Östrogen zusammen und ist ein Zeichen für Fruchtbarkeit.
Frauen dagegen – so besagen ebenfalls Statistiken – favorisieren bei der Partnerwahl breitschultrige Männer mit gut ausgebildeter Muskulatur, die in der Pubertät unter dem Einfluss von Testosteron wächst.
So steuern den Menschen bei der Partnerwahl auch biologische Programme, die er zusammen mit der Sexualität von seinen archaischen Vorfahren geerbt hat.
Gleichwohl verharrte Homo sapiens nicht auf der urtümlichen Stufe der Instinkte. Neben seiner biologischen „ersten“ Natur, argumentieren Verhaltensforscher, habe der Mensch im Laufe der Zeit eine „zweite“, kulturelle Natur entwickelt. Sie leitet ihn ebenso wie seine genetische Mitgift.
Heute lässt sich nicht mehr mit Gewissheit sagen, ob ein bestimmtes Sexualverhalten ausschließlich biologische Wurzeln hat oder erlernt ist.
Schon die Bonobo-Affen setzen Sexualität nicht nur zur Fortpflanzung ein, sondern auch, um an Speisen zu gelangen oder Spannungen in der Gruppe abzubauen.
Der Mensch wiederum hat die Sexualität weit über den reinen Zweck der Vermehrung gehoben – was allein schon daran zu erkennen ist, dass unzählige Spielarten der Begierde und Lust das Zusammenleben in sämtlichen Kulturen bestimmen.
Er ist vermutlich sogar die einzige Spezies, die Sex und Vermehrung vollständig zu entkoppeln vermag – rund anderthalb Milliarden Jahre nach der ersten sexuellen Zellverschmelzung.
Aus Sicht der Evolution ist dies freilich eine unvorhergesehene Wendung: Die Fortpflanzung ist damit nur noch ein Beiwerk der Sexualität.