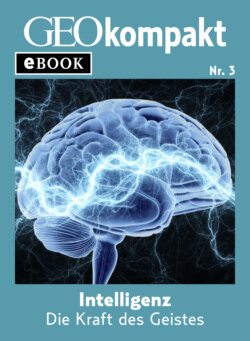Читать книгу Intelligenz: Die Kraft des Geistes (GEOkompakt eBook) - Группа авторов - Страница 8
Von Ute Eberle
ОглавлениеSchleimpilze sind denkbar simple Geschöpfe: Sie besitzen weder Kopf noch Glieder, manche bestehen nur aus einer riesigen Zelle und sehen aus wie schmierige Farbkleckse, die über den Waldboden kriechen. Und obwohl sie kein Gehirn haben, ja nicht einmal eine einzige Nervenzelle, scheinen sie dennoch recht komplexe Probleme lösen zu können.
Das zeigte sich, als der Japaner Toshiyuki Nakagaki einen Schleimpilz in den Eingang eines Labyrinths setzte. An dessen Ausgang platzierte er Haferflocken, ein begehrtes Futter. Wie geschickt sich ein Wesen in diesem Test dabei anstellt, den Weg durch die verzweigten Gänge zu finden, gilt in der Verhaltensbiologie als guter Indikator dafür, wie intelligent es ist.
Der hirnlose Einzeller meisterte die Aufgabe mit Bravour: Er fand den Weg zu den Haferflocken – und wählte sogar die kürzeste Route.
Sind Schleimpilze also intelligent? Verfügen sie demnach über eine Eigenschaft, die wir gemeinhin nur bei hoch entwickelten Geschöpfen erwarten? Wohl eher nicht.
Oder doch?
Es ist erstaunlich, dass die meisten Menschen diese Frage nicht auf Anhieb beantworten können. Im Alltag denken wir offenbar selten darüber nach, wie Intelligenz definiert wird – was verblüffend ist: Denn kaum ein anderes Wesensmerkmal prägt unser Leben so machtvoll, lenkt unseren Werdegang so entscheidend. Ob ein Mensch für intelligent gehalten wird oder nicht, bestimmt heutzutage in modernen Gesellschaften meist, welche Schule er besuchen darf, ob er studiert, welchen Beruf man ihn ausüben lässt, ob er Karriere macht. Oftmals auch, mit wem er verkehrt, welchen Freundeskreis er aufbaut, welchen Partner er findet.
Mit anderen Worten: welches Dasein er führt.
So trafen in den 1920er Jahren Tausende, die wegen der Wirtschaftskrise in die USA emigrieren wollten, auf US-Einwanderungsbeamte, die von den Behörden den Auftrag erhalten hatten, die potenziellen Immigranten auf deren Intelligenz zu prüfen – und jeden, den sie für „zu dumm“ hielten, zurückzuschicken.
Der Verstand eines Menschen kann sogar über Schuld und Unschuld, über Leben und Tod entscheiden. So wird in manchen Staaten, in denen es noch die Todesstrafe gibt, eine Hinrichtung mitunter ausgesetzt, wenn der Verdacht besteht, der Täter sei nicht intelligent genug gewesen, um seine Tat richtig einzuschätzen.
SEIT JEHER ZÄHLT DER VERSTAND zu den wichtigsten Werten der Gesellschaft – und zu einer ihrer stärksten Triebkräfte. Schließlich gründet unsere Zivilisation auf der Denkleistung intelligenter Menschen. Ohne Scharfsinn hätten unsere Vorfahren weder Ackerbau noch Viehzucht erfunden, hätten keine Städte erbaut, keinerlei technische Innovation hervorgebracht.
Niemand hätte sich je kluge Gedanken gemacht über den Sinn des Seins, niemand wüsste etwas über die Gesetze der Physik, den Aufbau des Universums, über die Wirkkraft von Arzneimitteln, die biochemischen Vorgänge in unserem Körper. Oder über die Evolution – also letztlich unsere Herkunft.
Wohl kaum eine andere Eigenschaft begehren Menschen daher mehr als Intelligenz. „Man darf fast alles über die Kinder anderer Leute sagen – dass sie faul, frech, aggressiv, nervös, zerfahren oder schüchtern sind“, schreiben die Kognitionsforscher Rolf Pfeifer und Josh Bongard: „Aber bloß nicht, dass sie unintelligent sind!“
All dies setzt eines voraus: dass wir überhaupt wissen, was Intelligenz eigentlich ist.
Die Antwort darauf mag zunächst recht einfach erscheinen. Der Begriff Intelligenz leitet sich vom lateinischen Verb „intellegere“ („einsehen“, „verstehen“) ab. So kann man diese Eigenschaft vereinfachend als die Gabe ansehen, möglichst schnell Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, Zusammenhänge herzustellen, Probleme zu lösen – kurz: schlussfolgernd zu denken.
Doch was genau verbirgt sich hinter dieser Fähigkeit? Wie entsteht Intelligenz? Was unterscheidet scharfsinnige von weniger klugen Menschen? Wo in unserem Kopf ist der Verstand untergebracht? Und beschränkt er sich allein auf unser Gehirn?
Seit Langem schon beschäftigen sich Psychologen und Bildungsexperten, Biologen, Informatiker und Neurowissenschaftler mit diesen Fragen. Das aber stellt sie vor Probleme. Denn Intelligenz kann man weder greifen noch riechen, weder schmecken noch ertasten oder sehen.
Daher gestaltet sich ihre Erforschung so kompliziert wie die des Bewusstseins. Die Experten versuchen gewissermaßen nichts Geringeres, als das Wesen von etwas Wesenlosem zu ergründen. Einer strukturlosen Macht Struktur zu verleihen. Zudem ist Intelligenz nicht bloß eine unsichtbare Erscheinung – sondern eine der vielschichtigsten überhaupt.
Und schließlich urteilen Menschen in verschiedenen Kulturen höchst unterschiedlich darüber, ob ein Mitbürger über einen hohen Verstand verfügt; nicht jeder, der beispielsweise in der westlichen Welt als schlau gilt, wird auch überall sonst so angesehen.
„Bei den Buschmännern in Australien“, so der renommierte Intelligenzforscher Detlef Rost von der Universität Marburg, „würde ein in unserer Gesellschaft hochgeschätzter und als besonders intelligent angesehener Informatiker vermutlich jämmerlich versagen und wäre kaum lebenstüchtig.“
Selbst bestimmte Charakterzüge werden je nach Kulturkreis gänzlich anders ausgelegt. Tratschen etwa gilt in der westlichen Welt zwar als unhöflich, aber nicht unbedingt als dumm. Bei manchen Völkern dagegen schon: Dort zeichnet es intelligentes Verhalten unter anderem aus, wie geschickt jemand innerhalb einer Gruppe für Harmonie sorgt.
Beim Volk der Luo in Kenia gibt es gleich vier Wörter, die sich auf Intelligenz beziehen. Dabei bezeichnet allein der Begriff rieko eine der westlichen Vorstellung ähnliche intellektuelle Kompetenz. Die Worte luoro und winjo dagegen beschreiben, wie respekt- und rücksichtsvoll jemand mit seinen Mitmenschen umgeht. Und paro, ob er begonnene Vorhaben auch zu Ende führt.
Chinesische Taoisten wiederum sehen Selbsterkenntnis und Bescheidenheit als wichtige Intelligenzfaktoren. Und für Menschen in Estland zählt dazu, wie emotional stabil jemand ist, wie gewissenhaft und weltoffen.
Was exakt sich hinter dem Phänomen Intelligenz verbirgt, ist deshalb eine der verwirrendsten Fragen der modernen Wissenschaft. Mittlerweile aber gewinnen Forscher ein immer genaueres Bild davon, was unseren Verstand – zumindest aus westlicher Sicht – kennzeichnet.
DAMIT EIN WESEN überhaupt eine Form von Intelligenz besitzt, darin sind sich die Wissenschaftler einig, muss es Eindrücke aufnehmen und speichern, es muss Informationen abrufen und verknüpfen können. Zudem stellt es seinen Verstand gewöhnlich unter Beweis, indem es Probleme löst.
Vor einigen Jahren einigten sich 52 international angesehene Experten auf folgende Beschreibung der menschlichen Geisteskraft: „Intelligenz ist eine sehr allgemeine geistige Kapazität, welche die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, zum Planen, zur Problemlösung, zum abstrakten Denken, zum Verständnis komplexer Ideen, zum schnellen Lernen und zum Lernen aus Erfahrung umfasst.“
Dieser Auffassung liegt ein Phänomen zugrunde, das Wissenschaftlern bereits vor mehr als 100 Jahren auffiel: War ein Schüler in einem bestimmten Bereich talentiert – konnte er beispielsweise mühelos Zahlenkolonnen addieren –, offenbarte er häufig auch andere geistige Fähigkeiten, er drückte sich etwa besonders gewandt aus. Es fiel ihm leicht, eine Fremdsprache zu erlernen, oder er fand flink Wege, um komplizierte Knoten zu lösen.
Sprach ein Schüler dagegen holprig, dann rechnete er oft auch schlecht, konnte sich schwer Vokabeln einprägen und zeigte häufig ein unzureichendes Verständnis für Gesetzmäßigkeiten.
Aus dieser Beobachtung erwuchs schließlich eine Theorie, die bis heute unter Wissenschaftlern die mit Abstand größte Zustimmung findet. Sie besagt, dass jeder Mensch eine Art geistige Energie besitzt – die allgemeine (oder „fluide“) Intelligenz –, die jedoch individuell unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
Daraus speist sich die kognitive Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen – also die Schnelligkeit und Effektivität, mit denen jemand Informationen verarbeitet: Wie leicht er lernt, wie rasch er logische Zusammenhänge herstellen kann oder wie verlässlich er sich neues Wissen einzuprägen vermag.
Die allgemeine Intelligenz wiederum bildet die Basis für die bereichsspezifische (oder „kristalline“) Intelligenz. Darunter verstehen Wissenschaftler unsere spezifischen Begabungen oder Talente, zum Beispiel verbale Fertigkeiten wie etwa Sprachgefühl, mathematisches Geschick oder räumliches Vorstellungsvermögen – also die von Mensch zu Mensch unterschiedliche Gabe, in bestimmten Bereichen Kenntnisse zu erwerben, Kompetenz zu entwickeln und schließlich eine Art Expertenwissen („kristallines Wissen“) aufzubauen.
Man kann dieses gängigste aller Intelligenzmodelle mit dem Wachstum eines Baumes vergleichen. Die allgemeine Intelligenz entspricht demnach einem fruchtbaren Humusboden, aus dem gewissermaßen der Strunk des Verstandes sprießt. Von dessen Dicke hängt die Ausprägung der bereichsspezifischen Intelligenz ab. Denn der Stamm verzweigt sich in die Talente und Begabungen. Freilich sind nicht alle Äste exakt gleich dick, alle Begabungen gleich stark ausgeprägt. Doch wer über viel allgemeine Intelligenz verfügt, der bildet einen kräftigeren Stamm und damit auch dickere Äste, die wiederum eine mächtigere Krone entwickeln.
Menschen mit wenig allgemeiner Intelligenz bilden einen vergleichsweise schlanken Stamm, aus dem dünnere Äste ragen. Die Krone bleibt schlichter, karger.
VOR ALLEM UNTER BILDUNGSFORSCHERN und Psychologen genießt dieses Modell eine breite Unterstützung und stellt das Fundament für die meisten gebräuchlichen Intelligenztests. In diesen Tests wird die Geistesstärke unter anderem dadurch gemessen, dass Probanden Rechenaufgaben lösen, Reimwörter finden, Buchstabenfolgen ergänzen oder eine Reihe unterschiedlicher Muster sinnvoll um ein weiteres Symbol vervollständigen.
Dabei hat sich gezeigt, dass wir uns Daten und Zusammenhänge je nach Tagesform mal besser, mal weniger gut merken können. Sind wir beispielsweise müde, vermögen wir uns schlechter zu konzentrieren, und unser Verstand lässt nach.
Fühlen wir uns überarbeitet, ist unser „Arbeitsgedächtnis“ kleiner: Wir können dann nicht mehr so viele Informationen wie sonst gleichzeitig im Kopf behalten – was dazu führt, dass uns komplexe Denkvorgänge mehr Mühe bereiten.
Ansonsten aber ist die allgemeine Intelligenz eines Menschen verblüffend stabil: Studien belegen, dass sich die Werte im Laufe eines Lebens nur wenig ändern.
Darüber hinaus haben Forscher herausgefunden, dass ein Intelligenztest überraschend verlässlich voraussagen kann, wie sich das Leben des Probanden entwickeln wird: Wie empirische Studien belegen, üben Menschen mit hoher allgemeiner Intelligenz eher als durchschnittlich begabte Mitbürger angesehene Berufe aus, genießen höhere Einkommen und leben in sozial stabileren Verhältnissen.
Menschen mit niedrigerer allgemeiner Intelligenz dagegen sind der Statistik nach häufiger arbeitslos und von Armut bedroht, leben überdurchschnittlich oft in Scheidung. Sie werden zudem eher kriminell, verbüßen mehr Gefängnisstrafen. Und sie sterben jünger – möglicherweise, weil sie weniger auf ihre Gesundheit achten und sich schwerer tun, im Krankheitsfall die Ratschläge eines Arztes umzusetzen.
Aufgrund all dieser Erkenntnisse, so der Marburger Forscher Detlef Rost, sei das Konzept einer allgemeinen Intelligenz „das am besten gesicherte Ergebnis der Intelligenzforschung“.
Und doch: Manche Wissenschaftler halten diese Theorie für zu einseitig. Denn, so ihr Argument, neben den allseits talentierten Menschen gebe es ja durchaus solche, die allein in einem einzigen Bereich brillieren, in etlichen anderen dagegen keine besondere Begabung zeigen. Einen Extremfall solch begrenzter Fähigkeiten finden Forscher bei autistischen Menschen, die sich mitunter im Leben kaum zurechtfinden – und doch auf manchen Gebieten mental unschlagbar sind.
Deshalb haben Intelligenzforscher Alternativmodelle entwickelt, um die Geisteskraft eines Menschen zu definieren, das bekannteste stammt von dem US-Psychologen Howard Gardner. Der an der Harvard University lehrende Wissenschaftler behauptet, es gebe mehr als nur einen Nährboden, aus dem sich unsere Begabungen speisen.
Vielmehr verfüge der Mensch über verschiedene Intelligenzen, die unabhängig voneinander existieren, etwa:
• die logisch-mathematische,
• die sprachliche,
• die naturkundliche,
• die musikalische,
• die visuell-räumliche,
• die körperlich-kinästhetische (wie
sie etwa Sportler auszeichnet),
• die sozial-interpersonale Intelligenz,
• die sozial-intrapersonale Intelligenz
(die uns zur Selbstreflexion und
Selbstmotivation befähigt).
Nach Gardners Modell könnte man den Verstand mit einer Pralinenschachtel vergleichen. Jede Intelligenz entspräche einer anderen Süßigkeit – die eine ist mit Nougat gefüllt, eine weitere mit Weinbrand oder Marzipan. Die Pralinen stehen untereinander nicht in Verbindung, sie verfügen über keine gemeinsame Basis.
Ein Mensch müsse also nicht über eine Intelligenz verfügen, um eine andere zu besitzen. Er könne auf einem Gebiet ein Virtuose sein, auf einem anderen eine Niete. Gardners Konzept stößt vor allem bei vielen Laien auf Resonanz, seine Bücher sind internationale Bestseller. Zudem ist seine Theorie einer der Grundsteine für ein weiteres, höchst populäres Konzept: das der Emotionalen Intelligenz.
Doch die meisten Psychologen und Bildungsexperten kritisieren, dass Gardners Modell kaum auf wissenschaftlich fundierten Studien und empirischen Erhebungen fußt.
Mehr noch: Seit wenigen Jahren haben auch die Neurowissenschaftler dazu beigetragen, dass das Modell der allgemeinen Intelligenz heute von einem Großteil der Forscher bevorzugt wird.
DENN VIELE JAHRZEHNTE LANG hatten die Intelligenzforscher nur mittels Fragebögen – also indirekter Methoden – ausloten können, wie der menschliche Verstand beschaffen ist. Inzwischen aber sind die Neurobiologen in der Lage, direkt zu untersuchen, wie sich unsere Geisteskraft auf zellulärer Ebene organisiert. Mithilfe hochmoderner Hirnscanner können sie dem Menschen beim Denken gleichsam zusehen – und somit auch überprüfen, welche Vorstellung von Intelligenz am ehesten der Arbeitsweise unseres Denkorgans entspricht.
Die raffinierten Geräte machen beispielsweise den Stoffwechsel der Nervenzellen im Gehirn sichtbar und vermögen so jene Areale aufzuspüren, in denen die Neurone etwa bei der Bearbeitung einer Rechenaufgabe besonders aktiv sind.
Sollte es tatsächlich, wie die meisten Forscher glauben, eine allgemeine Intelligenz geben, dann müssten bei der Lösung höchst unterschiedlicher Teilaufgaben eines Intelligenztests stets die gleichen Hirnregionen beteiligt sein – Gebiete also, in denen sich gewissermaßen der alles speisende Nährboden des Verstandes verbirgt.
Wenn es dagegen, wie Howard Gardner annimmt, viele unabhängig voneinander existierende Intelligenzen gibt, dann müssten bei unterschiedlichen Aufgaben jeweils unterschiedliche Hirnregionen aktiv sein.
Das Ergebnis: Welche Teilaufgaben auch immer in einem Test zu bewältigen waren – ob ein Proband beispielsweise Zahlenreihen vervollständigen sollte, abgebildete Figuren allein in seiner Vorstellungskraft zu drehen hatte oder ungeordnete Buchstaben zu Wörtern zusammensetzen musste –, stets traten die gleichen Regionen in Aktion, darunter Bereiche im präfrontalen Kortex, dem stirnnahen Teil der sogenannten Großhirnrinde.
Daraus schlossen die Forscher, dass genau dort die allgemeine Intelligenz zu verorten ist.
Denn dieses Gebiet steuert jene höheren geistigen Prozesse, die wie Planen, Entscheiden oder Lernen unerlässlich für intelligente Leistungen sind. Auch wichtige Teile des Arbeitsgedächtnisses haben ihren Sitz im präfrontalen Kortex.
Umgekehrt können Verletzungen in diesem Bereich der Großhirnrinde die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen ganz erheblich beeinträchtigen: Manche Patienten, bei denen ein Teil des präfrontalen Kortex beschädigt ist, erkennen keine Zusammenhänge mehr und können keine unbekannten logischen Probleme mehr lösen.
ALLERDINGS IST DER PRÄFRONTALE KORTEX nicht die einzige Hirnregion, die aktiv wird, wenn Menschen angestrengt denken. Immer sind auch andere Bereiche des Denkorgans beteiligt – etwa nahe der Schläfe oder unterhalb des Scheitels.
Darüber hinaus haben Forscher verblüffenderweise auch Zonen ausgemacht, die sie lange Zeit nicht mit intellektuellen Fähigkeiten in Verbindung brachten. So tritt bei manchen Denkprozessen häufig auch das Kleinhirn in Aktion, das stammesgeschichtlich älter ist als die gefurchte Großhirnrinde und vornehmlich den richtigen Ablauf von Körperbewegungen regelt.
Auch der Hippocampus wird oft aktiviert – jene Struktur im Großhirn, die Erinnerungen verarbeitet, zwischenspeichert und sie an andere Hirnareale weiterleitet.
All diese Hirnregionen, so vermuten die Forscher inzwischen, bilden die Grundlage für unsere unterschiedlichen Begabungen und Talente, also die bereichsspezifischen (oder „kristallinen“) Intelligenzen; sie repräsentieren gleichsam die Äste, in die sich der Baum unseres Verstandes verzweigt.
Und so ist unsere Geisteskraft nie allein auf die Aktivität des präfrontalen Kortex zurückzuführen, sondern gilt als eine über das gesamte Gehirn verbreitete Erscheinung. Zudem spielt, wie man heute weiß, die „weiße Substanz“ eine wichtige Rolle bei Denkprozessen. So nennen Wissenschaftler jene Milliarden von Nervenfasern, die die unterschiedlichen Hirnareale miteinander verbinden.
Darüber hinaus haben Forscher noch etwas herausgefunden: Nicht alle Menschen setzen bei der Bearbeitung eines Problems die gleichen Hirnregionen ein.
Schon die Geschlechter nutzen ihr Denkorgan unterschiedlich: Frauen arbeiten bei bestimmten Aufgaben eher mit der linken Gehirnhälfte, Männer mit der rechten. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe dafür, dass Männer bei mathematischen Schlussfolgerungen und Problemen der Raumvorstellung statistisch besser abschneiden – Frauen dagegen, wenn es etwa gilt, Dinge schnell wahrzunehmen, sich sprachlich gewandt auszudrücken oder Texte rasch zu erfassen.
Erstaunlicherweise aktivieren, wie Versuche gezeigt haben, sogar Probanden eines Geschlechts mitunter unterschiedliche Hirnareale.
„Menschen können den gleichen IQ haben und die gleiche Aufgabe gleich schnell und gut lösen, aber dazu verschiedene Bereiche im Gehirn verwenden“, erläutert der US-Psychologe Richard Haier. Das gilt sogar für eineiige Zwillinge.
Auch in diesen Fällen zeigen uns die Untersuchungen der Neurowissenschaftler also, wie dynamisch und wandelbar jenes Nervengeflecht in unserem Kopf ist, das den menschlichen Verstand hervorruft.
EIN BESONDERES BEISPIEL für diese Formbarkeit sind jene Menschen, denen – meist in jungen Jahren – aufgrund einer Erkrankung eine Gehirnhälfte (Hemisphäre) entfernt werden musste.
Obwohl im Kopf dieser Patienten nach dem Eingriff eine gewaltige Lücke klafft, schneiden sie in der Regel bei Intelligenztests nicht schlechter ab als vor der Operation: Die noch vorhandene Hemisphäre hat dann viele Funktionen der herausoperierten Hirnhälfte übernommen.
Die Erkenntnis der Forscher: Der Verstand hat eben keine starre Struktur, die, einmal ausgereift, sich später niemals mehr erneuern oder wandeln kann. Im Gegenteil: Von Geburt an verändert sich das Gebäude unserer Geisteskraft ununterbrochen. Damit derartige Umformungen im Hirn überhaupt möglich sind, ist der Mensch auf Reize von außen angewiesen.
Deshalb auch wäre eine kognitive Entwicklung ohne einen Körper und dessen Fähigkeit, Kontakt zur Umwelt aufzunehmen, schlicht undenkbar.
Anders ausgedrückt: Ohne Daten, die uns die Sinnesorgane liefern, könnte es keine Intelligenz geben.
Schon im Kindesalter reift die Geisteskraft allein dadurch heran, dass Jungen und Mädchen ihre Mitmenschen beobachten, Worte hören, Gegenstände betasten, in den Mund nehmen, daran riechen.
Nur so vermögen sie eine Sprache zu erlernen und Objekte in Kategorien einzuordnen: Decken und Kissen sind weich, Kuchen und Bonbons schmecken süß, Messer und Glasscherben sind scharf. Erst mit diesem Wissen können sie eine Basis für abstraktes Denken und somit für sämtliche höheren kognitiven Fähigkeiten aufbauen.
Deshalb gehen die meisten Forscher heute davon aus, dass unsere Intelligenz nicht nur von unserem Hirn, sondern vom gesamten Körper geprägt wird. Und dass sie stets aus dem Kontakt zur Umgebung entsteht.
Das zeigt auch der Verlauf der Evolution: Die ersten Formen von Intelligenz hatten noch gar nichts mit einem komplex strukturierten Gehirn zu tun, ja noch nicht einmal mit einer einzelnen Nervenzelle. Sondern damit, dass primitive Geschöpfe vor Hunderten von Jahrmillionen begannen, Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren.
Dazu waren bereits die ersten Bakterien in der Lage: Spezielle Empfangsmoleküle in ihrer Zellmembran halfen ihnen, Nahrungsstoffe, Giftmoleküle oder Licht wahrzunehmen.
Wurden die winzigen Detektoren gereizt, erzeugten sie chemische Signale und veranlassten die Einzeller, sich zum Futter oder Licht zu bewegen oder einer Gefahr auszuweichen. Mit anderen Worten: Erst die Fähigkeit, Reize aufzunehmen, ermöglichte es ihnen, Probleme zu lösen. In gewisser Weise also ihre Umwelt zu verstehen.
Ebendiese Gabe stellt auch der Schleimpilz im Labor von Toshiyuki Nakagaki unter Beweis. Den Weg durch das Labyrinth zeigt ihm wahrscheinlich der Duft der Haferflocken, der sich von der Quelle durch jeden Gang des Irrgartens ausbreitet. Das intensivste Futteraroma wird den hirnlosen Einzeller stets auf der kürzesten Route erreichen, und vermutlich folgt er diesem Duft mithilfe seines extrem einfach gebauten Sinnesapparats.
Damit aber ist der Schleimpilz in der Lage, nichts Geringeres zu bestehen als: einen Intelligenztest.