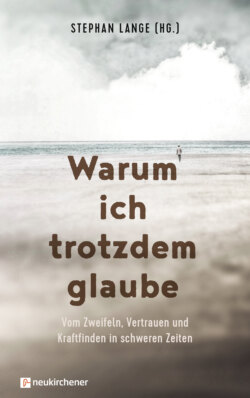Читать книгу Warum ich trotzdem glaube - Группа авторов - Страница 7
ОглавлениеDennoch
Helena Neufeld (40) ist Ehefrau und Mutter von fünf Kindern. Daneben ist sie als freie Autorin tätig.
Es kam wortwörtlich aus heiterem Himmel. Einem blauen Himmel, an dem ein paar Zugvögel ihre geordneten Bahnen flogen, erstaunlich früh an einem erstaunlich milden Februartag. Neben mir lag mein Mann im Gras, die Hände über der Winterjacke verschränkt und gab ein paar gemütliche Schnarchtöne von sich. Ich hatte ein Lächeln im Gesicht. Mein Stift fuhr über das Notizbuch, schrieb ein Wort nach dem anderen. Dieser Ort, diese Gefühle – das musste festgehalten werden. Sorgsam packte ich Worte ein, nur ganz ausgesuchte, wie besonders schöne Muscheln, die man als Andenken von einer Reise heimbringt. Zerbrechlich und schön. Wie das Leben. Mein Gedicht endete mit den Worten: Es sieht dich der Frühling an.
Doch dieser Blick voller Zärtlichkeit und Wärme schützte uns nicht vor der eiskalten Hand der Angst, die schon am nächsten Tag nach uns greifen sollte. Wir fuhren von unserem schönen Wochenende zu zweit nach Hause, ließen die Spaziergänge hinter uns, die Restaurantbesuche am Abend bei Kerzenschein und geröteten Wangen. Unsere Herzen waren voll und doch leicht. Worte der Liebe und Wertschätzung mögen das in ihrer Menge bewirken. Im Rückspiegel wurden die Windräder immer kleiner und die grasbedeckte Weite des flachen Nordens entschwand langsam unseren Blicken.
Niemals ist es einem selbst bewusst, wenn Stunden, die man gerade erlebt, die letzten unbeschwerten sind.
Diagnose Krebs
Dabei ging es nur um einen Routinetermin. Der Hausarzt wollte sichergehen, dass er nicht falsch gelegen hatte und wirklich kein Grund zur Besorgnis gegeben war. Sicherheitshalber.
Die Sicherheit wurde halber. „Irgendetwas stimmt nicht“, sagte der Spezialist. Eine Darmspiegelung wurde für die nächsten Tage angeordnet.
Es war ein Donnerstag. Der Frühling sah uns nicht mehr an. Wir beruhigten uns und wurden beruhigt. Es würde sich sicher um eine Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln handeln. Vielleicht eine Autoimmunerkrankung. Wir würden lernen, damit umzugehen. Es war still während der Autofahrt, still in der Praxis, still die Gebete in mir.
„Möchten Sie bei Ihrem Mann sein, wenn er gleich aufwacht?“
Die Arzthelferin lächelte mich warmherzig an. Ich legte hastig das Buch zur Seite, in dem ich gelesen hatte, stand auf und folgte ihr. Dort lag er und wieder hörte ich diese sanften, kurzen Schnarchtöne. Diesmal nicht im Gras, sondern auf einer Liege in einem Untersuchungsraum, eingewickelt in einer Decke. Ich betrachtete ihn und wartete. Die Arzthelferin guckte herein. „Möchten Sie einen Kaffee?“ Oh nein, ich wollte keinen. Meine Anspannung hatte sich gelöst. Es stimmte, was ich über diese Praxis gelesen hatte, sie waren hier äußerst freundlich.
Andreas wachte auf. Er war noch etwas benommen von dem Schlafmittel, das er bekommen hatte. Wir hatten kaum ein paar Worte gewechselt, als auch schon der Arzt schwungvoll ins Zimmer trat. Ich werde sein Gesicht nie vergessen. Er war so sympathisch, dass es völlig absurd war, Angst vor einer schlimmen Nachricht zu haben. Wir machten uns einfach zu viele Sorgen!
Er wandte sich an mich und lächelte. „Ihr Mann hat super mitgemacht“, sagte er und ich lachte erleichtert und setzte dazu an, etwas zu erwidern. Er unterbrach mich.
Mir blieb das Lachen im Hals stecken. Für einige Tage steckte es dort fest und schmerzte entsetzlich.
„Es sieht nicht gut aus“, sagte der Arzt, „es ist Krebs. Bösartig und ziemlich großflächig.“ Der Ernst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er ergriff die Hand meines Mannes, der dasaß und ihn anstarrte.
„Sie werden das schaffen!“, sagte er und mit jedem Wort ließ er ihrer beide Hände auf den Oberschenkel meines Mannes fallen, so als wolle er ihm diese Nachricht ins Bewusstsein hämmern. Woher er wisse, dass es bösartig sei, wollte ich wissen. Müssten nicht erst die Ergebnisse abgewartet werden? Der Arzt sah mich aus seinen trüben Augen kummervoll an. „Diese Art ist immer bösartig. Ganz sicher.“ Ohne Umschweife und doch voller Hoffnung waren seine Worte.
„Viele sind vor Ihnen diesen Weg gegangen, es wird ein schweres Jahr. Vergessen Sie Ihre Arbeit. Konzentrieren Sie sich jetzt darauf, gegen den Krebs zu kämpfen. Sie werden das schaffen!“
Wir stolperten irgendwann hinaus. Derselbe Flur, dieselbe Tür, aber alles war verändert. Grauenvoll anders. Ich führte Andreas zum Auto, bemerkte dann, dass ich noch etwas liegen gelassen hatte und ging wieder zurück. Die freundliche Arzthelferin mit den dunkelblond gewellten Haaren kam mir entgegen. Sie nahm mich in den Arm und ich schluchzte hilflos.
„Frau Neufeld, wir haben hier viele Patienten, die das geschafft haben. Ihr Mann wird das auch schaffen.“
Ich schickte schnell eine Nachricht an Familie und Freunde, die darauf warteten. Sie war kurz und hart: „Es ist Krebs.“
Dann ging ich zum Auto und setzte mich ans Steuer. Andreas zitterte neben mir in seiner dicken Jacke. Der Schock saß tief. Ich umarmte ihn, so hilflos!
Wie ich es geschafft habe, den Weg nach Hause zu fahren, weiß ich nicht, aber irgendwann standen wir vor der Haustür.
Wie sollten wir unseren Kindern in die Augen sehen? Was sagt man, wenn so etwas passiert? Wie sollte ich damit umgehen? Unser ältester Sohn öffnete die Tür, sichtlich betroffen. Andreas ging hinein und geradewegs hinauf ins Schlafzimmer. Er weinte.
Erschüttert bis ins Innerste.
Es waren erst Minuten vergangen, Minuten in unserem neuen Leben, das einen grauenvollen Riss bekommen hatte. Mich packte die Angst. Ich wusste, diese Qual in den Augen meines Liebsten konnte ich nicht allein tragen. Mit zitternden Fingern tippte ich eine Nachricht an einen der Leiter unserer Kirchengemeinde. Wir brauchten Hilfe.
Die Türklingel ging. Mein Bruder und seine Frau waren da. Wir hatten uns gegenseitig bei unseren Hochzeiten begleitet, Seite an Seite unsere Häuser gebaut, unsere Kinder bekommen und nebeneinander aufwachsen sehen. Wir hatten immer alles miteinander geteilt und jetzt teilten wir das Grauen. Wir weinten und zitterten zusammen. „Das Wort Darm habe ich schon immer gehasst“, dachte ich irrsinnigerweise.
Als es das nächste Mal klingelte, war es einer der Leiter der Gemeinde. Ich schämte mich etwas für die Unordnung. Hätte ich vorher aufräumen sollen? Ich bot allen Wasser an. Wir saßen am Tisch, nippten an unserem Wasser und der schockierenden Nachricht. Schluck für Schluck sickerte sie in unser Bewusstsein und drang durch bis ins tiefste Innere unseres Körpers.
Die beiden Jüngsten waren noch bei meinen Eltern, die während der Untersuchung auf sie aufgepasst hatten. Andreas wurde mit Öl gesalbt, wie es in der Bibel im Jakobusbrief steht, und wir beteten alle. Wir baten Gott um Hilfe, um Heilung, wenn möglich. Aber vor allem um die Hilfe, die wir gerade jetzt benötigten.
Unsere Kinder weinten.
Mitten im Sturm
An diesem Tag bebte für uns die Erde, auf der wir standen. Vieles stürzte einfach in sich zusammen, weil es nie Stabilität besessen hatte. Doch da war ein Ort, ähnlich einer Festung, hoch oben auf einem massiven Felsen gebaut. Während der Boden, auf dem wir standen, also erschüttert wurde, flogen uns Steinbrocken um die Ohren. Angst ließ unsere Herzen im Galopp dahinjagen, ohne Erbarmen. Da war es selbstverständlich, wo wir Schutz suchten, die Kinder im Schlepptau, Hand in Hand mit meinem völlig geschockten Ehemann. Wir rannten, ohne zu zögern an diesen Ort: in die Gegenwart Gottes.
Wenn auch das Toben und Wüten weitergehen würde, wenn auch alles zerbrechen würde, was wir kannten, so würde er doch derselbe bleiben. Derselbe Gott, den wir aus der Bibel kannten. Der nicht eingegriffen hatte, als Josef seine Brüder anflehte, ihn nicht zu verkaufen; der zugelassen hatte, dass er verkauft und in ein fremdes Land verschleppt wurde. Es war derselbe Gott, der mitten in diesen Jahren der Furcht, Einsamkeit, Ungerechtigkeit und Tränen bei Josef gewesen war. Er ließ ihn dort, aber durch das, was Josef litt, erfüllte er einen Plan, der Josef selbst und vielen anderen Menschen das Leben rettete. Dieser Plan war größer als ein Menschenleben und schloss doch dieses Menschenleben mit ein.
Es war derselbe Gott, der Daniel in die Löwengrube werfen ließ, und der doch den Löwen nicht gestattete, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Derselbe Gott löschte nicht das Feuer im Ofen des Nebukadnezar, war aber selbst mitten im Feuer bei Schadrach, Meschach und Abed-Nego, sodass das Feuer ihnen nichts anhaben konnte.
Mir ist der Gott der Bibel vertraut, weil ich mit ihm lebe, seit dem Tag, an dem ich ihm die Tür zu meinem Leben geöffnet habe, deshalb ist es verständlich, dass ich zu ihm rannte. Doch ich denke, dass jeder Mensch, gerät er in eine Situation äußerster Not, in der plötzlich alle Stützen wegbrechen, instinktiv weiß, woher wirklich Hilfe zu erwarten ist. In einem abstürzenden Flugzeug ist die Zahl der Gebete deshalb höher als in einem, das sicher landet.
Muss Gott vielleicht deshalb manchmal Dinge zulassen, die Angst und Schmerz hervorbringen, damit es ins menschliche Bewusstsein dringt, wie zerbrechlich die Sicherheit und das Glück sind, in denen er sich wähnt? Es wäre möglich, scheint mir. Doch sicher ist nicht jede Art von Leid ein solches Megafon Gottes, wie es der irische Schriftsteller C. S. Lewis nannte.
Diese Nacht war ein einziger Alptraum. Schwer atmend, mit rasenden Herzen, lagen wir nebeneinander. Es ist schwer zu beschreiben. Wir waren zusammen. Ich tat mein Bestes, um meinem Mann beizustehen, aber es gibt Momente, durch die muss man ganz allein gehen. Dazu gehört das Sterben mit der Verantwortung, die jeder Mensch vor Gott hat. Es gab da plötzlich einen Abgrund im Herzen meines Mannes, den ich nicht überwinden konnte. Schwarz und drohend hatte er sich aufgetan.
Andreas war Christ. Doch die Diagnose hatte an diesem Christsein heftig gerüttelt. Ihn quälten furchtbare Fragen: „Was geschieht, wenn ich sterbe? Wo werde ich hingehen?“
Nach einer zähen, langen Nacht wachte ich morgens müde auf. Sofort holte meine Erinnerung zum Schlag aus. Mir blieb die Luft weg. Das passierte gerade wirklich. Uns.
Meine Schultern taten weh, als hätte ich Steine geschleppt. In meinem Hals steckte noch immer das Lachen des Vortages fest und schnürte mir die Luft ab.
Da kam unser jüngster Sohn. Er hatte Hunger wie an jedem normalen Morgen. Ich stand also mit zitternden Knien auf. Längst hatte ich mich entschieden, wie ich mit der Situation umgehen wollte. Vielmehr war es keine Entscheidung, es war das natürliche Ergebnis all dessen, was ich glaubte. Da hatte es diesen einen Tag gegeben, an dem ich meinem Mann versprochen hatte, für ihn in guten und in schlechten Zeiten da zu sein. Nun, jetzt waren die schlechten dran. So gut ich konnte, wollte ich ihm mit all meiner Kraft helfen.
Ich ziehe gerne Bücher zu Rate, wenn ich mich mit Themen auseinandersetze, die mir neu sind. Dieses Thema war mir gänzlich neu. Aber alle Krebsratgeber mussten warten und wurden zur Seite geschoben. Stattdessen saß ich vor der aufgeschlagenen Bibel wie jeden Morgen. Dort fand ich Kraft. Im Gebet brachte ich Andreas vor Gott im Himmel, ja, ich kämpfte dort am Esstisch an seiner Seite.
Ein Lied, das mich schon seit Tagen begleitet hatte, wurde mir zur Gehhilfe. Während ich die Hausarbeit erledigte und das Mittagessen kochte, sang ich es aus vollem Herzen: „In Christus ist mein ganzer Halt.“ Meine Stimme zitterte bei der Zeile: „Nun hat der Tod die Macht verlor’n.“ Glaubte ich das wirklich? Ja! Dann würde ich auch so leben.
Mit der Bibel zogen wir zwei uns zurück. Wir lasen all die Stellen, die davon sprechen, wie man Frieden mit Gott bekommt. Ich schrieb sie ihm in eines der kleinen, schwarzen Notizbüchlein, die ich erst eine Woche zuvor für eine Gruppe von Teenagermädchen besorgt hatte. Stunden verbrachten wir im Gespräch, beteten zusammen und lasen die Bibel mit einem solch verlangenden Herzen wie selten zuvor.
Dann kam der Durchbruch.
Andreas und ich saßen am Esstisch und sprachen miteinander, als unser ältester Sohn nach Hause kam. Er ging direkt an das Klavier in seinem Zimmer und begann, wie er es oft tut, für sich selbst zu spielen. Die Melodie von „Wie tief muss Gottes Liebe sein“ klang zu uns herüber. Auf dem Smartphone suchte ich den Text heraus, legte ihn Andreas hin und ging zum Klavier. Wir sangen dieses wundervolle Lied, sicher war es die schönste Version, die ich je gesungen habe, obwohl sie am schäbigsten klang, zitterte doch meine Stimme so arg, dass man kaum ein Wort verstehen konnte. Doch das, was wir sangen, war der Kern unseres Glaubens.
Wie tief muss die Liebe Gottes sein, wenn er selbst herabkam und dieses Grauen, das nun über uns gekommen war, freiwillig auf sich nahm? Freiwillig ging er den Weg bis in den furchtbarsten Tod. Er hätte jederzeit sagen können: „Nein, jetzt ist es genug.“ Doch er schwieg und ertrug Schmerzen, Qual und Pein ganz allein – dort am Kreuz. Warum tat er dies? Aus Liebe zu uns.
Deshalb hatte der Zweifel an seiner Liebe keine Sekunde Raum in unseren Herzen. Der Tod hat seine Macht verloren durch Christus, Gottes Sohn.
Der letzte Ton verklang, ich wischte mir übers Gesicht und ging zurück zu meinem Mann. Doch als ich ihn sah, wusste ich, dass sich etwas verändert hatte. Seine Augen strahlten, während er weinend über dem Text saß. Diese Erkenntnis war in sein Herz durchgedrungen. Das Ausmaß dessen, was diese Stunden dort am Kreuz heute noch für eine Bedeutung für uns Menschen haben: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Der Tod wäre nur ein Übergang in eine andere, vollkommene Welt.
Die Angst war gebrochen. Frieden erfüllte Andreas’ Herz. Seit diesem Tag ist er verändert. Es ist, als sei sein Christsein nun nicht bloße Theorie, kraft- und wirkungslos, sondern sein Leben. Er lebt nun, was er glaubt. Aber er musste selbst dahin kommen, es zu sehen.
Der Kampf beginnt
Der Arzt hatte recht gehabt, es wurde ein schweres Jahr. Wir machten einen Schritt nach dem anderen, dachten immer nur an den Tag, der vor uns lag, die Entscheidung, die gerade anstand. Welche Klinik wählen wir? Welchen Ärzten vertrauen wir?
Wir entschlossen uns, Gott darum zu bitten, uns bei unseren Entscheidungen zu helfen, und im Vertrauen auf ihn wollten wir dann jeden Schritt gehen.
So kam es, dass wir für die Ärzte beteten, die Andreas weiter behandeln sollten. Tests und Untersuchungen mussten gemacht werden. Wir beteten oft und viel. Als Paar, als Familie, die Gemeinde betete für uns, die Freunde und völlig fremde Menschen, die von unserem Schicksal gehört hatten.
Diese Gebete stärkten uns den Rücken. Es waren Menschen da, die mit uns diese Last trugen.
Wenn ein kleines Boot in einen Sturm gerät, erkennen die Menschen darin an den dunklen Wolkenmassen und der Höhe der Wellen, die sich vor ihnen auftürmen, wie groß die Wucht sein wird, die sie gleich treffen wird. Sie sehen die Gefahr, in der sie sich befinden, dass Wind und Wellen ihr Boot zum Kentern bringen können und sie alle untergehen. Deshalb setzen sie unverzüglich einen Notruf ab.
Sie rufen die Küstenwache: „Kommt schnell und helft uns!“ Ist ein größeres Schiff in der Nähe, das den Notruf hört, so ist es verpflichtet, zu drehen und Hilfe zu leisten, wo es kann.
Nun, ich denke, nichts anderes taten wir.
Vor unserer Familie – diesem kleinen Boot mit Kindern an Bord – türmten sich Wellenberge, die uns erschauern ließen. Wie Blitze zerrissen Bilder von Abschied und Tränen unsere Herzen. Das bedrohliche Grollen der Zukunft flößte uns Angst ein.
Das war zu groß für uns.
Deshalb schämten wir uns nicht, anderen Menschen von der Not zu erzählen, die über uns gekommen war. Doch uns ging es nicht um finanzielle Hilfe, sondern um Hilfe in Form von ernst gemeinten Gebeten. Wir baten darum, dass die Gemeinde, der wir angehören, für uns betete, damit wir in diesem Sturm nicht untergingen. Obwohl selbstverständlich der unbändige Wunsch da war, Gott möge all das in einem Handumdrehen von uns nehmen und den Sturm auf wundersame Weise mit einem Wort stillen, war da noch etwas anderes. Eine ruhige Gewissheit, dass Gott Pläne und Gedanken mit jedem Menschen hat, die unsere Gedanken und unser Verständnis weit übersteigen. Auch wenn wir den Sinn hinter unserem Schicksal nicht sehen konnten, wussten wir doch, dass wir Gott vertrauen konnten.
Am Geburtstag unseres jüngsten Sohnes bekamen wir die Ergebnisse: Der Krebs schien nicht gestreut zu haben. Was für eine Freude! Diese Feier bleibt der ganzen Familie unvergessen.
Jetzt galt es zu kämpfen.
Zuerst musste sich Andreas einer Chemo- und Bestrahlungstherapie unterziehen, diese Zeit verbrachte er weitestgehend im Krankenhaus. Dann folgte die große Operation, in der ihm ein Stück seines Darmes entfernt und ein künstlicher Darmausgang eingesetzt wurde. Auch diese Operation verlief gut, die Chirurgen konnten den Tumor komplett entfernen. Leider waren auch ein paar Lymphknoten unmittelbar neben dem Darm befallen gewesen, deshalb musste nach der Operation direkt wieder mit einer Chemotherapie weitergemacht werden.
Diese Zeit war zermürbend. Es half uns sehr, dass Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte da waren und uns zur Seite standen. Sie zogen sich nicht zurück, sondern luden uns zu sich nach Hause ein und besuchten uns in unserem Zuhause, sodass wir uns nie allein fühlten. Sie fuhren mit uns ins Philharmoniekonzert, hörten Lieder mit uns, schickten uns Karten, Bücher, Blumen, Päckchen, kochten für uns, passten auf unsere Kinder auf, weinten und lachten mit uns.
Sie halfen uns, Gottes Güte jeden Tag zu sehen, denn in jeder liebevollen Geste und in jeder Art von Hilfe sahen wir die Hand Gottes, die diese Menschen zur Liebe bewegt hatte. Mitten im Sturm kämpften wir doch nicht allein. Erleichternd und Mut machend war auch die Reaktion von Andreas’ Arbeitgeber und Vorgesetztem, der ihm jeden Druck nahm und alle Sorgen, die Arbeitsstelle zu verlieren, weit nach hinten schob.
Wir kämpften uns also durch Krankenhausaufenthalte und Therapien, bauten immer wieder Erholungszeiten ein und verbrachten ein paar Tage auf der Nordseeinsel Juist. Diese kleinen Höhepunkte im belastenden Alltag taten unseren Seelen gut und gaben uns neue Kraft.
Am Ende des Jahres wurde Andreas’ künstlicher Darmausgang wieder zurückverlegt. Es sollte die letzte Operation werden und dann, ja dann, sollte das Leben wieder in seine normalen Bahnen zurückkehren. Wir ahnten nicht, dass im Jahr 2020 die Normalität für uns alle abhandenkommen würde.
Zerschlagene Hoffnung
Golden lag das Jahr vor uns. Was für einen schweren Weg hatten wir als Familie zurückgelegt, doch nun konnten wir endlich aufatmen. Andreas erholte sich von der Operation und konnte bald wieder normale Mahlzeiten zu sich nehmen und vertragen. Er wurde zusehends kräftiger und brannte darauf, endlich wieder arbeiten zu gehen. Doch dann kam die Kurzarbeit wegen Corona und machte den langsamen Wiedereinstieg unmöglich. Andreas entschloss sich schließlich, nach Absprache mit seinem immer entgegenkommenden Vorgesetzten, im Mai wieder voll in seinen Job einzusteigen, ohne Reha oder Wiedereingliederungsprogramm. Vorausgesetzt, bei der ärztlichen Kontrolluntersuchung, die im Mai wieder auf dem Programm stand, würde nichts dagegensprechen.
Es sprach nichts dagegen. Der Ultraschall war unauffällig, die Blutwerte durchweg gut – alles sah vielversprechend aus. Es musste nur noch ein Röntgenbild gemacht werden, dafür schickte der Hausarzt ihn in die Radiologie. Mit diesen guten Nachrichten kam Andreas vom Hausarzt und trotz der allgemeinen Beklemmung wegen des Lockdowns schlugen unsere Herzen leicht und froh. Endlich, endlich begann für uns wieder die Normalität des Lebens!
Wir wollten das Leben in vollen Zügen auskosten, wussten wir doch jetzt, wie zerbrechlich es ist.
Acht Tage lebten wir in dieser schönen, alltäglichen Normalität. Ich war etwas besorgt, dass die Belastung bei der Arbeit vielleicht zu viel für Andreas’ Körper sein könnte, doch er wischte diese Bedenken weg. Er war zwar sehr müde, aber der Körper würde sich schon daran gewöhnen.
Corona beunruhigte uns, Andreas gehörte ja zur Risikogruppe. Er las einige Artikel über das Virus. Irgendwann fiel mir auf, dass er hin und wieder einen kurzen, trockenen Husten ausstieß, einem Räuspern gleich. Ich lachte und meinte, das komme davon, dass er so viel über Corona lese, die Psyche eben.
Corona verschonte uns. Doch nicht der Krebs.
Es war Sonntag, der 17. Mai 2020, ein sonnig schöner Morgen. Licht durchflutete unseren Wohn- und Essbereich, leise surrte die Dunstabzugshaube in der Küche, auf dem Herd schmorte ein Braten vor sich hin. Der Online-Gottesdienst war gerade zu Ende, als das Telefon ging. Ich hörte die Stimme des Hausarztes am anderen Ende der Leitung. Er fragte nach meinem Mann. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mein Verstand und mein Herz einen Weg zueinander gefunden hatten. Ich begriff. Welcher Arzt ruft am Sonntag einen Patienten zu Hause an?
Eiskalt war die Hand, die nach mir griff.
Ich suchte verzweifelt in Andreas’ Gesicht nach Zeichen dafür, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe, doch alles, was ich fand, war das Zittern seiner Stimme und der Glanz ungeweinter Tränen in seinen Augen. Er ging mit dem Hörer auf die Terrasse hinaus und schloss die Tür.
Ich ging zu Boden.
Das durfte, das konnte nicht sein! Das konnte Gott uns doch nicht antun! Nicht jetzt, nicht sofort wieder! Bratenduft schlüpfte durch die Tür ins Freie hinaus, in den Frühling, ins Leben, als Andreas wieder hereinkam, den Tod auf den Schultern.
Er hatte Schatten auf der Lunge. Der Arzt war gerade die Röntgenaufnahmen durchgegangen, die ihm aus der Radiologie zugeschickt worden waren. Es durfte keine Zeit verloren werden. Jetzt musste schnell reagiert werden. Ich weinte laut und haltlos. Alles in mir rebellierte. Betrogen fühlte ich mich, furchtbar betrogen. Der Kampf, die Hoffnung, die guten Chancen auf Heilung – wie ein einziger Hohn waren sie mir.
Es roch nach Anis, als mein Herz brach, dort neben verheißungsvoll dampfenden Töpfen. Dennoch knieten wir beide uns im Wohnzimmer hin und weinten vor Gott. Ich konnte nicht mehr sagen als: „Hilf uns, Herr Jesus!“
Es genügte.
Die Türklingel ging und der Hausarzt stand sichtlich betroffen davor. Er brachte uns die Unterlagen und ermutigte Andreas, bereits am nächsten Morgen früh in die Onkologie zu fahren.
Zeit – kostbare Zeit
Auf und zu ging die Tür zur Onkologie, Menschen gingen hinein und kamen wieder heraus, Tücher um den nackten Kopf gebunden. Ich sah dem Leben beim Zerrinnen zu, da auf der Treppe vor der Onkologie.
Dumpf war der Herzschlag in mir.
Mir fielen Geschichten ein, in denen Ärzte sich gründlich geirrt hatten und statt des erwarteten kleinen Mädchens, das sie im Ultraschall gesehen hatten, ein Junge zur Welt gekommen war. Vieleicht gab es auch eine andere Erklärung für die Schatten … die Schatten. Sie griffen nach uns, diese Schatten.
„Begleitpersonen bleiben draußen“ sagte das Schild an der Tür, und so wartete ich draußen, wie ein Hund auf sein Herrchen, bis Andreas ins Arztzimmer gerufen wurde. Das Herrchen holte den Hund vor der Tür, wir gingen dem weißen Kittel hinterher, bis sich die Tür hinter uns schloss.
Augen sahen einander an, Gesichter blieben hinter Masken verborgen. Wir waren drei Halt suchende Menschen – zwei vor und einer hinter dem Tisch. „Es ist kein Irrtum möglich.“ Der Krebs war zurück, aggressiv, schnell und tödlich.
Unheilbar, dieses Mal.
„Wie lange?“, stammelte ich. „Wie viel Zeit bleibt uns noch?“
„Das kann niemand sagen“, sagte die Ärztin und ich dachte an Gott.
„Es können zwei Tage oder zwei Jahre sein. Vielleicht sogar mehr. Wir wissen es nicht.“
„Aber er“, dachte ich, „Gott weiß es.“
Ist nicht jeder Tag eines Lebens in sein Buch geschrieben, noch bevor es beginnt? Und da wurde das dumpfe Pochen ruhiger in mir. Da war ein Vater im Himmel, der unsere Hände hielt, während heiße Tränen unsere Masken aufweichten.
Die Onkologen rieten Andreas dringend zu einer aggressiven Kombinationstherapie, die dazu dienen sollte, seine Lebensqualität und -zeit so lange wie möglich zu erhalten. Er machte diese Therapie, die insgesamt sechs Monate dauerte. Dieses Mal war er die meiste Zeit zu Hause. Die Kinder und ich waren hilflose Augenzeugen seines Leides. Doch unsere Kinder sahen in dieser Zeit nicht nur die Übelkeit und Abgeschlagenheit ihres Papas. Sie sahen auch das Leuchten seiner Augen, wenn er über den Himmel sprach und über Jesus Christus, den er seinen Retter nennt. „Er hat mir das ewige Leben geschenkt, deshalb ist der Tod für mich ein Gewinn. Wenn ich sterbe, gehe ich in eine andere Welt, die nicht weniger real ist als diese hier. Nur dass es dort keinen Krebs und keinen Tod und kein Leid mehr gibt.“ Das sagte er und sie spürten die Echtheit dahinter.
Im Dezember, nach dem Ende der Therapie, kamen die Ergebnisse der Untersuchung: Die Metastasen in Lunge und Leber waren fast vollständig weg. Was für eine Erleichterung! Die Therapie hatte ihre volle Wirkung erzielt.
Wie viel Zeit ihm noch bleibt? Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Keiner weiß es bei irgend jemandem. Nur der lebendige Gott weiß den Tag und die Stunde, wenn es Zeit wird zu gehen – für Andreas, für mich und für jeden Menschen auf dieser Erde.
Von Geigen, Bögen und Händen, die halten
Woher nahmen wir die Kraft, das bis heute durchzustehen? Gott war diese Kraft und wird es auch in Zukunft sein. Er kennt jeden Menschen bis tief ins Herz hinein und weiß deshalb um Trost, den kein Mensch einem anderen geben kann.
Doch wie ein Violinist seine Geige in die Hand nimmt und ihr sanft süße Töne entlockt, so nimmt Gott Menschen, die bereit dazu sind, und lässt aus ihrem Leben eine Melodie entstehen, die andere tröstet und zur Ruhe kommen lässt. Ich spreche von Menschen, die uns umarmten, uns zuhörten und Raum in ihrem Leben gaben. Von Menschen, die für ein paar Stunden einem Kranken Gesellschaft leisteten, von Menschen, die für uns kochten, ihr Glück mit uns teilten und unseren Kindern schöne Stunden voller Unbeschwertheit schenkten. Menschen, die uns in den verschiedenen Tönen der unterschiedlichsten Instrumente doch ein harmonisch klingendes Lied spielten, dessen Text von Liebe handelt.
Ganz offensichtlich hat Gott unsere Gebete nicht so beantwortet, wie wir es gern gehabt hätten – der Krebs ist zurückgekehrt und die Prognosen stehen schlecht. Dennoch halten wir fest an ihm, weil seine Hand uns hält und er vertrauenswürdig ist.
Es gibt da diese Geschichte von Lazarus, einem Freund von Jesus, der unheilbar krank wurde. Seine Schwestern schickten sofort nach Jesus und baten ihn, zu kommen und zu helfen. Es mag uns schockieren, da zu lesen, dass Jesus nicht kam. Er ließ es zu, dass Lazarus starb. Der Todeskampf, die Tage der Auszehrung – das war real und schrecklich.
Aber Jesus ließ zu, dass seine Freunde da hindurchgehen mussten. Und damit kein Irrtum aufkommt, steht dort nachdrücklich: „Jesus aber hatte Marta lieb und ihre Schwester und Lazarus.“ Er liebte diese Menschen und mutete ihnen so etwas zu? Warum nur?
Wir finden die Antwort in derselben Geschichte: Damit Menschen glauben und ewiges Leben finden.
Immer wieder erkenne ich, dass das Glück auf dieser Erde zweitrangig ist im Vergleich zur Ewigkeit. Jedem Leid dieser Welt sind doch Grenzen in der Zeit gesetzt. Wenn durch die Krankheit meines Mannes auch nur ein anderer Mensch innehält und den Weg zur Rettung in Jesus Christus findet oder wenn unser Leid dazu beitragen kann, dass andere in ihrem Glauben gestärkt werden, dann ist es das wert.
Sehe ich auf die Hand, die uns hält, fallen mir die Wunden darin auf. Ich sehe Gottes Sohn, der herabkam, Verfolgung, Hass, Schläge, Schmerzen und schließlich einen schrecklichen Tod durchlitt – und er ist Gott! Er hätte sein persönliches Leid jederzeit beenden können. Doch da gab es ein großes Ganzes. Es ging um das ewige Leben. Deshalb kann ich heute sagen: „Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ (Psalm 73, 23–24)
Und süß erklingt die Melodie.