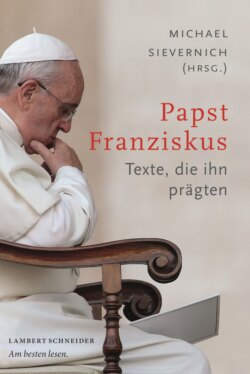Читать книгу Papst Franziskus - Группа авторов - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеWelche Gedanken und Ideen prägen Jorge Mario Bergoglio, den Lateinamerikaner, den Jesuiten, den Erzbischof von Buenos Aires, den Papst, der sich den Namen Franziskus gab? Auf diese Frage mögen zahlreiche Biografien Antwort geben, die sein Leben und Wirken chronologisch darstellen und in die Lebenskontexte einbetten. Doch dieses Buch wählt einen anderen Zugang. Es dokumentiert Texte sehr unterschiedlicher Art, auf die Papst Franziskus oftmals selbst verweist und betont, wie sehr ihn diese Texte prägten und wie sehr ihre Lektüre zu empfehlen sei. Diese Hinweise gewähren uns gleichsam einen kleinen Einblick in seine virtuelle Bibliothek, die all jene Bücher enthält, die er einmal gelesen hat und die seinen geistigen Kosmos mitbestimmen. Der Blick in diese Denkwelt lässt eine geistig vielseitige Person erkennen, die Raum und Zeit ihrer Lebenswelt in ihrer Breite studiert und in ihrer Tiefe auslotet.
Die hier versammelten Texte, die gleichsam aus der geistigen »Bibliothek des Papstes« stammen, hat Jorge Mario Bergoglio/Papst Franziskus gelesen, meditiert, kommentiert. Sie prägen sein Idearium, aus dem er für seine Ansprachen und seine Initiativen Ideen schöpft. Sie spiegeln die geistige und spirituelle Welt wider, in der er sich bewegt und aus der er lebt. Es handelt sich um Originaltexte aus den Quellen, die hier eigens ausgewählt wurden, um einerseits die Autoren oder Autorinnen im Original zu Wort kommen zu lassen und andererseits zu erläutern, warum diese Texte für den Papst wichtig geworden sind und nach wie vor viel bedeuten. Dabei hält sich Bergoglio an das Prinzip, dass die Wirklichkeit wichtiger ist als die Idee und sich nicht von dieser lösen darf. In der Spannung von Wirklichkeit und Idee besteht er immer auf dem Vorrang der vorhandenen Wirklichkeit, etwa auf der sozialen Wirklichkeit und auf der Nähe zu und der Begegnung mit den Menschen, besonders dem einfachen Volk und den Armen.
Das Spektrum der Texte ist zeitlich und sachlich außerordentlich breit gestreut und bezieht sich auf viele Jahrzehnte von Lektüren. Es zeugt von einem großen Horizont, der sich nicht in akademische Grenzen bescheidet, sondern auch der Spiritualität und der Kunst in ihren Ausdrucksformen breiten Raum gibt. Die Sammlung enthält Texte von Dichtern, Denkern und Mystikern; sie bezieht viele Epochen ein und bezieht sich auf Werke spätantiker Theologen oder frühneuzeitlicher Mystiker, auf Theologen des gesamten 20. Jahrhunderts, auf deutsche und italienische literarische Klassiker, auf argentinische Literatur des 19. oder des 20. Jahrhunderts. Gewiss ist die vornehmlich europäische Prägung nicht zu übersehen, aber ebenso wenig das Profil lateinamerikanischer Theologen und Literaten.
Die etwa vierzig ausgewählten Texte, die hier ausschnittweise im Wortlaut zur Sprache kommen, bilden eine Auswahl, deren Kriterium die Bezugnahme bildet, die Bergoglio selbst vornimmt. Sei es, dass er sich auf einen klar definierten einzelnen Text bezieht, einen spezifischen Zusammenhang anspricht oder Werke und bestimmte Autoren erwähnt. Jedenfalls haben die hier sprudelnden Quellen einen ausdrücklichen Bezug, den Papst Franziskus selbst hergestellt hat. Die Auswahl ist exemplarischer Art und kann nicht vollständig sein, obgleich eine Reihe von Autoren durchaus eine weitergehende Behandlung verdient hätten, zum Beispiel Jesuiten wie der Franzose Gaston Fessard, der Argentinier Miguel Angel Fiorito oder der Deutsche Erich Przywara. Geistliche Autoren, die Bergoglio besonders schätzt wie Dorotheus von Gaza aus der Zeit der Wüstenväter werden nicht eigens behandelt, weil eine Schrift »über die Selbstanklage« schon übersetzt und kommentiert vorliegt (vgl. Literatur).
Natürlich stehen in der virtuellen Bibliothek des Papstes noch sehr viel mehr Bücher und Autoren, die sich aus seinem Beruf und seiner lebenslangen Lektüre ergeben. Sie kommen hier nicht zur Sprache, da sie selbstverständlich zum Wissensbestand eines jeden Theologen und Priesters gehören. Dazu gehören die Bücher der ursprünglich in hebräischer und griechischer Sprache verfassten Bücher des Alten und Neuen Testaments. Ebenso gehört die Auslegung dieser biblischen Texte dazu, die in jeder Epoche neu zu leisten ist. Zum täglichen Umgang gehören außer den biblischen Texten das Stundengebet der Kirche, das regelmäßig zu bestimmten Stunden (Horen) des Tages gepflegt wird, am frühen Abend zum Beispiel als Vesper. Inhalte sind vor allem Psalmen, Schriftlesungen, Hymnen und Gebete. Zur täglichen Praktik gehört auch die Liturgie der Kirche in der Eucharistiefeier (Messe). Mit der religiösen Praxis der Kirche sind immer auch normative Texte des Glaubens und der Ethik verbunden. Zum Grundwissen gehören auch theologische Handbücher und die Literatur der theologischen Disziplinen, das heißt der biblischen, historischen, systematischen, philosophischen und praktischen Fächer. Auch die Rechtssammlungen wie der Codex des kanonischen Rechts sind zu nennen. Lehramtliche Texte der Weltkirche und der Ortskirchen werden hier in der Regel nicht aufgenommen, da diese Texte wie etwa Enzykliken und Apostolische Schreiben, Dokumente der Bischofssynoden oder Hirtenschreiben von Bischofskonferenzen und kontinentalen Synoden zum Allgemeingut gehören. Werke dieser und ähnlicher Art finden sich nicht in dieser Sammlung, da diese dem Auswahlprinzip folgt, das der individuellen Handschrift von Jorge Mario Bergoglio entspricht, öffentlich bestimmte Werke und Autoren zu zitieren, zu empfehlen oder zu erwähnen.
Überraschend im geistigen Kosmos des Papstes sind die auffälligen Bezüge zur künstlerischen Dimension und zum Schönen. Auch wenn hier nur literarische Texte Berücksichtigung finden können, ist sein öffentlich geäußerter Bezug zu Kunst und Literatur sehr viel breiter gestreut. Er bezieht sich auf (geistliche) Musik und Oper, wie etwa die Große Messe in c-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart und die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, auf Ludwig van Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 oder auf den Parsifal und den Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Er bezieht sich auch aufs Kino, insbesondere den italienischen Neorealismus von Federico Fellini (La strada; Roma città aperta), zudem auf neuere Filme wie den dänischen Film Babettes Fest (1987). Auch mit dem Tango ist er vertraut, wie es sich für einen »porteño«, so heißen die Einwohner von Buenos Aires, gehört. Auch die bildende Kunst gehört zum weiten Feld seines Interesses, unter den Malern fasziniert ihn besonders Michelangelo Merisi da Caravaggios »Berufung des heiligen Matthäus« und Marc Chagalls »Weiße Kreuzigung«.
Diese Sammlung enthält Texte verschiedener literarischer Gattungen, die den drei Feldern der ignatianischen Spiritualität, der Theologie und der Literatur entstammen. Bei allen einzelnen Texten wird der jeweilige Autor oder die Autorin vorgestellt, das Werk in den Zusammenhang eingeordnet, kommentiert und in seinem Bezug zu Papst Franziskus beschrieben. Es handelt sich um narrative Texte der geistlichen Literatur, epische aus der Romanliteratur und lyrische Texte. Es sind argumentative und reflexive Texte aus philosophischen und theologischen Werken, es sind Texte aus Büchern zur Spiritualität und zur Mystik, es geht um deskriptive und präskriptive Texte, bis hin zu populären Liedtexten des Tango. Die Verschiedenheit der Texte fügt sich Bergoglios bevorzugtem Modell, dem vielseitigen Polyeder, dessen Teile zusammengehören, ohne ihre Eigenart zu verlieren. Alle Texte, so verschieden sie in Herkunft und Eigenart auch sein mögen, bilden bei aller Eigenart einen vielfältigen Raum, der die Teile biographisch miteinander verknüpft und die Facetten eines Lebens zeigt.
Doch darüber hinaus verbindet sie eine gemeinsame Mitte, die nicht sofort erkennbar ist. Es ist die geistliche Mitte eines Zeitgenossen, der in der Tradition des Christentums katholischer Provenienz steht, genauer in der Variante des lateinamerikanischen Volkskatholizismus argentinischer Prägung. Es ist ein Katholizismus, für den die Volksfrömmigkeit eine Kraftquelle ist und der auf dem Hintergrund der innovativen Theologie der Befreiung des Subkontinents eine argentinische Variante der »Theologie des Volkes« entwickelt hat. Diese Volksreligion hat auch unter lateinamerikanischen Theologen und im Episkopat eine hohe, kritische Wertschätzung gefunden. Sie spiegelt sich in den Dokumenten, welche die Kirche Lateinamerikas in den Synoden von Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) und Aparecida (2007) reflektiert und dabei Evangelisierung und Befreiung miteinander verknüpft. Auf der Konferenz von Aparecida (2007), die Papst Benedikt XVI. eröffnet hatte, lag die Federführung bei der Erstellung des Dokuments bei Kardinal Jorge Mario Bergoglio.
Über Papst Franziskus sind inzwischen zahlreiche Biographien erschienen (s. Bibliographie), die den biographischen Hintergrund entfalten, der zur Einordnung der Texte nützlich ist. Doch auf ein wichtiges Charakteristikum dieses Papstes mit Migrationshintergrund sei besonders hingewiesen: Er ist als Großstädter aufgewachsen und war Bischof einer Diözese, die ausschließlich die Großstadt Buenos Aires umfasste. Er kennt die urbane Welt mit ihren Licht- und Schattenseiten. Aus eigener Erfahrung weiß er um die sozialen Probleme der Megalopole mit ihren »villas miserias«, aber auch um ihre vielfältige Kultur, von der Oper und der Literatur bis zum Tango und zum Fußball. Im 21. Jahrhundert, in dem sich die Erde in einem rasanten Urbanisierungsprozess befindet und die Hälfte der Erdbevölkerung in teilweise gigantischen urbanen Räumen lebt, steht die Kirche vor einer besonderen Herausforderung. Als eine global vernetzte Weltkirche, die ursprünglich in den antiken Städten großgeworden ist und seit zwei Jahrtausenden mit der Stadt in aller Welt vertraut ist, dürfte das Christentum für die neue urbane Herausforderung spirituell, sozial und human gut gerüstet sein.
Die folgende Anthologie von Texten ist nach sachlicher Zugehörigkeit strukturiert, auch wenn die Übergänge bisweilen fließend sind. Im ersten Teil sind Texte aus der geistlichen Tradition des Jesuitenordens versammelt, in den Papst Franziskus 1958 im Alter von 22 Jahren eingetreten ist und dem er seitdem angehört. Darauf verweist nicht zuletzt die Übernahme des Jesuitenemblems in das päpstliche Wappen. Die 1540 von Ignatius von Loyola gegründete und päpstlich approbierte »Gesellschaft Jesu« (Societas Jesu, abgekürzt S. J.) verfügt über grundlegende Dokumente und normative Texte, die alle Mitglieder des Ordens im Verlauf ihrer Ausbildung kennenlernen und im Noviziat verinnerlichen, also auch Jorge Mario Bergoglio. Er verfügt zudem über lange Erfahrung in der Ausbildung der jungen Jesuiten und in der Leitung der argentinischen Jesuitenprovinz. Aus diesem umfangreichen jesuitischen Textkorpus wird eine Auswahl von narrativen Texten aus der Autobiographie des Ignatius (»Bericht des Pilgers«) vorgestellt, die er im Alter seinem Sekretär in Spanisch und Italienisch diktierte. Der Bericht endet mit dem Weg nach Rom, wo Ignatius die Dienste der »reformierten Priester« dem Papst zur Verfügung stellte. Weitere zentrale Texte sind den »Geistlichen Übungen« (Exerzitien) entnommen, also jenem spirituellen Herzstück des Jesuitenordens, das für die ganze Kirche und darüber hinaus ökumenisch große formende Bedeutung gewinnen sollte. Dazu kommt ein Text aus den Briefen des zur Mission nach Asien entsandten Franz Xaver, eines Mitbegründers des Ordens. Weitere Texte entstammen normativen Dokumenten des Ordens, seien es die noch von Ignatius verfassten Satzungen (Konstitutionen), oder moderne programmatische Texte des Ordens aus der Gegenwart, an denen Jorge Mario Bergoglio teilweise als Delegierter mitgewirkt hat.
Im zweiten Teil sind historische und zeitgenössische Quellentexte gesammelt, welche einerseits maßgebende spirituelle und mystische Traditionen repräsentieren, die für den geistlichen Hintergrund des Papstes nach eigenem Bekunden von prägender Kraft gewesen sind. Hierbei handelt es sich um spirituelle Klassiker der spanischen und französischen Tradition, aber auch um den mystisch begabten Jesuiten Peter Faber, der in Europa, besonders auch in Deutschland, eine wichtige Rolle bei der geistlichen Reform gespielt hat und den Papst Franziskus als Leitbild für die Kirche von heute vorstellt. Zum anderen werden philosophische und theologische Texte des 20. Jahrhunderts vorgestellt, auf die Bergoglio sich vielfach bezieht. Hier stehen neben französischen Autoren deutschsprachige wie Hugo Rahner, Hans Urs von Balthasar und Romano Guardini und der Argentinier Lucio Gera, der in Europa kaum bekannt ist, aber für Bergoglio ein theologischer und pastoraler Gewährsmann war.
Im dritten Teil schließlich kommen vor allem literarische Texte zur Sprache, die auf der einen Seite von wichtigen europäischen Autoren verschiedener Epochen der Neuzeit stammen und international in Italien, Deutschland, Frankreich, Russland und England zu Hause sind. Auf der anderen Seite sind es epische Werke und Romane aus Lateinamerika, die für den Subkontinent und besonders für Argentinien von Bedeutung sind. Eine besondere Rolle spielte dabei Jorge Luis Borges, der berühmte Schriftsteller Argentiniens, der einen seiner zahlreichen Prologe für eine Buch von jungen Schülern schrieb, das Bergoglio als Lehrer angeregt hatte. Ein weiterer Text verweist auf den Tango, eine argentinische Erfindung, die Tanz, Musik und Gedicht verknüpft. Auch auf diese populäre Kunstform bezieht sich Bergoglio.
Insgesamt gibt diese Textsammlung einen exemplarischen Einblick in eine Geisteswelt, durch die ein Papst nicht allein den europäischen Horizont repräsentiert, sondern ihn auch auf Lateinamerika hin überschreitet und damit einer anderen Kultur Prägekraft im höchsten Amt verschafft, das die katholische Kirche zu vergeben hat. Durch die beiden Vorgänger hatte sich schon die italienische Dominanz relativiert, da das hohe Amt mit Johannes Paul II. an einen Polen und damit nach Osteuropa sowie an Benedikt XVI. und damit an einen Deutschen und nach Nordeuropa ging. Mit der Wahl von Papst Franziskus hat sich der Horizont nochmals geweitet. Denn aus einer italienischen Migrantenfamilie stammend, ist er sprachlich, emotional und intellektuell in Lateinamerika und in Europa zu Hause. Aber er mag der Vorbote sein, wenn das Papstamt sich weiter internationalisiert und einmal an einen Asiaten oder Afrikaner geht. Dann wird auch deren kulturelle Welt Einzug halten und die Glaubens- und Denkwelten über Europa hinaus erweitern. Eine dann anstehende Sammlung der prägenden Texte wird gewiss weitere Überraschungen mit sich bringen. Doch schon jetzt zeigt sich, welche Reformen und Transformationen ein Papst für die mit 1,2 Milliarden Katholiken größte christliche Kirche bewirken kann, der aus anderen Breiten kommt, die Zeichen der Zeit erkennt und eine neue Dynamik in Gang setzt. Programmatische Leitworte dieses Aufbruchs sind – wie Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einem kleinen Buch betont – Zärtlichkeit und Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit.