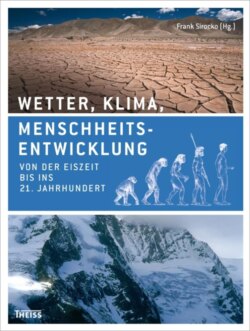Читать книгу Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung - Группа авторов - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Regionalität
ОглавлениеBisher wurden Wetterextreme speziell für die Eifelregion betrachtet. Wie aber zum Beispiel am Ausmaß der Stürme „Vivian“ und „Wiebke“ zu erkennen ist, beschränken sich Extremereignisse oft nicht auf eine bestimmte Region. Veranschaulicht wird dies in Abbildung 7.9. Dargestellt sind hier sogenannte „Prozent-Ränge“ des Windes beziehungsweise des Niederschlages für die oben beschriebenen Beispiele der Stürme im Februar 1990 und des Starkniederschlages im Oktober 1982 an einigen Mess-Stationen des Deutschen Wetterdienstes. Je höher ein solcher Prozent-Rang, desto seltener, das heißt extremer, ist das Ereignis am jeweiligen Ort. Wie man schon an diesen Beispielen sieht, treten extreme Niederschläge im Allgemeinen in einem räumlich eher begrenzten Gebiet auf (oft noch viel lokaler als hier gezeigt), während starke Stürme größere Regionen betreffen. Trotz der starken Regionalität des Niederschlages sind aber Trockenheiten und auch Hochwasser häufig von überregionaler Natur. Bei den Hochwassern liegt das vor allem daran, dass ein Fluss sein Wasser aus dem Niederschlag in seinem gesamten Einzugsgebiet bezieht. So sind die Pegelstände an Mosel und Rhein sehr gut miteinander korreliert, und auch zwischen den Pegeln an Rhein und Urft, einem Bach in der Nordeifel, besteht noch ein deutlicher Zusammenhang (Abb. 7.10). Demnach findet ein Hochwasser eines kleinen Eifelbaches häufig zeitgleich mit einem Hochwasser an Rhein und Mosel statt. Ablagerungen in den Maaren können deshalb benutzt werden, um auch überregional für die gesamte Mittelgebirgsregion auf das Vorkommen von Hochwasserereignissen Rückschlüsse zu ziehen. Betrachtet man speziell das simultane Auftreten von Hochwassern an verschiedenen Pegeln in Zentraleuropa mit extremen Hochwassern an einem Eifelbach (hier der Nette), so ergibt sich in einem großen Gebiet eine sehr hohe Häufigkeit von gleichzeitigen Hochwassern (Abb. 7.11). Befunde aus den Maarsedimenten über Hochwasser gelten also für die gesamte Mittelgebirgsregion, weit über die Eifel hinaus. Erst im Nordosten Deutschlands und in der Alpenregion folgt das Wetter anderen Mustern. Daher kann man sich bei der Auswertung der Maarsedimente auf Hochwasserlagen konzentrieren. Diese sind gut zu identifizieren (Kap. 4) und stehen für überregionale Wetterstrukturen.
7.10 Zusammenhang zwischen täglichen Pegelständen an den Eifelflüssen Mosel und Urft und dem Pegelstand des Rheins für den Zeitraum 2002–2003. R2 gibt den linearen Korrelationskoeffizienten der jeweiligen Größen an.
7.11 Gleichzeitigkeit von Hochwassern an verschiedenen Pegeln in Zentraleuropa und extremen Hochwassern am Eifelfluss Nette (grünes Kreuz). Die Farbskala gibt die Häufigkeit eines solchen simultanen Auftretens von Hochwassern im Zeitraum 1970–2000 in Prozent an. Hochwasser sind hier als Überschreitung eines stationsabhängigen Grenzwertes des täglichen Abflusses am Pegel definiert. Die Pegeldaten stammen vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (Datenbank der WSV des Bundes) sowie vom Weltdatenzentrum Abfluss (GRDC) in Koblenz.