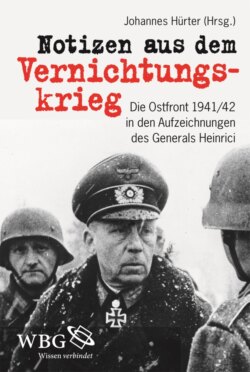Читать книгу Notizen aus dem Vernichtungskrieg - Группа авторов - Страница 7
|22|Editorische Hinweise
ОглавлениеDer Herausgeber hat bereits 2001 eine Auswahl der Papiere Heinricis aus dem ersten Jahr des Ostkriegs als Buch veröffentlicht17. Der schmale Band war bald vergriffen. Die vorliegende Edition ist, auch wenn sie sich teilweise auf die frühere Sammlung stützen kann, keine Neuauflage, sondern ein neues Buch. Der Fokus liegt wiederum auf den dramatischen und letztlich wohl kriegsentscheidenden ersten Monaten des als Vernichtungskrieg konzipierten Feldzugs NS-Deutschlands gegen die Sowjetunion. Keine anderen bisher bekannten Briefe und Tagebücher eines beteiligten Generals vermitteln ein vergleichbar dichtes und anschauliches Bild vom Vormarsch der Wehrmacht (und ihrer Generalselite) bis vor die Tore Moskaus, ihrem rücksichtslosen Vorgehen, ihren Siegen und ihrem Scheitern. Die umfangreiche Überlieferung aus diesem Jahr wurde noch einmal gründlich durchgesehen, die Dokumentenauswahl verändert und erweitert. Vollständig neu ist der Anhang mit zahlreichen Selbstzeugnissen Heinricis vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ziel ist die Annäherung an einen exemplarisch „normalen“ Wehrmachtsgeneral der älteren Generation. Die einführenden Überlegungen sind völlig neu verfasst und knapper, essayistischer ausgefallen als im früheren Buch – auch um für die Dokumente mehr Platz zu haben, ihnen weniger vorzugreifen und sie stärker für sich selbst sprechen zu lassen.
Quellen. Die Edition veröffentlicht Auszüge aus Egodokumenten Gotthard Heinricis von Januar 1915 bis Mai 1945, mit dem Schwerpunkt auf dem ersten Jahr des deutsch-sowjetischen Krieges von Juni 1941 bis Juni 1942. Die Tagebücher und Briefe, die sich sämtlich im Nachlass des Generals im Bundesarchiv (BArch), Abteilung Militärarchiv Freiburg i. Br. befinden, sind unmittelbare Selbstzeugnisse, die sich von den Erinnerungen mit größerem zeitlichem Abstand unterscheiden. Die Rekonstruktion und Selbstvergewisserung der eigenen Biografie und besonders seines Handelns als Kommandeur im Zweiten Weltkrieg in zahllosen Briefen und Aufzeichnungen Heinricis nach 1945 werden in der vorliegenden Edition nicht berücksichtigt. Die Nachkriegserzählungen |23|über die eigene (NS-)Vergangenheit, denen er, wie zahlreiche andere ehemalige Wehrmachtsgenerale, viel Zeit und Energie widmete, sind ein Thema für sich, das sich eher für eine Studie als eine Edition eignet.
Formate. Heinrici nutzte für seine zeitnahen privaten Selbstzeugnisse drei unterschiedliche Formate, die meist drei verschiedene Modi des Erzählens bedeuteten. Zunächst führte er, wie so viele Offiziere, in Zeiten des Krieges – mit Lücken (und vermutlich nicht vollständig überliefert) – persönliche, handschriftlich in Kladden geschriebene Tagebücher. Sie dienten in erster Linie der Dokumentation und Rechenschaft der eigenen beruflichen Tätigkeit als Soldat. Ihnen vertraute Heinrici gelegentlich auch (Selbst-)Reflexionen über außermilitärische Fragen an. Bei den Briefen an seine Eltern (bis 1939) sowie an seine Frau und beiden Kinder (1939–1945), in denen militärische Details höchstens eine untergeordnete Rolle spielen, muss zwischen zwei Formaten unterschieden werden. Die handschriftlichen Privatbriefe enthalten viele persönliche und vertrauliche, nur für den Adressaten bestimmte Bemerkungen. Dagegen sind die maschinenschriftlichen Briefe – Heinrici hatte im Bürodienst der Reichswehr mit der Schreibmaschine umzugehen gelernt – eher allgemein und weniger intim gehalten18. Sie gingen in der Regel in Durchschlägen an mehrere Adressaten, bis 1939 an die Eltern und an die Schwiegermutter, im Zweiten Weltkrieg an die Frau und die Kinder (und teilweise wohl auch an andere interessierte Verwandte und Freunde). Diese allgemeinen Briefe bezeichnete Heinrici nach 1939 als „Berichte“ oder „Kriegsberichte“. Doch ganz gleich, in welchem Format und Modus er schrieb, ob im militärischen und zugleich vertraulichen Tagebuch, im intimen Brief oder im eher allgemeinen „Bericht“: Heinrici wies seine Frau im Krieg wiederholt darauf hin, dass alle diese Aufzeichnungen „Dokumente“ seien. Es ging ihm offenbar immer auch um die Rechtfertigung seines Handelns vor der Nachwelt.
Auswahl. Dieses Buch ist eine Auswahledition, und die Auswahl ist, wie nicht anders zu erwarten, letztlich subjektiv und ein Konstrukt des Herausgebers. Das gilt in besonderer Weise für den Anhang, in dem mit ausgewählten Dokumenten aus 30 Jahren ein möglichst repräsentatives Bild der politisch-militärischen Mentalität eines Wehrmachtsgenerals bis 1940 (unter besonderer Beachtung der Umbrüche von 1918/19 und 1933/34) sowie seiner Wahrnehmung und Deutung des Kriegsverlaufs seit 1942 vermittelt werden soll. Doch auch für den Hauptteil, die Dokumentation des ersten Ostkriegsjahres 1941/42, musste trotz der hohen Zahl und Dichte der abgedruckten Dokumente streng ausgewählt werden, so zahlreich und ausführlich sind Heinricis „Notizen“ gerade für diesen Zeitraum. Dem Rotstift fielen vor allem die oft minutiösen |24|Beschreibungen militärischer Operationen im Tagebuch zum Opfer, bis auf einige charakteristische Beispiele, etwa am Höhe- und Endpunkt des deutschen Angriffs um den 5. Dezember 1941. Mancher Spezialist mag das bedauern und vielleicht sogar der Auswahl insgesamt misstrauen. Demgegenüber sei darauf verwiesen, dass die hier ausgewerteten Bestände allesamt im Bundesarchiv zugänglich und somit überprüfbar sind, dass sich außerdem der Herausgeber auf der Grundlage seiner langjährigen Forschungen über die deutsche Generalselite um eine Auswahl bemüht hat, die so repräsentativ und vielfältig wie möglich ist.
Auslassungen. Das für die Auswahl Gesagte gilt grundsätzlich auch für die Kürzungen in den abgedruckten Dokumenten. Alle Auslassungen sind durch […] gekennzeichnet, mit Ausnahme der Begrüßungsformeln am Anfang („Liebe Trudel“, „Liebe Eltern“, „Ihr Lieben“ etc.) und Ende („Es grüßt Dich vielmals Dein Heinerle“, „Herzliche Grüße Euer Gotthard“ etc.) der Briefe, die aus Platzgründen – mögen sie manchmal auch aussagekräftig sein – grundsätzlich ohne weiteren Vermerk weggelassen wurden.
Schriftbild. Den Angaben zur Provenienz des jeweiligen Dokuments (BArch, N 265 = Bundesarchiv, Abteilung Militärarchiv, Nachlass Gotthard Heinrici, dann Band- und eventuell Blattnummer) folgt die Abkürzung „ms.“, sofern es sich um ein maschinenschriftliches Dokument handelt. Fehlt dieser Hinweis, ist der jeweilige Tagebucheintrag oder Brief im Original handschriftlich ausgeführt.
Orthografie. Rechtschreibung und Zeichensetzung Heinricis weisen einige Eigentümlichkeiten auf, die aber keineswegs durchgehend auftauchen. So ist im selben Dokument bei Infinitivformen mit Endung „hen“ teilweise das „e“ weggelassen, teilweise ausgeführt („stehn“, „stehen“), bei maschinenschriftlichen Dokumenten das „ß“ mal durch „ss“ ersetzt, mal, sofern es der Maschinentyp zuließ, ausgeschrieben. Besonders auch die Groß- und Kleinschreibung ist uneinheitlich. All diese Besonderheiten wurden nur dann stillschweigend korrigiert, wenn sie auf offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Tippfehler zurückzuführen sind. Ausnahme: Ob „alle“ handschriftlich klein- oder großgeschrieben wurde, ist kaum zu unterscheiden, deshalb wurde bei der Transkription auf Kleinschreibung vereinheitlicht.
Personen. Die nicht selten falsche Schreibweise von Personennamen wurde nicht verbessert oder angemerkt, sofern die Namen auch ohne Korrektur klar zuzuordnen sind: etwa bei „Goering“ oder „Göhring“ statt Göring. Bei der ersten Namensnennung werden in den Fußnoten Hinweise zu den Lebensdaten sowie zu Titel, Amt und Funktion der jeweiligen Person zur Zeit der Abfassung des Dokuments (oder bei wiederholter Erwähnung: der Dokumente) gegeben. Bei allgemein bekannten Personen der Weltgeschichte (Hitler, Lenin, Stalin, Napoleon) oder Weltliteratur (Goethe, Tolstoi) konnte getrost auf die biografischen Angaben verzichtet werden.
|25|Orte. Auch die Schreibung der Ortsnamen ist nicht immer einheitlich, obwohl sich Heinrici als Offizier spürbar um eine genaue und korrekte Angabe der Einsatzorte bemühte. Bei deutlichen Abweichungen wurde die übliche Schreibweise oder Transkription in eckigen Klammern angefügt. Außerdem wurden für 1941/42 (Kapitel „Dokumente“) die Wege und Standorte Heinricis anhand der militärischen Dienstakten (XXXXIII. Armeekorps, 4. Armee) überprüft und seine teilweise schnell wechselnden Quartiere am Kopf der Dokumente ergänzt, sofern sie nicht bereits von Heinrici genannt wurden. Eine zusätzliche Orientierungshilfe bieten die der Edition auf Vor- und Nachsatz beigegebenen Karten. Für die Transkription von Ortsnamen in der damaligen Sowjetunion war, wie in den deutschen Quellen, die in dieser Zeit gebräuchliche russische Namensform grundlegend, auch bei weißrussischen und ukrainischen Orten (z.B. Gomel statt Homel).
Abkürzungen. Ungewöhnliche oder wenig evidente Abkürzungen sind im Text in eckigen Klammern aufgelöst. Bei gebräuchlichen, aber heute weniger bekannten Abkürzungen, besonders jenen aus dem militärischen Dienstbetrieb (Kdt./Kommandant, Rgt./Regiment etc.), hilft das Abkürzungsverzeichnis am Ende des Bandes. Die Eigenart Heinricis, Abkürzungen häufig nicht mit einem Punkt zu versehen, wurde in der Regel nicht korrigiert.
Hervorhebungen. Unterstrichene oder anders hervorgehobene Wörter oder Passagen im Text sind durch Kursivdruck kenntlich gemacht.
Sachkommentar. Die erläuternden Zwischentexte (kursiv) zwischen den Dokumenten und die Anmerkungen in den Fußnoten vermitteln knapp die Informationen, die für das Textverständnis notwendig sind. Weitere Studien und Quellen werden nur bei Spezialfragen angegeben. Bücher erscheinen dann als Kurztitel und werden im Literaturverzeichnis vollständig genannt. Dort findet der Leser auch Empfehlungen zur weiteren Lektüre. Die Hinweise zu den militärischen Operationen stützen sich vor allem auf eigene Forschungen, auf das grundlegende Reihenwerk des Militärgeschichtlichen Forschungsamts „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“ sowie für 1941/42 auf die Kriegstagebücher Ia des Generalkommandos des XXXXIII. Armeekorps (BArch, RH 24–43) und des Oberkommandos der 4. Armee (BArch, RH 20–4), der beiden von Heinrici geführten Großverbände. Für die Besatzungsherrschaft hinter der Front ist zu erwähnen, dass die Akten der zuständigen Abteilungen des Generalkommandos des XXXXIII. Armeekorps (Quartiermeister, Ic) für 1941/42 nicht überliefert sind. Die entsprechenden Akten des Armeeoberkommandos 4 wurden vom Herausgeber an anderer Stelle ausgewertet19.
|26|Bilder. Wie zahlreiche Hinweise in seinen Briefen belegen, dokumentierte Heinrici seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg auch fotografisch. Leider haben sich diese wichtigen Bilddokumente nicht in seinem Nachlass erhalten. Eine rein illustrative Bebilderung dieser Edition wäre kein Ersatz für diesen Verlust. Daher wurde bis auf die für sich sprechende Porträtfolge zu Beginn und zwei Fotos im Text darauf verzichtet. Den kleinen Anachronismus, für das Cover kein Foto aus den Jahren 1941/42, dem Schwerpunkt dieser Edition, gewählt zu haben, möge man Verlag und Herausgeber nachsehen. Das spätere Foto schien uns besonders gut und treffend.
Dank. Der Herausgeber dankt Susanne Maslanka und Jana Augustin für die Hilfe, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, besonders Regine Gamm, für die kompetente und verständnisvolle Betreuung sowie Ulrich Berkmann für die Redaktion.
München, im Februar 2016