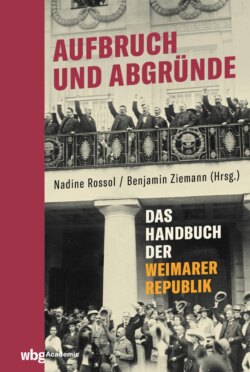Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 61
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Wahlergebnisse: Republik ohne Republikaner?
ОглавлениеDas klassische Narrativ zu den Wahlergebnissen der Weimarer Republik basiert auf der These einer zunehmenden, durch die Weltwirtschaftskrise vorangetriebenen Abwendung von der Demokratie, ausgedrückt in einer polaren Radikalisierung. Es lautet wie folgt: Bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 konnte die „Weimarer Koalition“ aus (M)SPD, Zentrum und DDP bei der hohen Wahlbeteiligung von 83 Prozent eindrucksvolle 72,4 Prozent der Stimmen und fast vier Fünftel der Mandate in der Nationalversammlung gewinnen.64 Trotz der Konkurrenz der USPD setzte damit die SPD ihre Aufwärtsentwicklung im späten Kaiserreich fort und gewann fast 38 Prozent. Auch das Zentrum konnte mit 16 Prozent seine bisherigen Ergebnisse übertreffen. Noch überraschender war das Abschneiden der linksliberalen DDP mit 18,6 Prozent. Die meisten, auch schon zeitgenössischen Erklärungen lauteten, dass das liberale Bürgertum mit einer starken DDP in der Regierung allzu weitgehende sozialistische Maßnahmen der SPD verhindern wollte.65
Dies war die Mehrheit, auf die die Weimarer Republik gebaut war, die die Verfassung verabschiedete, den Reichspräsidenten wählte und den Versailler Vertrag unterzeichnete. Die nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch anberaumten Wahlen zum Reichstag 1920 ließen aber diese Mehrheit schnell vergehen. Die Weimarer Koalition gewann lediglich noch 43,6 Prozent. Die ganze Weimarer Republik hindurch konnte die Gründungskoalition keine Mehrheit mehr erreichen.66 In dieser „Republik ohne Republikaner“ mussten wechselnde Koalitionen regieren, häufig nur auf Minderheiten und eine tolerierende SPD gestützt und unter zunehmendem Druck durch immer stärker werdende demokratiefeindliche Parteien auf der Linken (KPD) und der Rechten (DNVP, NSDAP).
Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise kam es zu einer Radikalisierung der Wählerentscheidung, von der vor allem die NSDAP profitierte, die mit den Reichstagswahlen 1930 einen Erdrutschsieg verbuchte. Zusammen mit der KPD, die seit 1924 einen kontinuierlichen Aufstieg genommen hatte und im November 1932 der SPD gefährlich nahekam, ergab dies im Juli 1932 eine „negative Mehrheit“ der Demokratiefeinde. Darunter litt nicht nur die DNVP, die sich bis 1932 mehr als halbierte, sondern vor allem die liberalen Parteien, wobei die DDP geradezu pulverisiert wurde. Die DDP und die DVP hatten 1919 noch 23 Prozent der Stimmen erringen können. 1930 waren es für beide noch 8,5 und 1932 gar nur noch 2,2 Prozent. Die „dying middle“ (Larry Eugene Jones) stand für viele Interpreten für ein Auseinanderklaffen der politischen Pole und damit für einen existenziellen Substanzverlust der Demokratie.
Die Referenzgröße dieser hier nur kurz skizzierten These einer zunehmenden Demokratiefeindschaft sind die Wahlen zur Nationalversammlung. Sie gelten als Ausweis einer anfangs da gewesenen Begeisterung für die Republik, die in den darauffolgenden Jahren schnell abebbte. Und in der Tat ist es erklärungsbedürftig, weshalb 1919 fast drei Viertel der Wähler eine Staatsform wählen, die viele von ihnen 13 Jahre später geradezu angeekelt abstoßen. Die Forschung hat demgegenüber seit den 1990er Jahren den Blick eher auf längerfristige Wandlungen der Wählerschaft, ihrer Orientierungen und Mentalitäten gerichtet. Die Milieutheorie lieferte dafür die wichtigste Erklärungsfolie. Kurzfristig wirkende Momente wie die Weltwirtschaftskrise oder die normative Frage nach dem demokratischen Bewusstsein sind dabei in den Hintergrund getreten.
Aus dieser Perspektive stellen die Wahlen zur Nationalversammlung von 1919 eigentlich eine Ausnahme dar. Mit Berufung auf Karl Rohes Lagertheorie lässt sich die These vertreten, dass es sich hier im Grunde um die letzten Wahlen des Kaiserreichs handelte: Der langfristige Trend von rechts nach links hielt an, mit einem Liberalismus, der ein Fünftel oder mehr aller Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte, und Parteien, die zumeist Regionalparteien waren. Noch hatten sie außerhalb ihrer Hochburgen wenige Strukturen bilden können, noch hatten die radikalen Flügel keine organisatorische Kraft gewonnen. Die Wahlen zur Nationalversammlung zeigten auch deshalb noch einmal die ausgeprägte Stärke der Milieus, weil sie trotz des weitreichenden Wandels des Elektorats ähnliche Strukturen aufwiesen wie vor dem Ersten Weltkrieg. Die konservativen Parteien profitierten dabei vom Frauenwahlrecht, die SPD von der Herabsetzung des Wahlalters. Auch wenn viele dieser Kohorte nicht aus dem Krieg nach Hause gekommen waren: die jungen Arbeiter, deren Stimme erstmals gefragt war, wählten (zunächst) wie ihre Väter oder älteren Brüder (und die meisten Arbeiterinnen auch).
Das änderte sich mit der Republik. Ab 1920 kam es zu Verschiebungen innerhalb dieser Lager, kaum aber zwischen den Lagern. Das sozialistische Lager lag auch im November 1932 noch bei 37 Prozent (gegenüber 1920 bei knapp 40 Prozent), das katholische Lager bei 15 Prozent (1920 knapp 18 Prozent), das nationale Lager bei etwa 43 Prozent (1920 bei 37 Prozent).67 Rohes Argument lautet also, dass die Stabilität der sozialmoralischen Milieus, die zu politischen Lagern gerannen, weithin erhalten blieb, bei einer generellen, jedoch begrenzten Verschiebung nach rechts. Kennzeichnend ist jedoch links wie rechts ein Radikalisierungsprozess innerhalb der Lager, der sich gegen die traditionellen Parteien richtete. Sozialdemokratie, Liberale und Konservative erhielten Konkurrenz durch Kommunisten, Nazis und Interessenparteien. Wie sehr dies von den Akteuren als Abwendung von der Demokratie und nicht vielmehr als Radikalisierung der lagerspezifischen Erwartungen verstanden wurde, lässt sich allerdings nicht leicht sagen. Schwieriger als für die Linke, die sich schon im Krieg gespalten hatte, ist Karl Rohes Erklärung für die Rechte. Er rechnet Liberale, Konservative und Völkische zu einem Lager, was angesichts der Heterogenität der politischen Orientierungen nicht leicht überzeugt. Der Weg von einem linksliberalen großstädtischen Wähler zu einem kleinstädtischen NS-Wähler war weit. Zweifellos zu Recht aber verweist Rohe darauf, dass auch Liberalen der Weg in das sozialistische oder das katholische Lager schwerer fiel, als am Ende nationalsozialistisch zu wählen.
Tab. 7.1: Ergebnisse der Wahlen zur Nationalversammlung und zum Reichstag 1919–19331
1 Bei den Parteien nennt die linke Zahl die jeweils auf diese Partei entfallenen Stimmen in Millionen, die zweite Zahl den Prozentanteil. Die Zahlen in den grau unterlegten Kästchen nennen die Zahl der Abgeordneten zu Beginn der jeweiligen Legislaturperiode. Quelle: Modifiziert übernommen aus Ursula Büttner, Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933, Stuttgart 2008, S. 802f.
Eine Schwäche der einen wie der anderen Erklärung liegt in einer statischen Vorstellung der Parteien. Sie ist unhistorisch. Denn „Deutschnational“ bedeutete 1928 nicht mehr dasselbe wie 1920, und dies galt auch für die meisten anderen Parteien. In allen Parteien waren tiefgreifende Wandlungsprozesse vor sich gegangen, die, abgesehen von der sich radikalisierenden KPD, Teile von ihnen in die Republik hineinführten, was schwere innere Konflikte mit sich brachte. Dies galt besonders für die rechtsbürgerlichen, anfangs rundheraus antidemokratischen Parteien. Die DVP hatte sich unter der Führung Gustav Stresemanns von einer antirepublikanischen zu einer rechtsliberalen Weimar-Partei gewandelt, die einen außenpolitischen Versöhnungskurs fuhr, der bis nach Locarno führte (allerdings mit einem nach wie vor starken autoritären Flügel). In der DNVP-Reichstagsfraktion – die 1920 noch zum größten Teil monarchistisch eingestellt gewesen war – hatte sich seit 1924 eine Gruppe konservativer „Tory-Demokraten“ (wie sie sich selbst nannten) vorgenommen, eine konservative Republikpartei zu werden und so die Republik lieber konservativer zu machen, anstatt dieselbe abschaffen zu wollen.68 Die Wahlergebnisse für diese beiden Parteien 1924 und 1928 lassen sich auch als Ausweis einer stillen Republikanisierung großer Teile von Parteien und Wählerschaft deuten. Für viele Wähler spielte nicht so sehr das ideologische Konstrukt „Republik“ eine Rolle, sondern die Normalisierung des politischen und wirtschaftlichen Alltags. Immerhin reichte die Kompromissfähigkeit 1928 zu einer großen Koalition – wer hätte sich so etwas 1920 ausmalen können?
Freilich aber darf dieses Argument einer „Gewöhnung“ an die Republik – nicht so sehr aus programmatischen als vielmehr aus Alltagsgründen – die Grenzen nicht unterschlagen: die Abwanderung von Unzufriedenen in Interessenparteien, die 1928 ein Siebtel der Wähler ausmachte; die innerparteilichen Flügelkämpfe, die in der DNVP nach 1928 zu einer Machtübernahme Hugenbergs, zu einem Austausch ihrer Führung und einer grundlegenden Neuaufstellung im Zeichen der nationalistischen Radikalisierung führte. In der SPD wurden gerade in der Großen Koalition und im Zeichen der Weltwirtschaftskrise die Forderungen nach einer größer ausgeprägten sozialdemokratischen Handschrift immer stärker, die schließlich 1930 auch zum Ende der Großen Koalition führten. Schnöde Interessentenpolitik und intransigente Grundsatzpolitik trafen aufeinander.
Das leitet über zu der Frage nach dem frappierenden Erfolg der Nationalsozialisten in den Wahlen ab 1930. In nur vier Jahren, zwischen 1928 und 1932, wuchs die NSDAP von einer Splitterpartei mit 2,6 Prozent zur stärksten Partei im Reichstag, die 37,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte.69 Wie stabil dieses Votum war und wie sehr die NSDAP in der Lage gewesen wäre, diese Wähler auf Dauer an sich zu binden, muss offenbleiben. Die Volatilität war hoch, und im November 1932 hatten die Nationalsozialisten bereits annähernd ein Viertel der Wählerstimmen, die sie erst wenige Monate zuvor gewonnen hatten, wieder eingebüßt. Der Erfolg kam jedoch nicht aus dem Nichts. Bereits davor hatten die Nationalsozialisten in einigen kleineren nord- und ostdeutschen Ländern Erfolge verzeichnen können. In Thüringen hatten sie 1929 über 11 Prozent der Stimmen errungen und waren hier schon so stark wie DDP und DVP zusammen.70 Die Weltwirtschaftskrise hat demnach politische Orientierungen, die sich bereits vorher zeigten, nur zugespitzt.
Es hat mit der Karriere der NSDAP aus der Provinz zu tun, dass schon die Zeitgenossen, allen voran der Soziologe Theodor Geiger, den Erfolg der Nationalsozialisten aus der „Panik im Mittelstand“ im Gefolge der Weltwirtschaftskrise erklärten.71 „Extremismus der Mitte“ hat Seymour Lipset dies genannt. Insbesondere Jürgen Falter hat auf der Basis komplexer (und manchmal durchaus riskanter) statistischer Berechnungen gezeigt, dass dies nur die halbe Wahrheit ist.72 Dass die habituellen Nichtwähler und die Wähler von Interessen- und Regionalparteien in Scharen zur NSDAP wanderten, dass die Nazis vor allem in protestantischen ländlichen Gegenden früh und nachhaltig erfolgreich waren (darunter auch in ehemals linksliberal dominierten Regionen wie in Schleswig-Holstein), war seit Langem bekannt. Falter konnte aber auch zeigen, dass nicht nur liberale Eliten, sondern auch Arbeiter, in einzelnen Regionen sogar unzufriedene katholische Mittelständler und Bauern die Nazis wählten. Bei den Juliwahlen 1932, als die NSDAP 37 Prozent der Stimmen erhielt, wurde sie seinen Berechnungen zufolge auch von 27 Prozent der Arbeiter gewählt – weniger von den klassischen Industriearbeitern in Bergbau und Großindustrie als denen in kleineren Betrieben und auf dem Land.73 Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Die NSDAP konnte in allen Lagern wildern und insofern als erste Partei die Milieugrenzen transzendieren. Insofern bezeichnete Falter mit Recht die NSDAP als eine „Volkspartei des Protests“.
Wichtig war bei Falter die Beobachtung der „Zwischenwirte“, als die insbesondere die Interessen- und Protestparteien fungierten, weil sie zunächst Wähler aus etablierten Parteien anzogen, diese dann aber wieder an die radikaleren Nazis verloren. Wie wichtig war also die Milieuverankerung? Gute Argumente sprechen dafür, diese nicht zu überschätzen: Es gab auch viele, die zwar Arbeiter oder katholisch waren, sich aber keinem Milieu zuordnen ließen, sei es, dass sie als Zugezogene keinen Anschluss fanden, sei es, dass eine solche Zugehörigkeit für sie nur ein Zuordnungsmerkmal unter mehreren darstellte.74 Demgemäß blickt die Milieutheorie auf die Kernbelegschaft; das Problem sind aber vielleicht eher die Randständigen, die zwar aus sozialstrukturellen Gründen dazuzurechnen wären, aber aus Gründen der Soziabilität nicht. Diese Überlegung zielt nun nicht mehr primär auf die abnehmende Bindungskraft von Milieus; sie nimmt vielmehr die Dynamik der Weimarer Gesellschaft in den Blick, die neue Lebensformen und biografische Herausforderungen produzierte: die ehemaligen Militärs, die sich nun neue Berufe suchen mussten; die jungen Frauen, die berufstätig wurden; die Menschen, die vom Land in die Stadt kamen; die kleinen Händler und Handwerker, die in der Wirtschaftskrise vor dem Ende standen; die Bauern und Landarbeiter, die von der Agrarkrise in ihrem Selbstverständnis erschüttert wurden. Und die vielen, bei denen sich auf den ersten Blick nicht viel änderte, die aber getrieben waren von der Angst, dass sich bald vieles zum Schlechteren wenden könnte. Die Weimarer Gesellschaft war hochdynamisch, und das schwächte die traditionalen Selbstverständlichkeiten.
Tab. 7.2: Reichsregierungen 1918–1932 mit ihren wichtigsten Ministern
Quelle: Ursula Büttner, Weimar. Die überforderte Republik 1918–1933. Leistung und Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Stuttgart 2008, S. 810–812.
Das heißt nun aber keineswegs, dass diejenigen, die empfänglich für die nationalsozialistische Botschaft waren, gewissermaßen außerhalb der Gesellschaft standen. Lokalstudien haben frühzeitig ermittelt, dass die NSDAP keine Partei der Desperados und gesellschaftlichen Außenseiter war, als die ihre Gegner sie gerne hinstellten, sondern dass ihre Wähler aus der Mitte der Gesellschaft kamen. Sie bediente nicht nur den Nationalismus, sondern auch die Sehnsucht nach Homogenität und Zusammengehörigkeit, ebenso wie sie sich aggressiv gegen diejenigen wandte, die als nicht zugehörig gebrandmarkt wurden.75 Die Nationalsozialisten stützten sich zwar maßgeblich, aber nicht ausschließlich auf ein einziges Milieu oder Lager. Vielmehr propagierten sie deren Überwindung im Zeichen der deutschen Volksgemeinschaft, und damit bedienten sie auch eine tiefe Enttäuschung vieler mit ihren politischen Eliten. Die darin liegende Verheißung sozialer und nationaler Art sprach nicht allein diejenigen an, die sich dem nationalen Lager zugehörig fühlten – das freilich die entscheidende Wählerbasis für die Nazis darstellte.
Jenseits von und gewissermaßen „über“ den herkömmlichen Milieuorientierungen – sozialistisch, bürgerlich-liberal, katholisch, konservativ – war die nationale Lagerorientierung am dominantesten und vor allem am stabilsten. Ob damit auch die Frage nach „Republik oder Diktatur“ gestellt war, steht auf einem anderen Blatt. Mehr als um die Staatsform, so scheint es, ging es um Fragen wie Gerechtigkeit, Zugehörigkeit und ein starkes Bedürfnis nach Homogenität, gerade im Angesicht der Zerrissenheitserfahrung. Und für diese wurden die Parteien und ihre begrenzte Kooperationsfähigkeit verantwortlich gemacht.