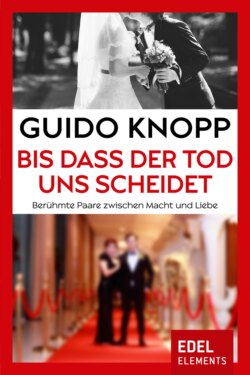Читать книгу Bis dass der Tod uns scheidet - Guido Knopp - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLIEBE IST PRIVATSACHE, SOLLTE MAN MEINEN. ABER GILT DAS AUCH FÜR JENE MÄNNER UND FRAUEN, die an der Spitze eines Staates stehen? Ihr Arbeitsalltag wird von öffentlichen Auftritten und Entscheidungen bestimmt – ein Knochenjob, der großen persönlichen Rückhalt fordert. Doch wie viel privates Eheleben haben und hatten sie: die Clintons, die Grimaldis, die Goebbels, die Windsors oder Soraya und der Schah? Für sie alle wurde der »Bund fürs Leben« alles andere als alltäglich.
In ihrem Liebesleben erscheinen uns die Großen und Mächtigen zumeist näher und menschlicher als in anderen Bereichen: Hingabe, Leidenschaft, gegenseitige Bewunderung, aber auch Enttäuschungen, Fehltritte, Eifersucht – das sind Gefühle, die vielen von uns vertraut sind. Auch die bitteren Erfahrungen, wenn Träume zerplatzen oder Partner sich fremd werden. Die Gewalt solcher Gefühle erfasst alle, selbst die scheinbar unangreifbar Mächtigen eines Staates. Für viele Staatsführer ist das ein Dilemma, denn sie wollen als bedacht und überlegt gelten, aber gleichzeitig nicht als gefühlskalt und herzlos erscheinen – Liebe ja, aber sie soll die Amtsausübung auf keinen Fall tangieren. Die Öffentlichkeit bekommt deshalb in der Regel ritualisierte Auftritte und die Fassade eines inszenierten Privatlebens zu sehen. Nur selten hebt sich der Vorhang ein wenig – am ehesten dann, wenn Ehen auseinander brechen. Und allzu oft wird dann deutlich, dass das Bild vom Traumpaar nur ein Zerrbild war. Trennen lassen sich Liebesleben und Amtsführung, privates Handeln und öffentliche Auftritte jedenfalls nicht – das zeigt die Geschichte der fünf Ehepaare überdeutlich. Liebe und Macht sind bei den Obersten eines Staates stets miteinander verschränkt. Was passieren kann, wenn eine Liebes- zur Staatsaffäre gerät, zeigt das Beispiel der Clintons. Bill Clinton, seinerzeit der mächtigste Mann der Welt, musste vor der Öffentlichkeit bekennen, dass er eine Affäre mit seiner pummeligen Praktikantin gehabt und die Wahrheit über diese peinliche Angelegenheit monatelang verschleiert hatte. In einer beispiellosen Schlammschlacht wurden äußerst pikante Details publik. Hillary war binnen weniger Wochen von einer zwar nicht geliebten, aber doch respektierten First Lady zur wohl meistgedemütigten Frau Amerikas geworden. Und wie so oft hatte alles romantisch begonnen: Hillary und Bill hatten sich an der juristischen Fakultät in Yale Hals über Kopf ineinander verliebt. Die begabte Juristin stellte ihre Karriere hintan und folgte ihrem Freund ins verschlafene Arkansas, wo er der Shooting-Star der politischen Bühne wurde: Mit 32 war Bill Clinton Gouverneur – auch weil seine Frau sich auf die ungeliebte Rolle der Landesmutter einließ. Ein Töchterchen krönte das Eheglück. Die Clintons schienen zu Höherem berufen, und 1992 folgte der Triumph: Clinton zog als 42. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus in Washington ein. Das Bild des kometengleichen Aufstiegs war freilich bereits zu diesem Zeitpunkt getrübt: Immer wieder hatten sich junge Damen zu Wort gemeldet, denen Clinton mehr als landesväterliche Liebe entgegengebracht hatte. Hillary aber stärkte ihrem Mann stets den Rücken – und blieb dennoch die Unbeliebtere von beiden. Gegenüber dem Sonnyboy an ihrer Seite hatte sie immer gegen den Ruf als unterkühlte und machtfixierte Frau ankämpfen müssen. Auch in Washington änderte sich daran nicht viel. Hillary galt als Bills machtbewusste Souffleuse. Mochte Clintons Regierungszeit politisch überaus erfolgreich verlaufen, drohten doch die privaten Belange dem Paar zum Verhängnis zu werden. Immer wieder hatten sich die Clintons Ermittlungsverfahren zu stellen, zunächst wegen dubioser Immobiliengeschäfte und Vetternwirtschaft, später wegen der außerehelichen Affären des Präsidenten. Im Januar 1998 schließlich der Skandal, der das Fass zum Überlaufen brachte: Die Lewinsky-Affäre kostete Clinton beinahe sein Amt, vor allem aber seinen Ruf. Trotzdem stand seine Frau weiterhin hinter ihm. Sie kämpfte wie eine Löwin für ihn – und ihre Ehe. So ging sie selbst – zumindest in der Öffentlichkeit – gestärkt aus dem Skandal hervor. Ihr kontrolliertes Verhalten und ihre Treue brachten ihr Respekt ein. Hillary Clinton ist die erste ehemalige First Lady, die erfolgreich für ein politisches Spitzenamt antrat: Im Jahr 2000 gewann sie die Wahl um den New Yorker Sitz im Washingtoner Senat. Die Geschichte lehrt, dass altvertraute Klischees im Praxistest mitunter versagen: Frauen seien weniger analytisch als Männer? Was um Himmels Willen hat Hillary Clinton dann davon abgehalten, »kurzen Prozess« mit Bill zu machen? Eine Scheidung hätte wohl das politische Aus für den US-Präsidenten bedeutet. Doch es wäre vermutlich auch das Ende von Hillarys Träumen gewesen: von der eigenen politischen Karriere – und nicht zuletzt davon, die erste Präsidentin der US-Geschichte zu werden. Ähnlich kompliziert scheint der Fall bei der wohl größten Ehetragödie in Großbritannien zu liegen: Der unausgesprochene Gegensatz zwischen Kalkül und Liebe führte zu jenem Desaster, das die älteste konstitutionelle Monarchie der Welt ins Wanken zu bringen drohte. Lady Diana Spencer liebte, ja vergötterte den Prinzen von Wales. Charles dagegen – von der Königin, der Öffentlichkeit und seinem fortgeschrittenen Alter zunehmend unter Druck gesetzt – sah in ihr vor allem die Frau, mit der er den Fortbestand der Windsor-Dynastie sichern konnte: ein passendes, anständiges Mädchen, tugendhaft, »unberührt«, protestantisch, adlig, hübsch und formbar. Weder war sie übermäßig fromm noch besonders rebellisch und dazu nicht sonderlich begabt. Kurzum: In den Augen der Königsfamilie war Diana genau die Richtige! Charles selbst befielen freilich Zweifel. Einem engen Freund vertraute er an: »Ich wünsche so sehr, das Richtige für dieses Land und für meine Familie zu tun. Aber manchmal erschreckt mich der Gedanke, ein Versprechen zu geben, das ich dann vielleicht ein Leben lang bereue.« Als die Presse im Herbst 1980 von der Beziehung Wind bekam, wurde der Druck unerträglich. Die Nation war begeistert und die Sache bekam eine ungeheure Eigendynamik. Doch auch Charles’ nicht heiratsfähige Geliebte Camilla Parker Bowles drängte ihn, Diana zu ehelichen, weil sie, wie ihr Schwager meinte, »Diana für dumm oder für verrückt hielt und deshalb glaubte, dass er sie leicht manipulieren könnte«. Letztlich war Charles wohl selbst davon überzeugt, dass Diana die Richtige sei, um Dynastie und Krone zu sichern. Einen kleinen Vorgeschmack auf den royalen Ehealltag der beiden bot die Pressekonferenz anlässlich der Verlobung, die am 24. Februar 1981 stattfand: Ein nicht sonderlich einfallsreicher Journalist fragte, ob das Paar verliebt sei. »Aber sicher!«, gab Diana mit einem vorwurfsvoll-koketten Lächeln zur Antwort. »Was auch immer Liebe heißen mag«, ergänzte Charles zögerlich. Spätestens jetzt hätten bei der jungen Braut alle Alarmglocken läuten müssen. Eine große Liebesgeschichte, noch dazu mit dem begehrtesten Junggesellen des Commonwealth, wird üblicherweise nicht mit solcher Zurückhaltung verkündet. Obwohl Diana selbst bereits eine Reihe von Hinweisen auf das Verhältnis ihres Verlobten mit Camilla hatte, fand die Traumhochzeit in der berühmten Londoner St. Paul’s Cathedral statt. Diana wollte einfach daran glauben, dass sie die Konkurrentin schon noch auszustechen im Stande wäre. Fernab jeder Realität hatte die Presse sie zum Aschenputtel stilisiert. »Das ist der Stoff, aus dem Märchen sind«, sagte der Erzbischof von Canterbury am Hochzeitstag der beiden. Tatsächlich war es der Stoff für eine in jeder Hinsicht arrangierte Ehe, die schon bald an all jenen Illusionen zerbrechen sollte, mit denen sie einst geschlossen worden war. Sie endete in einem Desaster aus Seitensprüngen, Schmierengeschichten, Scheidung – und keineswegs in jener royalen Lovestory, die das britische Königshaus, die Presse, ja die ganze Welt sehen wollten. Als Diana bei einem Autounfall in einem Pariser Seine-Tunnel ums Leben kam, wurde sie vollends zum Mythos, zur »Königin der Herzen«.Ihr unglückliches Leben als Prinzessin mochte einen tragischen Ausgang gefunden haben – ihren Dienst an der Windsor-Dynastie hatte Diana jedoch erfüllt. Unabhängig von Charles’ Zukunft steht der Fortbestand des Herrschergeschlechts dank der beiden Söhne William und Harry nicht infrage. Eigener Nachwuchs ist auch bei Erbmonarchien ohne kritische Öffentlichkeit und überkommene Moralvorstellungen das unabänderliche Erfordernis. So etwa auch beim Schah von Persien, dessen Beziehung zu Soraya wie ein Märchen aus 1001 Nacht begann. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Schah sah nur ein einziges Foto der sechzehnjährigen Soraya Esfandiary und sagte: »Die soll es sein!« Die Schöne stammte aus vornehmem Hause – ihr Vater war ein persischer Fürst, die Mutter eine Deutsche. Mit achtzehn Jahren wurde sie die zweite Frau des persischen Herrschers und Kaiserin auf dem Pfauenthron. Doch die Verbindung schien von Anfang an fluchbeladen: Soraya erkrankte vor dem großen Tag schwer an Typhus, sodass die Hochzeit mehrmals verschoben werden musste. Die Märchenkaiserin wurde zwar insbesondere für deutsche Frauen eine Kultfigur – eine Art Ersatzmonarchin, die Lady Di der fünfziger Jahre, doch plagten Soraya von Anfang an böse Vorahnungen. Zwischen ihr und dem Schah entbrannte aufrichtige Liebe, und Berichte von engen Freunden des Paares sowie private Fotos aus dem Nachlass der Kaiserin zeugen von einer innigen Beziehung. Doch der kaiserliche Traum schien fast vorbei, noch bevor er begonnen hatte. Kurz nach der Hochzeit kam es zum Streit mit den Westmächten um iranisches Öl, und das Paar floh vor den Unruhen in Teheran ins Exil. Nur wenige Tage später wurde der Schah mithilfe des amerikanischen Geheimdienstes CIA auf den Thron zurückgeholt. Soraya spürte, wie die Krise ihre Beziehung festigte. Doch das Traumpaar blieb kinderlos – sieben lange Jahre. Schweren Herzens verstieß Schah Resa Pahlavi aus diesem Grund seine Frau. Es folgte die Scheidung aus Staatsräson, denn der Pfauenthron benötigte einen Nachfolger. Sorayas Abfindung betrug einige Millionen Dollar – und Tresore voller Schmuck. Der Preis, den sie zahlte, war jedoch weitaus höher: Nur sechs Monate später verlobte sich Schah Reza neu, während Soraya bis zu ihrem Tod nicht mehr heiratete. Die neue Frau des persischen Kaisers schenkte dem Land den heiß ersehnten Sohn. Einen Thronfolger besaß der Schah nun zwar, aber keinen Thron mehr, denn während der islamischen Revolution musste er 1979 ins Exil flüchten. Kaum bekannt ist, dass der Schah sich in jungen Jahren für eine andere Traumprinzessin begeisterte: Als Mittzwanziger ging er mit der Leinwand-Königin Grace Kelly aus. Für beide waren diese Treffen wohl nicht mehr als kleine Flirts. Ob Grace Kellys Begeisterung für die Welt des Royal en aus dieser Begegnung resultierte? Grace Kelly hatte das Werben Unzähliger zurückgewiesen – nicht zuletzt, um den Vorstellungen ihrer Eltern zu genügen. Erst als Fürst Rainier von Monaco, ein echter Prinz, um ihre Hand anhielt, wurde sie schwach. Die Hochzeit kam dann so rasch, dass selbst enge Freunde erstaunt waren. Mehr als zwölfhundert Menschen aus fünfundzwanzig Nationen drängten sich im Frühjahr 1956 in der St.-Charles-Kathedrale von Monte Carlo. Der Bräutigam trug Uniform, die Braut war von ihrem letzten Arbeitgeber eingekleidet worden – der Filmfirma MGM. Manchen mutete die ungewohnte Begegnung zwischen traditionsbeladenem Hochadel und der flatterhaften Welt des Showbusiness höchst seltsam an. Doch die Vermählung von Hollywood und hochwohlgeborener Aristokratie war eigentlich nur folgerichtig: Denn hier verschmolzen zwei Traumwelten, die einer Vielzahl von Menschen Raum für Illusionen boten. Aus Grace Kelly wurde Gracia Patricia von Monaco, und im Fürstentum an der Côte d’Azur lebte sie, was sie auf der Leinwand gespielt hatte: Gattin und Mutter. Der Filmstar wandelte sich zur Fürstin der oberen Zehntausend – und Monaco zum neuen Mekka des internationalen Jet-Set. Wie immer spielte Grace Kelly auch diese Rolle perfekt: Sie schenkte dem Fürstentum den lang ersehnten Thronfolger; sie brachte Glamour und Stil in das vermuffte Adelshaus, und noch nie war eine Fürstin so beliebt wie sie. In Wahrheit war auch ihr Leben von Problemen überschattet, denn Glamour ist nicht gleichbedeutend mit Glück: Sprachschwierigkeiten, das strenge Hofprotokoll und ein Mann, der ihr lange fremd blieb, machten ihr das Leben schwer. Sie versuchte sich nichts anmerken zu lassen, doch der Gedanke an Scheidung war immer da. Erst am Ende fand das Ehepaar zu jener Harmonie, nach der sich Grace Kelly so sehr gesehnt hatte. Ihr Tod war wie ihr Leben: spektakulär und rätselhaft. Im September 1982 stürzte sie mit dem Auto eine Serpentine hinab. Ihre jüngste Tochter, Prinzessin Stephanie, überlebte den Unfall schwer verletzt. Gracia Patricia ist bis heute ein Mythos, der amerikanische Traum eines zur Prinzessin geadelten einfachen Mädchens. Ganz anders ist das Bild, welches das Erste Paar des Dritten Reiches von sich entwerfen ließ: Joseph und Magda Goebbels waren keine Identifikationsfiguren und sahen sich nicht durch unabhängige Medien herausgefordert. Sie standen nicht an der Spitze des NS-Staates, gaben aber doch das Paradepaar, denn Hitler hatte sich bis zu seinen letzten Stunden im Bunker Ehelosigkeit auferlegt. Nicht nur, weil geregelte Familienverhältnisse bei anderen Spitzen-Nazis Mangelware waren, stilisierte der »kleine Doktor« seine Familie zum Vorbildidyll für die Volksgenossen. Es mag schwer fallen, Verführern und Verbrechern vom Schlage eines Joseph Goebbels menschliche Gefühle wie Liebe zuzusprechen, doch die Tagebücher der ersten gemeinsamen Jahre erwecken genau diesen Eindruck – auch wenn Besitzerstolz und Selbstbestätigung für ihn immer dominant blieben. In jedem Fall diente seine Ehe mit der geschiedenen Frau eines reichen Industriellen, die 1931 geschlossen wurde, von Anfang an politischen Zwecken. Magda Goebbels war es, die ihrem Joseph überhaupt erst die Manieren beibrachte, die ihn salonfähig machen sollten. Mit Hitlers Machtergreifung und der Ernennung Goebbels’ zum Reichspropagandaminister schienen beide ihr Ziel erreicht zu haben: Sie gefielen sich in ihren neuen, staatstragenden Rollen. Doch nach anfänglicher gemeinsamer Begeisterung zeigte die Beziehung immer mehr Risse: Joseph Goebbels wollte seine Frau bevormunden, sie selbst aber strebte eine unabhängige Rolle an. Er ging unablässig fremd und hielt das für sein gutes Recht als Familienpatron, sie wiederum unterhielt engste Beziehungen zu Hitler. Fast scheint es, als sei die Ehe der Goebbels von Anfang an eine Dreiecksbeziehung gewesen. Lange vor Kriegsbeginn war die Ehe zerrüttet. Nur dank der Interventionen Hitlers war eine Trennung und damit das Zerplatzen der Propagandablase zu verhindern. Die nationalsozialistische Ideologie bildete den Kitt, als Liebe, Zuneigung und Leidenschaft schon lange kein Fundament der Ehe mehr waren. Auf welch brüchiger Grundlage die Beziehung von Magda und Joseph Goebbels in Wahrheit fußte, sahen die Deutschen erst, als sich das Paar bei Kriegsende das Leben nahm und seine sechs Kinder mit in den Tod riss. Drei Monarchenpaare, ein Präsidentenpaar und ein Propagandapaar, das einer unmenschlichen Ideologie einen menschlichen Schein geben sollte, und dennoch: »Bis dass der Tod uns scheidet« – dieser Vers aus der kirchlichen Trauzeremonie gilt für jede der fünf Ehen in besonderer Weise. Alle Verbindungen prägten das Leben der Partner nachhaltig; niemandem gelang es, mit jener Beziehung endgültig abzuschließen, die durch Medien und Öffentlichkeit berühmt geworden war. Das offenbart zugleich die hohe moralische Messlatte, die die Öffentlichkeit an ihre Leit- und Vorbilder anzulegen pflegt – bisweilen Maßstäbe, denen nicht einmal so mancher »Normalsterbliche« genügen kann. Aber das ist ein Merkmal prominenter Paare: Ihre Ehen dienen uns nur allzu oft als Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte nach Glück und Perfektion. Dabei sind auch Personen an der Spitze eines Staates in ihrem Privatleben zumeist keine Ausnahmeerscheinungen, sondern ganz normale Menschen, zumal für ihre Ehepartner. Das Beziehungsleben der fünf Paare wurde durch die Öffentlichkeit, in der sie standen, zu einem spannenden Geflecht aus alltäglichen und einmaligen, glücklichen und tragischen Momenten. Jede ihrer Geschichten hat Spuren hinterlassen. Die folgenden Kapitel berichten davon.