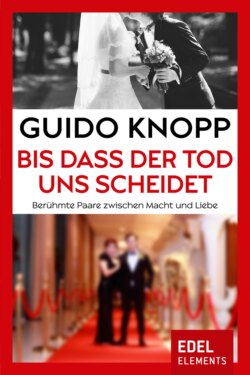Читать книгу Bis dass der Tod uns scheidet - Guido Knopp - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDIE MÄNNER HATTEN AN JENEM AUGUSTABEND 1998 DIE ORDER, DEN HINTEREINGANG ZU NEHMEN. Obwohl es längst dunkel geworden war, bestand die Gefahr, gesehen zu werden, denn jede Bewegung in der Pennsylvania Avenue 1600 in Washington wurde von den Journalisten genauestens registriert. Bob Bittmann war kein bisschen nervös. Den lang gedienten Juristen konnte so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Eine Situation wie heute allerdings hatte auch er noch nie erlebt. Gemeinsam mit seinem Kollegen wurde er durch die ausgestorbenen Gänge des Weißen Hauses geführt. Vor dem so genannten Map Room, dem Kartenraum des Weißen Hauses, waren sie am Ziel angekommen. »Es war sehr ruhig«, erinnert sich Bittmann in einem ZDF-Interview, »und wir standen einfach da und warteten, dass uns jemand hereinrief.« Als sich die Tür schließlich öffnete, bot sich dem Mitarbeiter des Sonderermittlungsausschusses eine der ungewöhnlichsten Szenen seiner Laufbahn. Anwesend waren ein Arzt, ein Anwalt und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz freundlich habe Bill Clinton sie begrüßt, ja sich sogar namentlich vorgestellt, erinnert sich Bittmann. »Der Präsident setzte sich und machte den rechten Arm frei. Dann legte der Doktor eine Druckmanschette an.« Clintons Anwalt wollte die sichtlich angespannte Stimmung ein wenig auflockern und wagte einen Scherz. Schon immer habe er einen Klienten in einer solchen Situation sehen wollen, schmunzelte er. »Der Präsident saß da ... und sah ihn einfach nur an. Er fand es überhaupt nicht komisch.«
Nachdem die Blutprobe genommen war, verließen die Beamten das Weiße Haus. In ihrer Tasche hatten sie einen wenige Milligramm schweren Beweis. Einen, der sich nicht mit Lügen wegreden ließ. Denn die DNA-Analyse würde übereinstimmen mit den verräterischen Spuren auf dem peinlichsten aller Beweisstücke in der Affäre Clinton-Lewinsky – jenem blauen Kleid, das die verliebte Praktikantin Monica bei einem Schäferstündchen mit dem Präsidenten getragen hatte. Was Bill Clinton am Abend jenes 3. August 1998 dachte und fühlte, hat er nie verraten. Doch er muss gewusst haben, dass nun alles ans Licht kommen würde. Dass die Welt erfahren würde, dass er gelogen hatte. Und dass es seine Frau Hillary erfahren würde. Zwei Wochen später, am 15. August, war es so weit. Am Morgen gestand Clinton seiner Frau den Seitensprung mit Monica Lewinsky, zwei Tage später trat er spätabends mit einer Fernsehansprache vor die Nation. Er habe eine »unangemessene Beziehung« gehabt, so die verklausulierte Formulierung eines sichtlich verunsicherten Präsidenten. Natürlich hatten viele es längst vermutet, aber das öffentliche Bekenntnis, vor allem die Art und Weise, in der es erfolgte, erniedrigte den mächtigsten Mann der Welt in einem kaum zu ertragenden Ausmaß.
Am Morgen des 15. August 1998, es war ein Samstag, weckte ich nach einer elenden, schlaflosen Nacht meine Frau, um ihr die Wahrheit über Monica Lewinsky und mich zu erzählen. Sie sah mich an, als hätte ich ihr einen Schlag in den Magen versetzt. ■ Bill Clinton, »Mein Leben«
Als sich die Entrüstung der prüden Hälfte Amerikas und das Erstaunen der übrigen Welt wieder gelegt hatten, schnurrte die Geschichte allerdings auf einen Gehalt zusammen, der wohl banaler kaum hätte sein können: Ein attraktiver Präsident und eine verknallte Praktikantin hatten sich im Oval Office aufgeführt wie zwei Teenager auf einem Parkplatz. Der so genannte Starr-Report, der minutiöse Bericht von Sonderermittler Kenneth Starr über die präsidialen Verfehlungen, enthüllte Details, die die meisten Amerikaner nicht einmal von ihren besten Freunden wussten und viele auch gar nicht hatten wissen wollen. Da war die Rede von Zigarren in ungewöhnlicher Verwendung, von »Verzögerungen« im Zeitplan des Präsidenten, weil dieser noch im Oval Office »zu tun« hatte, und vielem mehr. Die penible Auflistung Starrs rief bei den meisten Menschen weltweit eher amüsiertes Schmunzeln hervor. Und trotzdem war diese Affäre Anlass für eine Ermittlung, die Millionen Dollar kostete und für viele Monate wichtige politische Ereignisse aus den Schlagzeilen verdrängte. Das Ansehen einer der ältesten Demokratien, die in der würdelosen Debatte über das Sexleben ihres Präsidenten auf das Niveau einer Bananenrepublik sank, wurde nachhaltig geschädigt. Bill Clinton hingegen ging aus dieser peinlichen Affäre erstaunlicherweise weitgehend unbeschadet hervor. Das Amtsenthebungsverfahren, dem er sich als zweiter Präsident in der Geschichte der USA stellen musste, wurde eingestellt. Einer Wiederwahl, die ihn mit Volkes Stimme konfrontiert hätte, konnte er sich nach zwei Legislaturperioden ohnehin nicht mehr stellen. Heute ist der Elder Statesman Bill Clinton einer der angesehensten Männer der Welt. Seine Redehonorare sind unerreicht, seine Autobiographie »Mein Leben« verkaufte sich in Millionenhöhe. Bis zum heutigen Tag jedoch weiß niemand die Reaktion einer Person wirklich einzuschätzen: jener Frau, die auf unvorstellbare Art und Weise vor der Weltöffentlichkeit gedemütigt wurde und doch zu ihrem Mann stand und immer noch steht – Hillary Rodham Clinton.
Als ich ihn zum ersten Mal im Studentenclub sah, zog er gerade, umringt von anderen Studenten, die ihm gebannt zuhörten, über irgendetwas vom Leder. Im Vorübergehen hörte ich ihn sagen: »... und obendrein bauen wir auch die größten Wassermelonen der Welt an!« Entgeistert wandte ich mich an meinen Begleiter: »Wer ist denn das?« – »Oh, das ist Bill Clinton«, antwortete er. »Er stammt aus Arkansas – und er spricht über nichts anderes.« ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Wie sie einander begegnet sind, haben die Clintons wohl schon tausendmal erzählt. Im Herbst 1970 studierte Hillary Rodham durch dicke Brillengläser juristische Texte in der Bibliothek der Yale-Universität. In der Vorhalle unterhielt sich ein hoch gewachsener Student mit einem Kommilitonen. »Doch Bill war anscheinend nicht ganz bei der Sache«, erinnert sich Hillary Clinton in ihrer Autobiographie »Gelebte Geschichte«. »Ich bemerkte, dass er immer wieder zu mir herübersah. Nach einer Weile erhob ich mich von meinem Platz, ging zu ihm hinüber und sagte: ›Ehe du mich noch länger anstarrst und ich noch länger zurückstarre, können wir uns auch gleich vorstellen. Ich bin Hillary Rodham.‹ Das war’s. Bill war im ersten Moment so perplex, dass ihm sein Name nicht einfiel.« Bill Clinton bestätigt diese Geschichte: »Sie strahlte so eine Stärke und Selbstbeherrschung aus, wie ich es erst bei wenigen Menschen erlebt habe«, schwärmt er in seinen Erinnerungen. Wenige Tage später begegneten sich die beiden wieder, als Hillary auf dem Weg war, sich für Vorlesungen des nächsten Semesters einzuschreiben. Bill Clinton wollte die günstige Gelegenheit nutzen, dass ihm das Mädchen in der Warteschlange vor dem Schalter nicht entwischen konnte, und begleitete sie. Vorn angekommen, sah er sich dann allerdings erneut in einer peinlichen Situation. Der Angestellte fragte Clinton, was er denn hier wolle, er habe sich doch bereits am Morgen registrieren lassen. »Ich lief knallrot an, und Hillary bedachte mich mit ihrem schallenden Lachen«, gibt Clinton heute zu. Wenig später waren Hillary und Bill unzertrennlich. Bills Freunde berichten, sie hätten schnell gespürt, dass sich zwischen den beiden etwas Ernsteres anbahnte. Clinton hatte zuvor mehrere Gespielinnen gehabt, aber keine von ihnen war sonderlich lange geblieben. »Bill erzählte uns: Ich habe eine unglaubliche Frau kennen gelernt, ich muss sie euch vorstellen«, erinnert sich Brooke Shearer, eine Freundin aus jenen Tagen, in einem ZDF-Interview. Er habe dabei so einen ganz besonderen Ton angeschlagen, der die anderen sofort habe aufhorchen lassen. Einige von Bills Kommilitonen waren ziemlich verwundert, dass er sich ausgerechnet für die optisch eher unaufdringliche Hillary entschieden hatte. Selbst für die frühen siebziger Jahre machte Hillary einen etwas verwahrlosten Eindruck. Lange Röcke, lange Haare und dazwischen ein sackartiges Etwas, das eine Bluse oder ein Pullover sein konnte, und fertig war die Ausgehgarderobe. Bill sah seinerzeit freilich selbst wie eine Mischung aus Wischmopp und Wikinger aus. Ihm schien der Stil seiner neuen Freundin zu gefallen.
Auch Hillarys Umgebung merkte recht bald, dass Bill Clinton für die junge Frau etwas ganz Besonderes war. Die Mutter einer Freundin nahm sie beiseite, nachdem sie die sonst so konzentrierte und ernste Hillary eine Zeit lang beobachtet hatte: »Tu, was du willst, aber lass Bill auf keinen Fall entwischen. Ich habe noch keinen Mann kennen gelernt, der dich zum Lachen bringen konnte.« Diese Beziehung war mehr als eine Romanze. Bill Clinton hatte eine Partnerin gefunden, an der er sich messen konnte. »Sie war eine intellektuelle Herausforderung für ihn«, sagt Brooke Shearer. Und Hillary erlag seinem Charme, freute sich wie ein kleines Mädchen über jede Überraschung, die Bill in ihren sonst so wohlgeordneten Alltag brachte, auch wenn sie zunächst die Souveränere und Zurückhaltendere zu sein schien. »Das Erste, was mir damals an ihm aufgefallen ist, waren seine schmalen Hände. In unseren ersten Jahren konnte ich mich stundenlang allein am Anblick seiner Finger beim Blättern in einem Buch ergötzen«, erzählt sie in ihren Memoiren. Die Kommilitonen amüsierten sich über die dauerturtelnden Freunde, die ihre Finger nur dann voneinander lassen konnten, wenn sie mit Händen und Füßen über irgendeine Frage des öffentlichen Interesses debattierten. Beide waren nahezu politikversessen, fanden in Grundsatzdebatten und bei konstruktiven Streitgesprächen kein Ende. »Politik ist ihrer beider Leben«, sagt Dick Morris, ihr späterer Berater. »Es ist wie bei einem Ehepaar, das ein chinesisches Restaurant führt und darüber wohnt. Es füllt ihr ganzes Leben aus.« Bill Clinton hatte schon früh eine klare Vorstellung davon gehabt, wie die Frau an seiner Seite sein sollte. Seine Jugendfreundin Carolyn Yeldell Staley erinnert sich, dass er einmal zu ihr gesagt hat: »Ich brauche wahrscheinlich eine Frau, die ihre Arbeit genauso liebt wie ich.« Hillary schien diesem Bild optimal zu entsprechen. Und sie fand in ihm einen Partner, der ihr das Wasser reichen konnte und gleichzeitig bar jeglichen Vorurteils gegenüber den intellektuellen Fähigkeiten von Frauen war. Das war nämlich nicht gerade üblich im Amerika der frühen siebziger Jahre.
Mit ihrem Studium hatten beide überhaupt keine Schwierigkeiten, obschon sie eher seltene Gäste in den Vorlesungen waren. Beide waren und sind juristische Naturtalente, deren Energie und Begabung erheblich weiter reichten als die vieler ihrer Kommilitonen. Nachdem Hillary 1972 ihr Examen absolviert hatte, unternahmen die beiden eine Reise nach Europa. »Und im Dämmerlicht am Ufer des Lake Ennerdale im wunderschönen Lake District fragte Bill schließlich, ob ich seine Frau werden wolle«, erinnert sich Hillary Clinton in ihren Memoiren. »Ich war furchtbar verliebt in ihn, doch ich wusste überhaupt noch nicht, welche Richtung ich meinem Leben geben sollte. Also antwortete ich: ›Nein, nicht jetzt.‹ Eigentlich hatte ich sagen wollen: ›Gib mir noch etwas Zeit.‹ Ich hatte die triste und einsame Kindheit meiner Mutter vor Augen, die sehr unter der Scheidung ihrer Eltern gelitten hatte. Mir war klar, dass meine Ehe, wenn ich mich einmal zum Heiraten entschloss, das ganze Leben dauern müsse.« Sie entschied sich erst viele Heiratsanträge später und, wie es scheint, tatsächlich mit dem festen Vorsatz, ihre Ehe ein ganzes Leben lang dauern zu lassen.
Virginia war ein Freigeist. Es spielte für sie keine Rolle, was andere von ihr dachten. Sie machte immer genau das, was sie für richtig hielt, und in einer Kleinstadt im Arkansas der 40er und 50er Jahre bringt das die Leute natürlich zum Tuscheln. ■ Joe Purvis, Jugendfreund, über Clintons Mutter
Das Paar, das sich am 11. Oktober 1975 in Arkansas schließlich das Ja-Wort gab, hätte von seiner Herkunft her unterschiedlicher kaum sein können. Bill Clinton war aufgrund seiner Kindheit dazu prädestiniert, ein Drogenabhängiger oder Krimineller zu werden. Sein Vater William Blythe, ein notorischer Frauenheld, kam vor der Geburt des Jungen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Seine Mutter Virginia war das, was man wohlwollend ein Original nennen könnte. Ihre Vorliebe für auffallende Schminke, Glücksspiel, schummrige Cocktailbars und durchtanzte Nächte änderte sich auch mit der Geburt des kleinen Bill nicht. Aufgrund ihres Lebenswandels gehörte sie nicht gerade zu den angesehensten Bürgern der kleinen Ortschaft Hope in Arkansas. Doch zeigte sie stets eine warmherzige, energiegeladene Art, die schnell die Herzen gewann. »Sie war eine ungeheuer glamouröse Erscheinung«, erinnert sich Bill Clintons Jugendfreundin Carolyn Yeldell Staley. »Sie fuhr diesen weißen Buick, war immer tiefbraun gebrannt, hatte die Augenbrauen ungeheuer hoch gezupft und das Ganze krönte ein weißer Streifen, den sie in ihr Haar gefärbt hatte.« Virginias erste Amtshandlung nach dem Aufstehen war, sich fingerdickes Make-up aufzulegen. »Das ist das Allerwichtigste«, schärfte sie Carolyn ein, »man kann ja nie wissen, wer einen zu sehen bekommt.« Doch entgegen ihrer äußeren Erscheinung war Virginia alles andere als oberflächlich. »Virginia hat uns immer zum Diskutieren aufgefordert. Sie kam nach Hause und erzählte, was ihr im Lauf des Tages passiert war, was sie gehört oder beobachtet hatte«, erzählt Carolyn. »Und dann fragten wir uns, wie diese oder jene Situation am besten gelöst werden könnte. Sie regte uns an, kleine Debatten darüber zu fuhren, was in dieser Welt nicht richtig läuft. Es war einfach großartig.« Carolyn sieht in Virginia den Urbeweggrund Bill Clintons, in die Politik zu gehen. »Sie weckte in uns die Liebe zu Amerika, die Liebe zu unserem Land und zur Politik.«
Sie hat Bill die Liebe zum Leben gegeben. Und die Fähigkeit, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Sie nahm jeden Menschen gleich an, behandelte ihn gleich und sah in jedem das Gute. ■ Joe Purvis, Jugendfreund, über Clintons Mutter
Roger Clinton liebte mich wirklich, und er liebte Mutter, doch er konnte sich nie aus dem Schatten seiner Selbstzweifel lösen. Stattdessen gab er sich einer Illusion von Selbstsicherheit hin, die ihm die Trinkgelage und pubertären Feiern mit seinen Freunden verschafften. ■ Bill Clinton, »Mein Leben«
Virginias Liebesleben in dieser Zeit glich einer Achterbahn. Schnell gab es für Bill einen Stiefvater, Roger Clinton, dessen Namen der Junge annahm, und er bescheinigt ihm heute, ein durchaus aufrichtiger Kerl gewesen zu sein. Doch Roger Clintons Alkoholismus stürzte die Familie, die sich in der Zwischenzeit um den kleinen Roger vermehrt hatte, in heilloses Chaos. Gewalt und Rücksichtslosigkeit prägten die Kinderjahre des späteren Präsidenten. In seinen Memoiren erinnert sich Bill Clinton offen daran, dass der Stiefvater im ehelichen Schlafzimmer mit einer Pistole um sich feuerte und seine Frau verprügelte: »Eines Abends schloss Daddy die Schlafzimmertür und begann Mutter anzuschreien. Dann schlug er sie ... Ich holte einen Golfschläger und stieß die Schlafzimmertür auf. Meine Mutter lag auf dem Boden. Daddy stand über ihr und schlug auf sie ein. Ich schrie ihn an, wenn er nicht sofort aufhöre, werde ich ihm die Seele aus dem Leib prügeln. Er hielt inne, starrte mich irritiert an, sank in sich zusammen und ließ sich in einen Sessel fallen, wo er mit gesenktem Kopf sitzen blieb ... Ich gewöhnte mich daran, diese dunkle, verborgene Seite unserer Familie als normalen Bestandteil meines Lebens zu akzeptieren.« Die Aggressionen in seiner Kindheit machten ihn nicht zu einem gewalttätigen Menschen. Ganz im Gegenteil: Dick Morris, sein späterer Berater, sieht in Clintons Kindheitsjähren die Wurzeln eines ganz anderen Charakterzuges. »Er ist immer auf Deeskalation aus. So reagiert er auf die Schreiereien und die Schläge seiner Kindheit.«
Die Frau, mit der Bill nun eine Familie gründen wollte, war ein klassisches Gewächs amerikanischer Vorstadtidylle. »Die Frauen führten den Haushalt und zogen die Kinder groß, während die Männer mit dem Nahverkehrszug zur Arbeit pendelten«, erinnert sich Hillary später. Die ordentlich gestutzten Hecken der Vorgärten von Park Ridge bei Chicago spiegelten das Gefüge von Anstand und Moral wider. Hugh Rodham, der autoritär und konservativ war, gab im Haus den Ton an. Hillary und ihre beiden jüngeren Brüder gehorchten ihm genauso wie Mutter Dorothy. »Hugh und Dorothy waren überzeugt davon, dass wir Härte brauchen würden, damit wir uns später auch unter widrigen Bedingungen behaupten könnten«, so Hillary. Häufig erzählt sie folgende Anekdote aus ihrer Kindheit: Ihre Mutter hatte bemerkt, dass sie sich vor einem Mädchen aus der Nachbarschaft fürchtete. »Also schickte sie mich eines Tages, als ich mich wieder einmal ins Haus flüchtete, zurück auf die Straße. ›Geh wieder hinaus‹, befahl sie mir, ›und wenn dich Suzy haut, so hast du meine Erlaubnis zurückzuschlagen. Du musst lernen, dich zu verteidigen. In diesem Haus ist kein Platz für Feiglinge.‹ ... Nach einigen Minuten kehrte ich mit stolzgeschwellter Brust zurück. ›Ich kann jetzt mit den Jungs spielen‹, erklärte ich meiner Mutter.« Auffallend früh interessierte sich das aufgeweckte Mädchen für Politik, wenn auch nach den Vorgaben des Vaters, für den der amtierende US-Präsident John F. Kennedy einer Inkarnation des Teufels gleichkam. Als »Goldwater-Girl« engagierte sie sich für den erzkonservativen republikanischen Senator Barry Goldwater und vertrat dessen Anliegen mit größter Ernsthaftigkeit. Ihr Jugendpfarrer Don Jones erinnert sich in einem Interview an jene Zeit: »Hillary war immer schon erwachsen. Mit 15 oder 16 sprach sie auf Augenhöhe mit den Seniors in der High School. Sie konnte immer mit den Älteren mithalten.«Nachdem Hillary die High School abgeschlossen hatte, entschied sie sich für das Wellesley College, eine Privateinrichtung nur für Mädchen, die sich 1000 Meilen entfernt vom heimischen Park Ridge befand. Die renommierte Schule, an der auch die spätere US-Außenministerin Madeleine Albright studierte, bot den Mädchen ein Refugium, in dem sie sich ohne männliche Dominanz ihrem Studium widmen konnten. Während ihrer Zeit in Wellesley reifte Hillary persönlich wie politisch zu einer eigenständigen jungen Frau heran, deren Talent und Engagement für Lehrer und Kommilitoninnen erkennbar weiter führen würden. Am Ende ihrer Collegezeit hielt sie eine Abschlussrede. Ein Satz daraus schien ihr Leben vorwegzunehmen, obwohl er bar jeden politischen Inhalts war. »Das Problem mit dem Mitleid ist«, sagte die junge Hillary Rodham, »dass Mitleid uns nirgendwo hinbringt.«Bill Clinton hatte aus seinen Lebensplänen nie ein Hehl gemacht. Er war der geborene Politiker. Schon als Schüler hatte er immer wieder nach Ämtern und Verantwortung gestrebt und es war ihm stets leicht gefallen, die nötigen Stimmen für sich zusammenzubekommen. Als einen Schlüsselmoment in seinem Leben sieht er heute den Tag, an dem er als »Senator« der »Boys Nation« im Juli 1963 nach Washington reisen durfte und zu einem Termin bei John F. Kennedy ins Weiße Haus eingeladen wurde. Die Boys Nation ist eine Jugendorganisation, die unter anderem Wahlkämpfe unter den Schülern der High Schools eines Bundesstaates um verschiedene »politische Posten« veranstaltet. Die Sieger werden nach Washington eingeladen, um eine Woche lang mit den echten Senatoren und Abgeordneten zu debattieren. Die Vertreter der Boys Nation waren nach dem Alphabet ihrer Bundesstaaten aufgereiht, Arkansas entsprechend weit vorn. Der größte Junge in der Reihe drängte selbstbewusst nach vorn und durfte die Hand des charismatischen Präsidenten schütteln. Es war Bill Clinton.
»Der geborene Politiker« – Clintons Begegnung mit John F. Kennedy bestärkte ihn, selbst in die Politik zu gehen
Spätestens seit dieser Begegnung war der Junge glühender Demokrat. Bereits während der Collegezeit jobbte er im Büro des demokratischen Senators William J. Fulbright. Schulische Erfolge flogen Clinton, der nach Aussage seiner Mutter bereits mit drei Jahren lesen konnte, scheinbar ohne jegliche Anstrengung zu. Die Georgetown University in Washington absolvierte er mit Bravour, ein Rhodes-Stipendium belohnte seine guten Leistungen und führte ihn für zwei Jahre nach Oxford. Für Lehrer und Familie war sein Erfolgsweg vorgezeichnet, auch wenn er seine Karriere keineswegs klassisch anging. Nach dem Examen in Yale, das er 1973 ablegte, kehrte er ins hinterwäldlerische Arkansas zurück und nahm eine Stelle als Dozent an der University of Arkansas in Fayetteville an. »Ich wollte nach Hause«, antwortete er später oft auf die Frage, warum er seinen Weg in der tiefsten Südstaatenprovinz beginnen wollte. Sein Freund Max Brantley fand die Entscheidung Bills für Arkansas nicht verwunderlich. »Bill war von hier und es war klar, dass er hier relativ leicht ein sehr hohes Amt erreichen konnte.« Tatsächlich war die Stelle des braven Hochschullehrers wenig mehr als ein Sprungbrett für Clinton. Bereits Anfang 1974, also mit gerade einmal 27 Jahren, stürzte er sich als demokratischer Kandidat in den Wahlkampf für einen Sitz im Repräsentantenhaus.
Dass Hillary ihm nach Arkansas folgte, was in Amerika so etwas wie Sibirien ist, war ein wirklich erstaunliches Bekenntnis ihrer Liebe, ihrer Hingabe und Leidenschaft. Sie hätte ein großer Star in New York oder Washington sein können und nun wählte sie Little Rock und sagte damit zur Welt: Das Wichtigste auf der Welt ist für mich meine Beziehung. Viele Feministinnen ihrer Generation haben darin einen Riesenbetrug gesehen. Aber sie hatte ihre Wahl getroffen und ich glaube, es war eine gute Wahl. ■ Kati Marton, Biographin Hillarys
Die Beziehung zwischen Bill und Hillary hatte sich während der vergangenen Jahre verfestigt, und seit einiger Zeit lebten sie zusammen. Doch Hillary folgte Bill zunächst nicht nach Arkansas, sondern entschied sich, für den Children’s Defense Fund in Cambridge, Massachusetts, zu arbeiten. Nach wenigen Monaten allerdings, als sie die Möglichkeit erhielt, für den Untersuchungsausschuss zu arbeiten, der die Verfehlungen Präsident Richard Nixons in der Watergate-Affäre unter die Lupe nahm, kehrte sie nach Washington zurück. Es war eine aufregende Zeit für die junge Frau, die mit Feuereifer für die Aufklärung kämpfte. Dass ein ähnlicher Untersuchungsausschuss sich zwei Jahrzehnte später mit den Verfehlungen ihres Gatten beschäftigen würde, wäre damals eine absurde Vorstellung gewesen. So sehr ihre Tätigkeit sie auch ausfüllte: Für Hillary war die Trennung von Bill nur äußerst schwer zu ertragen. Als ihre Freundin Sara Ehrmann an einem Augustabend 1974 in ihr Apartment zurückkehrte, das sie mit Hillary Rodham teilte, fand sie die Freundin aufgepackten Koffern vor. »Ich fahre nach Arkansas zu Bill«, verkündete Hillary. Sara traute ihren Ohren nicht. Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Für Sara kam diese Entscheidung einer freiwilligen Einweisung in ein sibirisches Gefangenenlager gleich. Sie bot an, Hillary nach Arkansas zu fahren, um während der Zeit noch jede Gelegenheit nutzen zu können, ihr diesen Schritt auszureden. Es war vergebens. Selbst ein Tränenausbruch Saras bei der Einfahrt nach Fayetteville konnte Hillary nicht erweichen. Bill wollte Arkansas und Hillary wollte Bill. Punkt. Bill Clinton verlor die Wahl um den Sitz im Repräsentantenhaus. Mit 27 Jahren war das nicht weiter tragisch. Zwei Jahre später war er Generalstaatsanwalt, und 1978 wurde er mit gerade einmal 32 jüngster Gouverneur in der Geschichte des Staates Arkansas: Ein Shootingstar auf der politischen Bühne. »Das Naturtalent« hat der Journalist Joe Klein sein Buch über Bill Clinton genannt. Tatsächlich war der neue Gouverneur von Arkansas offenbar geboren, um die Herzen der Wähler zu gewinnen. Sein Freund Max Brantley kennt Clintons Geheimnis. »Er schaut dir direkt in die Augen, er berührt Männer, Frauen, Kinder, Hunde, einfach jeden. Er steht immer sehr nahe bei dir, wenn er mit dir redet.« Innerhalb von Sekunden ist Clinton in der Lage, eine menschliche Nähe herzustellen, die kaum jemandem unangenehm ist. Meist legt er den Arm um den Angesprochenen, oftmals greift die freie Hand noch nach dem Unterarm oder der Hand. »Aber es ist mehr als das«, sagt Max Brantley, »er merkt sich, was du sagst. Er kann sich an irgendeine Kleinigkeit 15, 20 Jahre später erinnern. Das ist wirklich bemerkenswert.« Clintons Redenschreiber Robert Boorstin bestätigt: »Es ist einfach so, dass fast jeder, der ihn persönlich trifft, für ihn stimmt. Er hat diese enorm magnetische Ausstrahlung, dieses Charisma.« In Arkansas, seiner Heimat, hatte Clinton überdies ein Heimspiel. Er wusste, wie die Uhren in dem verschlafenen Bundesstaat tickten. Die Frau an seiner Seite allerdings war nicht unbedingt das, was sich die Südstaatler unter einer Landesmutter vorstellten. Das erste Tabu, das sie unbesorgt brach, war, dass sie nicht den Namen ihres Mannes annahm: Auch nach ihrer Hochzeit im Oktober 1975 behielt sie ihren Mädchennamen Rodham bei. Jerry Bookout, Senator aus Arkansas, erinnert sich: »Keine Frau in Arkansas hätte damals nicht den Namen ihres Mannes angenommen, keine. Das war gegen jede Tradition, und in Arkansas gibt man viel auf Traditionen.« Joe Purvis, ein Freund aus diesen Tagen, bestätigt die mittelalterlichen Zustände. »In den sechziger und siebziger Jahren wurde ein Mädchen aus Arkansas Hausfrau oder Lehrerin. Etwas anderes konnte man sich dort überhaupt nicht vorstellen.« Hillary war ein Fremdkörper: zu modern, zu selbstbewusst, zu feministisch. »Für Hillary war es eine harte Lektion«, sagt ihre Biographin Kati Marton. »Sie kam aus der intellektuellen Atmosphäre von Wellesley und Yale und landete nun an einem Ort, an dem du danach bewertet wirst, wie blond und glänzend dein Haar ist. Es interessiert niemanden, welche Bücher du gelesen hast. Es muss ein Schock für sie gewesen sein.«
Auch privat musste Hillary um Anerkennung kämpfen. Virginia Clinton hatte sich ihre Schwiegertochter ebenfalls ganz anders vorgestellt. »Hillary war keine Miss Arkansas«, schmunzelt Kati Marton, und Virginias Make-up-Ratschläge waren wohl bei niemandem weniger willkommen als bei der frisch gebackenen Frau ihres Sohnes, die noch immer durch flaschenbodendicke Brillengläser in die grünen Berge von Arkansas linste und deren Kleider oft aussahen, als seien sie gerade aus einem Wäschebeutel gerupft worden. Doch die beiden lernten sich zu respektieren und entwickelten ein liebevolles Verhältnis zueinander. »Hillary war schlau genug zu sehen, dass diese Frau immer sehr, sehr wichtig für ihren Mann sein würde«, sagt Kati Marton. »Das war nicht so eine Schwiegermutter, die man einmal im Jahr an Weihnachten sah und ansonsten vergessen konnte.« Hillary selbst sagt dazu: »Irgendwann waren wir ... zu dem Schluss gekommen, dass das, was uns trennte, lange nicht so wichtig war wie das, was uns verband: die Liebe zu Bill.« Das Verhältnis zu Virginia entspannte sich also mit der Zeit, das zu den Südstaatlern – oder besser gesagt: das der Südstaatler zu Hillary – dagegen kaum. »Sie machte in Arkansas einfach nicht die Sachen, die Gouverneursfrauen üblicherweise so machen«, erinnert sich Max Brantley, »also Teegesellschaften geben und Wohltätigkeitsveranstaltungen organisieren. Und das hat Bill politisch geschadet.«Hillary hatte ihre eigenen beruflichen Ambitionen nicht aufgegeben. 1977 trat sie als eine der ersten Frauen in Arkansas als Anwältin einer alteingesessenen und angesehenen Kanzlei bei. Die Anwaltsfirma Rose & Partner bot ihr Anerkennung und nicht zuletzt auch ein üppiges Salär, was umso wichtiger war, als Bills Jahreseinkommen trotz seines Postens als Generalstaatsanwalt bescheiden blieb. »Geld spielt für ihn keine Rolle«, erinnert sich Bills Jugendfreund Joe Purvis, »er hat wahrscheinlich noch nie mehr als zwanzig Dollar in der Tasche gehabt.« Hillary bedeutete Geld durchaus etwas. Sie nahm die Finanzen der Familie in die Hand und tätigte einige Geschäfte, die zunächst vielversprechend wirkten. Die Folgen ihrer Transaktionen würde das Ehepaar Clinton erst viele Jahre später zu spüren bekommen. Fünf Jahre nach der Hochzeit kam die freudige Nachricht: Hillary war schwanger. Beide hatten sehnsüchtig auf ein Kind gewartet und freuten sich unbändig, als sie endlich Töchterchen Chelsea im Arm hielten. Sie nannten sie nach dem Pop-Song »Chelsea Morning«, den beide sehr mochten. Jetzt war Improvisationstalent gefragt, denn das Kind musste seinen Platz im vollen Terminkalender der viel beschäftigten Eltern finden. »Sie haben ihr Leben nicht im Geringsten geändert«, berichtet Larry Gleghorn, der damals den Personenschutz des Gouverneursehepaars verantwortete. »Bill hatte überhaupt keine Ahnung, wie man mit einem Kind umgeht.« Doch die beiden fanden schnell in ihre neuen Rollen. Hillary nahm ihre Tochter einfach mit zu Sitzungen. Hatte sie in Washington zu tun, wo sie mittlerweile wieder in Ausschüssen politisch tätig war, flog der Gouverneur bisweilen mit und versorgte den Nachwuchs. Es schien, als würde alles so laufen, wie es sich Hillary und Bill immer erträumt hatten.
Die Geburt unserer Tochter war die wunderbarste und beeindruckendste Erfahrung in meinem Leben ... Bill nahm unsere Tochter auf den Arm, ... drehte einige Runden durch das Krankenhaus, sang für sie, wiegte sie, zeigte sie herum und brüstete sich ganz ungemein damit, soeben die Vaterschaft erfunden zu haben. ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Das böse Erwachen kam im Herbst 1980. Bill Clinton hatte seine Wiederwahl als Gouverneur für eine reine Formsache gehalten. Als die Wähler ihn abstraften und nach nur einer Legislaturperiode des Amtssitzes verwiesen, war der erfolgsverwöhnte Jungpolitiker völlig vor den Kopf gestoßen. Joe Purvis erzählt in einem Interview: »Als er bei der Wiederwahl unterlag, war das wohl eine der zwei oder drei schmerzlichsten Erfahrungen in seinem Leben. Ich bin mir sicher, er kann noch heute sagen, um wie viele Stimmen er in den jeweiligen Wahlkreisen unterlegen ist.« Bill hatte politische Fehler gemacht. Sein Reformwillen war den sturköpfigen Südstaatlern zu weit gegangen. So hatte er heilige Kühe angefasst, wie etwa die Kfz-Steuer, die er anheben wollte.
Doch nicht wenige schoben die Schuld für seine Niederlage der Frau an seiner Seite zu. Tatsächlich war die Wahlschlappe für beide eine Lehre. Der politische Erfolg flog ihnen nicht automatisch zu, sondern musste hart erkämpft werden. Als das Ehepaar Clinton 1982 seinen Wiedereinzug in den Gouverneurssitz feierte, war die First Lady kaum wiederzuerkennen. In einem eng anliegenden Seidenkleid, das gepflegte blonde Haar von einem Haarband brav zurückgenommen, lächelte an der Seite Bill Clintons eine Frau namens »Mrs. Clinton«. Nachdem sie jahrelang ausschließlich ihren Mädchennamen geführt hatte, hatte sie endlich den Namen ihres Gatten angenommen. »Sie war weicher geworden«, sagt ihre Freundin Brooke Shearer, »sie hatte sogar gelernt, ein wenig zu flirten.« Diese Fertigkeit beherrschte ihr Mann zu diesem Zeitpunkt bereits in Perfektion. Bei allem Erfolg im politischen Leben: Während der unangefochtenen Gouverneurszeit im Arkansas der achtziger Jahre durchlebte die Ehe von Hillary und Bill stürmische Zeiten. Leibwächter Larry Gleghorn bekam ein ums andere Mal mit, wenn bei Clintons die Fetzen flogen. »Natürlich gab es Schreiereien und zugeschlagene Türen«, erzählt er, »aber gibt es das nicht bei allen jungen Ehepaaren?« Das mag wohl sein, doch im Fall der Clintons hatte der Anlass des Streites allzu oft einen konkreten Namen – und der war meist weiblich. Immer mehr verdichteten sich die Gerüchte, dass sich diverse Südstaatlerinnen der besonderen Gunst des Staatschefs erfreuten. Leibwächter Gleghorn jedoch lässt bis heute nichts auf seinen Chef kommen. »Ich habe nie beobachten können, dass er irgendetwas Unlauteres getan hätte«, sagt er in einem Interview. »Na klar, wenn wir unterwegs waren, haben wir natürlich gequatscht, schau dir die da an, oder die da. Nun ja, wir waren erst Mitte dreißig.« Die Treue des Leibwächters in allen Ehren – es waren doch wohl mehr als Gerüchte, wie zahlreiche Freunde aus dieser Zeit bestätigen. Brooke Shearer litt mit ihrer Freundin. »Hillary hat Bills Untreue wie eine Krankheit behandelt, die man bekämpfen kann. Sie sah das Problem, entwickelte eine Lösung und führte sie durch.« Doch ihre Lösung war nicht zwingend die seine. Dick Morris, Clintons Berater, auf dessen Unterstützung er sich in dieser Zeit immer mehr verließ, sagt heute: »In den achtziger Jahren fühlte er sich von Hillary immer mehr eingeengt, seine Affären nahmen überhand. Sie wurden häufiger und sie wurden öffentlicher.« Folgt man Dick Morris, stand die Ehe während dieser Zeit kurz vor dem Aus. »Bill fragte mich, ob er mein Haus in Florida haben könne, um zu überlegen, ob er sie verlässt oder nicht«, so Morris. »Er fragte diverse Gouverneure, ob man eine Scheidung politisch überstehen kann. Und er bat mich, in einer Umfrage zu testen, wie die Leute auf eine Scheidung reagieren würden.«
Sie sind beide Stehaufmännchen. Wenn man sie niederschlägt, stehen sie wieder auf. Man kann sie nicht dauerhaft auf die Bretter schicken. ■ Robert Boorstin, Redenschreiber von Clinton
Es kam anders, und das war wohl vor allem einem neuen Ziel zu verdanken, welches das Ehepaar Clinton wieder aneinander band: die Möglichkeit, für das Amt des Präsidenten der USA zu kandidieren. Hillary stürzte sich mit Feuereifer in die neue Aufgabe. Ihren Jugendpfarrer Don Jones verblüffte sie bei einer Teestunde mit der Offenbarung, sie sei die »künftige First Lady der Vereinigten Staaten«. Sie rührte die Werbetrommel so überzeugend, dass die Medienvertreter am 15. Juli 1987 in dem festen Glauben zu einer Pressekonferenz erschienen, sie könnten anschließend die Kandidatur Bill Clintons für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten bekannt geben. Doch zum Erstaunen aller verkündete Bill Clinton: »Ich kandidiere nicht.« Hillary stand hinter ihm, und höchst ungewöhnlich für die sonst so kontrollierte Frau kullerte eine Träne über ihr Gesicht. Über die Gründe für diese überraschende Demission ist viel spekuliert worden. Von einer ominösen Liste, die Clinton-Beraterin Betsey Wright vorgelegt habe, war die Rede. Akribisch seien da alle Amouren, Affären und Tête-à-têtes des Gouverneurs aufgezählt gewesen. Politischer Zündstoff mit der Sprengwirkung einer Atombombe, sollte der Mann sich für das mächtigste Amt der Welt bewerben. »Es wurde viel darüber geschrieben, warum er sich gegen eine Kandidatur entschied, aber letztendlich ließ es sich auf ein Wort reduzieren: Chelsea«, so Hillarys Variante der Geschichte in ihren Memoiren. Der innige Wunsch, mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, habe Bill davon abgehalten, für die Präsidentschaft anzutreten.
Vier Jahre später schienen alle Bedenken, welcher Art auch immer sie gewesen sein mochten, ausgeräumt. Clinton und der kaum minder smarte Al Gore traten gemeinsam an, die republikanische Ära im Weißen Haus zu beenden, und das mit einem Wahlkampf, wie ihn die Vereinigten Staaten noch nicht gesehen hatten. Wie Rockstars tourten die beiden in Begleitung ihrer Ehefrauen durch ganz Amerika. Sie sprachen in Hörsälen und Einkaufszentren, auf Golfplätzen und in Sonderschulen. Bill Clinton spielte in Fernsehsendungen Saxophon, Hillary Clinton und Tipper Gore tanzten vor den allgegenwärtigen Kameras zur inoffiziellen Wahlkampfhymne »Don’t stop thinking about tomorrow« der Popgruppe Fleetwood Mac. »Putting people first« – die Menschen zuerst – so lautete das Wahlkampfmotto. Das Ganze schien ein Riesenspaß zu sein und ließ den drögen Amtsinhaber George Bush noch farbloser und überholter aussehen. Das Wahlkampfhauptquartier in Little Rock pflegte die improvisierte Aura einer riesigen Studentenbude, Stapel fettiger Pizzakartons und halb geleerter Diätcolabüchsen inklusive. Kein Zweifel – die Zeit der Babyboomer war gekommen. Tatsächlich aber waren die Clintons auf nationaler Bühne echte Greenhorns. Brooke Shearer erinnert sich noch heute mit Vergnügen an die Naivität, mit der das Hillary-Team auf Reisen ging. Zum ersten Mal hatte die Gouverneursgattin nun umfangreichen Personenschutz. »Die meisten Leibwächter waren riesige ehemalige Footballspieler, die nie zuvor aus Arkansas herausgekommen waren«, schmunzelt Shearer. »Sie dachten, dass die Inhalte von Minibars umsonst seien, und stopften sich die Taschen mit den kleinen Fläschchen, mit Schokolade und Chips voll. Sofort sahen wir uns dem Vorwurf ausgesetzt, dass unsere Kampagne ungeheuer teuer wäre.«
Sie sind ein Team. Man würde Hillary nicht ohne Bill kennen und umgekehrt. Das ist der Stoff, aus dem großartige Beziehungen gemacht sind. ■ Jesse Jackson, Bürgerrechtler und Freund der Familie
Trotz aller Anstrengungen scheint das Ehepaar Clinton diese Zeit sehr genossen zu haben. »Sie haben beide eine unglaubliche Energie. Sie werden einfach nie müde!«, sagt Brooke Shearer, die Hillary in dieser Zeit begleitete. Der Arbeitstag des Paares begann um fünf Uhr morgens mit dem Styling für die »Today Show« oder ein Radiointerview und endete gegen zwei Uhr morgens, wenn alle nach zahllosen Terminen todmüde ins Bett sanken. Das Verhältnis zwischen den Eheleuten war zumindest für Außenstehende wieder eingerenkt. Eine pure Vernunftentscheidung, um Bill zum Präsidenten zu machen? Niemand außer Bill und Hillary Clinton kennt die Wahrheit. Brooke Shearer beobachtete, dass die beiden ständig Kontakt hielten. »Es verging kein Tag, an dem sie nicht mehrfach miteinander telefonierten. Er brauchte ihren Rat«, so Shearer. Und er brauchte mehr als das, denn eine alte Geschichte drohte zum Stolperstein zu werden. Gennifer Flowers aus Arkansas schickte sich an, über ihr ganz besonderes Verhältnis zum Gouverneur auszupacken. Ein neues Raunen in der Gerüchteküche? Nein, diesmal waren die Anwürfe konkreter, denn die Medien erhielten Zugriff auf einen brisanten Telefonmitschnitt, aus dem eindeutig eine zweideutige Beziehung zwischen Clinton und Flowers hervorging. Und die verstoßene Gespielin ging noch weiter. »Ja, ich war Bill Clintons Geliebte, zwölf Jahre lang«, offenbarte sie in einer Pressekonferenz. »Die letzten zwei Jahre habe ich gelogen, um ihn zu schützen. Die Wahrheit ist: Ich liebte ihn.« Die Clintons, die längst im Fokus der amerikanischen Öffentlichkeit standen, entschlossen sich zur Flucht nach vorn. Im populären Politmagazin »60 Minutes« stellten sie sich gemeinsam den Fragen des Reporters. »Für die meisten Amerikaner ist es bewundernswert, dass Sie zusammengeblieben sind, dass Sie versuchen, Ihre Probleme zu verarbeiten, und dass Sie zu einer Abmachung gefunden und sich arrangiert haben«, so die vergleichsweise milde Andeutung des Skandals. Bill Clinton aber ging sofort in die Offensive. »Moment mal, Sie haben hier zwei Menschen vor sich, die sich lieben«, kanzelte er den Fragesteller ab. »Und das ist weder ein Arrangement noch eine Abmachung. Das ist eine Ehe.« Hillary saß im ordentlichen Kleinmädchenlook neben ihm, das Haar brav mit einem Haarband zurückgehalten, und nickte zustimmend. Der Satz, den sie dann zum Besten gab, würde ihr noch jahrelang vorgehalten werden. »Ich sitze doch nicht hier als Frauchen, das ihrem Mann zur Seite steht wie Tammy Wynette«, stieß Hillary trotzig hervor. »Ich liebe ihn. Ich respektiere und achte ihn. Wenn das den Leuten nicht reicht, dann sollen sie ihn verdammt noch mal nicht wählen.«
Sie wählten ihn dennoch, obwohl Hillary Clinton mit dieser Anspielung auf Tammy Wynette – sie hatte damit eigentlich deren Song »Stand by your man« gemeint – ins Fettnäpfchen getreten war und eine wahre Flut von wütenden Reaktionen ausgelöst hatte. »Die Gründe, warum sich die Amerikaner für einen Kandidaten aus der Babyboomer-Generation entschieden, noch dazu den drittjüngsten in der Geschichte und Gouverneur eines kleinen Staates, mit mehr Ballast als ein Ozeandampfer, waren vielfältig«, so lautet die ganz nüchterne Analyse von Bill Clinton in seinen Memoiren. »Umfragen nach den Wahlen ergaben, dass die Wirtschaft den Wählern mit Abstand am wichtigsten war, gefolgt vom Haushaltsdefizit und dem Gesundheitswesen, während die Charakterfrage unter ›ferner liefen‹ rangierte.«Ab dem 20. Januar 1993 wehte dann ein völlig neuer Wind im Weißen Haus. Als Erstes bekamen das die Angestellten von Pennsylvania Avenue 1600 zu spüren. Nachdem sich die Clintons nach der durchtanzten Ballnacht vollkommen erschöpft zu Bett gelegt hatten, weckte sie im Morgengrauen ein selbstbewusstes Klopfen an der Tür. Noch bevor das frisch gebackene Präsidentenpaar richtig wach war, stand ein Bediensteter im Smoking mit Silbertablett vor ihnen, um – ganz wie er es von Frühaufsteher Bush gewohnt war – das Frühstück zu servieren. »Doch die ersten Worte, die der arme Mann vom 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten zu hören bekam, waren: ›Hey! Was soll das?‹«, erinnert sich Hillary Clinton. »Ich habe nie jemanden schneller aus dem Raum flüchten sehen als diesen Butler.«Doch die Clintons merkten rasch, dass ihr lockerer Stil für Washington nicht das Richtige war. Es lief einiges schief in der Anfangszeit der Regierung. »Um ganz ehrlich zu sein, sie hatten etliche Leute aus Arkansas mitgebracht, die einfach nicht gut genug waren für die nationale Ebene«, gibt Robert Boorstin, der Berater von Hillary Clinton, zu. Das Washingtoner Establishment goutierte es nämlich ganz und gar nicht, dass die Clintons nach und nach Schlüsselpositionen im Weißen Haus mit alten Freunden und Bekannten besetzten, deren Qualifikation in einigen Fällen geradezu fragwürdig war. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft machte schnell die Runde. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet auch Vince Foster, ein Freund und Kollege aus Hillarys Kanzlei in Little Rock, den sie nach Washington geholt hatte. Am 20. Juli 1993 beging Vince Foster Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief schrieb er: »Ich bin nicht geschaffen für die Arbeit in Washington. Hier gilt es als Sport, Menschen zu zerstören.« Der Verlust des Freundes traf Hillary und Bill Clinton hart. Zu allem Überfluss munkelte man, Hillary und Vince hätten ein Verhältnis gehabt, sogar Mordgerüchte machten die Runde.
Es ist erwiesen, dass es eine Verschwörung des rechten Flügels war, die mit Millionen von Dollar unterstützt wurde. Bevor sie das Glück hatten, über die Lewinsky-Sache zu stolpern, war das doch schon jahrelang so gegangen. Da war Whitewater, dann gab es den vermeintlichen Travelgate-Skandal. Doch null multipliziert mit null ergibt null. Es war nichts anderes mehr übrig geblieben als diese Privatgeschichte, die er nicht zugab, weil er es einfach nicht angemessen fand, dass ihm solche Fragen gestellt wurden. ■ Lanny Davis, Präsidentenberater im Weißen Haus
Der Tod Vince Fosters war das deutlichste Zeichen des enormen Drucks, dem das neue Präsidentenpaar ausgesetzt war. Auf eine nie da gewesene Art und Weise durchleuchteten die Medien und die politischen Gegner Gegenwart und Vergangenheit der Clintons. Und allzu schnell wurden sie fündig. Paula Jones, von ihrer späteren Schicksalsgenossin Monica Lewinsky verächtlich die »Piepsmaus aus Arkansas« genannt, trat an die Öffentlichkeit. Jones war augenscheinlich von politischen Gegnern der Clintons animiert worden, auszupacken. Was sie zu berichten hatte, ging über das übliche Affären-Geplauder weit hinaus, denn sie sagte aus, Bill Clinton habe rüde versucht, sie zum Oralsex zu nötigen. Sie selbst habe das selbstverständlich abgelehnt.
Ende 1993 begannen die Untersuchungen im so genannten Whitewater-Skandal, einem undurchsichtigen Immobiliengeschäft, in das die Clintons während ihrer Jahre in Little Rock investiert hatten. Gemeinsam mit ihren Freunden Jim und Susan McDougal hatten Hillary und Bill versucht, ein idyllisches Grundstückskonglomerat in den Ozark-Bergen in Arkansas an den Mann zu bringen. Zwar konnte den Clintons in monatelangen Untersuchungen nicht nachgewiesen werden, Anleger betrogen zu haben, doch ihr Ruf trug empfindliche Blessuren davon. Die Art und Weise, in der dem Präsidentenpaar in Form von Untersuchungen zu Leibe gerückt wurde, war ungewöhnlich scharf und in dieser Form noch nie da gewesen. Vor allem Hillary entwickelte in dieser Zeit den festen Glauben, in eine Verschwörung des »rechten Flügels« verstrickt zu sein. Ihre Reaktion war nur natürlich. Je härter die Anfeindungen von außen wurden, umso enger rückte das Paar zusammen. Doch selbst das rief die Kritiker auf den Plan. Hillary sei eine Art »Lady Macbeth« hieß es. Sie flüstere dem Präsidenten Entscheidungen ein. Eine sinistre Strippenzieherin im Hintergrund sei sie, die ihren persönlichen Einfluss geltend mache, um sich politische Macht anzueignen. Redenschreiber Robert Boorstin weist diese Vorwürfe entschieden zurück: »Dieses ganze Gerede, sie sei eine Co-Präsidentin gewesen, ist völliger Unfug«, sagt er, »sie machten Kompromisse, sie verstanden sich einfach gut und wussten, wo sie hinwollten.«
Auch der Öffentlichkeit war die einflussreiche Position der First Lady suspekt. Bereits im Wahlkampf hatte Hillary mit dem so genannten »Cookies and Tea«-Vorfall einen entscheidenden Fauxpas begangen: »Ich hätte zu Hause bleiben können, um Kekse zu backen und Tee zu kochen«, hatte sie in einem Interview auf ihre Rolle als First Lady geantwortet – eine Ohrfeige für alle Hausfrauen. Ihre Freundin Melanie Verveer sieht die Querelen von damals heute gelassen: »Das Problem mit der Rolle der First Lady ist, dass sie nirgendwo wirklich festgeschrieben ist. Die Amerikaner wissen eigentlich gar nicht so recht, was sie von der First Lady erwarten. Und wenn sie dann einen bestimmten Weg einschlägt, gibt es immer eine große Bevölkerungsgruppe, die diesen Weg ablehnt.« Den Weg, den Hillary einschlug, lehnte allerdings der überwiegende Teil der Bevölkerung ab. Sie hatte doch selbst überhaupt kein politisches Amt, woher nahm sie das Recht, Einfluss auf die Politik ihres Mannes zu nehmen? Der Präsident dagegen suchte und schätzte den Rat und das Talent seiner Frau. »Ihr kriegt zwei zum Preis von einem«, hatte Bill Clinton bereits im Wahlkampf propagiert, und er machte diese Ansage wahr. Bereits kurz nach der Wahl übertrug er Hillary mit der Ausarbeitung einer umfassenden Reform, die das marode Gesundheitssystem der USA sanieren sollte, eine entscheidende Aufgabe. Für eine Gesellschaft, die von ihrer Landesmutter bestenfalls die Organisation von Teegesellschaften und des Damenprogramms bei Staatsbesuchen erwartete, war das ein Skandal.
Die Vergabe der Gesundheitsreform an Hillary gilt als eine der gravierendsten Fehlentscheidungen von Bill Clintons erster Legislaturperiode. Das rigorose Umkrempeln des amerikanischen Krankenversicherungssystems scheiterte, und dieser Fehlschlag wurde direkt dem Präsidenten angelastet, weil seine Frau ihn zu verantworten hatte. Hillary Clinton hatte sich mit dem Projekt augenscheinlich überhoben. Gemeinsam mit ihrem engsten Mitarbeiter in dieser Sache, Ira Magaziner, hatte sie alles zugleich gewollt. Herausgekommen war ein monströser Wälzer mit 1300 Seiten Neuverordnungen, den kaum jemand verstand. Eigentlich war Hillary Clinton lediglich mit dem Vorhaben angetreten, den Versicherungsschutz auf einen deutlich höheren Bevölkerungsanteil auszudehnen. Immerhin waren damals an die 37 Millionen Amerikaner nicht krankenversichert, unter anderem auch deshalb, weil die Arbeitgeber nicht verpflichtet waren, ihre Arbeitnehmer bei einer Krankenkasse anzumelden und sich an den Kassenbeiträgen zu beteiligen. Doch irgendwie hatte eins das andere ergeben, und schließlich war klar, dass Hillarys komplizierte Novelle keine Chance hatte, das Repräsentantenhaus zu passieren. »Es hat sie unglaublich hart getroffen«, sagt Robert Boorstin. »Und es traf auch ihn hart, zum einen, weil er seine Frau eine solche Niederlage erleiden sah, und zum anderen, weil er sich von der Reform wirklich viel erwartet hatte.«
Bei den Herbstwahlen zum Kongress 1994 mussten die Demokraten erdrutschartige Verluste hinnehmen. 51 Abgeordnete verloren ihren Sitz und die Partei damit zum ersten Mal seit vierzig Jahren die Mehrheit. Für Hillary waren die ersten beiden Jahre der Regierungszeit ihres Mannes eine Kette persönlicher und beruflicher Katastrophen gewesen. Ihr Vater war gestorben, ihr Freund Vince Foster hatte sich das Leben genommen, die Gesundheitsreform war gescheitert, und sie selbst hatte im Mittelpunkt einiger für ihren Mann kritischer Skandale gestanden. Das Präsidentenpaar brauchte eine neue Rollenverteilung, wollte es eine zweite Amtszeit überleben. Ihre Beraterin Melanie Verveer erinnert sich, dass es Hillary selbst war, die sich offensiv zu einem neuen Image entschloss: »Sie erkannte, dass sie das anders machen musste. Sie blieb eine extrem einflussreiche First Lady, aber sie zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Sie hatte erkannt, dass sie so weiterkam.« Hillarys Biographin Kati Marton sieht das ähnlich: »Sie wurde nun eine viel traditionellere First Lady. Sie setzte ihre Rolle jetzt sehr geschickt ein und wurde darin so gut, wie es einst Jackie Kennedy gewesen war. Sie hatte eingesehen, dass sie sich selbst um ein politisches Mandat bewerben musste, wenn sie Macht ausüben wollte.«Bills Wiederwahl Ende 1996 stärkte dem Ehepaar Clinton den Rücken. »Ich hatte das Gefühl, dass wir diesen neuen Lebensabschnitt gestählt in Angriff nehmen würden«, erinnert sich Hillary Clinton in ihren Memoiren, »mit etwas härteren Kanten, jedoch belastbarer und ausdauernder.« Tatsächlich schienen Hillary und Bill Clinton nach vier politisch keineswegs erfolglosen Jahren zu ihren Rollen im Weißen Haus gefunden zu haben. Hillary hielt sich von nun an öffentlich eher im Hintergrund. Der Präsident entdeckte die Außenpolitik als Bühne, sich in die Geschichtsbücher einzutragen. Aus dem jungenhaften Shootingstar war auch optisch ein Staatsmann geworden. Sein graues Haar verlieh dem knapp Fünfzigjährigen ein würdevolles Äußeres. Doch war mit der äußeren Reife eine innere einhergegangen? Zwei Jahre später schon gab es auf diese Frage eine deutliche Antwort.
Mein Herz machte einen Satz, mein Atem ging ein wenig schneller, und ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Er strahlte eine wahnsinnige sexuelle Energie aus. ■ Monica Lewinsky
Im Januar 1998 flog Bill Clinton auf. Die Geschichte hatte begonnen wie viele dieser Art. Monica Lewinsky, ein attraktives Mädchen Anfang zwanzig, hatte ihr Praktikum im Weißen Haus wohl etwas umfassender aufgefasst, als es gemeint war. Ein paar mutige Avancen vonseiten der jungen Dame, und der Präsident wurde schwach. »Ein Pfau stellt seine Federn auf, wenn er Interesse signalisieren will. Ich habe eben die Riemchen meines Slips gezeigt«, antwortete Monica Lewinsky einmal lapidar auf die Frage, wie sich die verhängnisvolle Affäre angebahnt habe. In den Erinnerungen Bill Clintons stellt sich der Hergang naturgemäß etwas nüchterner dar. »Als Ende 1995 die Bundesverwaltung lahm gelegt worden war (da sich die republikanische Kongressmehrheit und die Demokraten bezüglich des Haushaltsbudgets nicht einigen konnten – Anm. d. Red.), hatten nur sehr wenige Personen die Erlaubnis erhalten, ihrer Arbeit im Weißen Haus nachzugehen, und sie blieben in der Regel am Abend sehr lange. In jener Zeit kam es zu einem unangemessenen Kontakt mit Monica Lewinsky, der sich zwischen November 1995 und April 1996 bei mehreren Gelegenheiten wiederholte.« Als die Sache offenbar zu heiß wurde, schoben Clintons Berater die Geliebte ins Verteidigungsminsterium ab. »Ich sagte ihr noch, dass sie eine intelligente, interessante Person sei, die ein schönes Leben vor sich habe. Wenn sie wolle, werde ich versuchen, ihr Freund zu sein und ihr zu helfen«, so Clintons Memoiren. Aber Monica wollte mehr. Sie schickte Geschenke und baute sich bei öffentlichen Auftritten demonstrativ vor dem Präsidenten auf. Die zufällige Videoaufnahme, auf der sie den Exgeliebten begeistert, aber etwas unsicher umarmt, gehört mittlerweile zu den am häufigsten gezeigten Filmen des 20. Jahrhunderts. Das alles wäre sicherlich im Lauf der Zeit zu einer vielleicht verklärten, allenfalls peinlich berührenden Erinnerung allein der beiden Beteiligten geworden, hätte sich das vertrauensselige Mädchen in ihrem Liebeskummer nicht an eine Freundin gewandt. Linda Tripp, die vermeintliche Vertraute, witterte den Sprengstoff in der Geschichte und schnitt die geschluchzten Geständnisse eifrig auf Tonband mit.
Die Verantwortung tragen wir beide, denn wir beide haben es gewollt ... Heute ist mir bewusst, dass ich mich in eine Situation hineinmanövriert habe, die ich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er bestimmte, wann er mit mir sprach. Er bestimmte, wann wir uns trafen: In der ganzen Beziehung hatte er das Sagen. ■ Monica Lewinsky
Bob Bittmann, damals Mitarbeiter des Sonderermittlers Kenneth Starr, ist noch heute elektrisiert, wenn er vom 12. Januar 1998 spricht, dem Tag, an dem Linda Tripp telefonisch von ihren brisanten Bändern berichtete. »Für uns als Ermittler war das eine Riesensache. Wir schickten die Bänder sofort ans FBI, um zu überprüfen, ob diese Frau die Wahrheit sagte. Und das FBI war der Meinung, das stimme alles.« Doch noch reichte die Beweislage nicht aus, denn Lewinsky war nicht zu einer Aussage bereit. »Ich glaube, sie liebte Clinton immer noch«, sagt Bob Bittmann, der sie mehrfach vernahm. »Und sie wollte ihn einfach nicht verletzen. Sie wusste, dass es ihm schaden würde, wenn sie mit uns sprach.« Und auch Clinton leugnete, als er in der noch immer schwelenden Untersuchung der Paula-Jones-Affäre vorgeladen wurde und fast beiläufig nach einer Angestellten namens Monica Lewinsky gefragt wurde. Nein, er habe keine sexuelle Beziehung zu ihr unterhalten. Basta. Rein juristisch war ab diesem Punkt für die Ermittler nichts mehr zu machen. Publizistisch aber war die Geschichte eine Bombe.
Was ich mit Monica Lewinsky getan hatte, war unmoralisch und dumm. Ich schämte mich sehr dafür und wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. In meiner Aussage versuchte ich, mich und meine Familie vor den Folgen meiner selbstsüchtigen Dummheit zu schützen. ■ Bill Clinton, »Mein Leben«
Am 21. Januar 1998 prangte die Lewinsky-Geschichte auf der Titelseite der Washington Post. So spektakulär der Fall aus der Rückschau auch scheint, für Clinton war es beileibe nicht das erste Mal, dass er in eine derartige Situation geriet. Er hatte seinen Kopf immer wieder aus der Schlinge ziehen können, und auch in den Fällen Gennifer Flowers und Paula Jones waren die Gewitterwolken schließlich weitergezogen. Clinton tat, was unvermeidlich war. Er bereitete seine Frau darauf vor, dass eine unangenehme Sache für Schlagzeilen sorgen werde, und machte sich an die Schadensbegrenzung. »Starr war ein spektakulärer Schlag gelungen, aber ich hoffte, dem Druck der Öffentlichkeit zwei Wochen lang standhalten zu können, bis sich der Nebel lichtete«, so Clinton in seiner Autobiographie.
In der PBS-Sendung »NewsHour« stellte sich der Präsident am selben Abend den Vorwürfen. Clinton war sichtlich angeschlagen. Der sonst stets so fröhliche, jungenhafte Präsident war fahl und fleckig im Gesicht, die Ringe unter den Augen ließen unschwer auf eine unruhige Nacht schließen. Er habe niemanden zum Lügen aufgefordert, beharrte er. Seine Formulierungen waren schwammig genug, dass sie sich in die eine wie in die andere Richtung deuten ließen. Fünf Tage später dann aber die Lüge, an der der 42. US-Präsident sein Lebtag gemessen werden würde. Bei einer Pressekonferenz verlor Clinton für einen Moment die Fassung. Den Zeigefinger anklagend in Richtung Kamera gereckt, stieß er aggressiv hervor: »Hören Sie mir genau zu, ich sage es noch einmal: Ich hatte keine sexuellen Beziehungen zu dieser Frau – Miss Lewinsky.« Sprach’s und verschwand. Er suchte nicht wie sonst so oft den Blick der Frau, die in einem gelben Kleid hinter ihm stand. Und fast teilnahmslos klatschend folgte Hillary Clinton ihrem Mann aus dem Raum.
Ich versuchte, die Verwicklungen im Fall Lewinsky lediglich als einen weiteren fabrizierten Skandal zu sehen, den sich Bills Gegner aus den Fingern gesogen hatten. Schließlich wurde Bill mit derartigen Vorwürfen überhäuft, seit er sich zum ersten Mal um ein politisches Amt beworben hatte. ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Ihr Mann habe sie an jenem schicksalhaften Morgen des 21. Januar 1998, einem Mittwoch, schon sehr früh geweckt, erinnert sich die ehemalige First Lady in ihren Memoiren. »Er setzte sich auf die Bettkante und sagte: ›Es steht etwas in den Zeitungen, das du wissen solltest.‹... Bill erklärte mir, er habe sich zwei Jahre zuvor mit einer Praktikantin namens Monica Lewinsky angefreundet, die während der Blockade der Regierung durch den Budgetstreit als Freiwillige im Westflügel gearbeitet hatte. Er hatte sich einige Male mit ihr unterhalten, und sie hatte ihn um Hilfe bei der Arbeitssuche gebeten. Das war etwas, was ich schon Dutzende Male erlebt hatte, denn dieses Verhalten entsprach voll und ganz Bills Wesen ... Ich fragte Bill wieder und wieder nach der Geschichte. Er stritt jegliches unangemessene Verhalten ab, gestand jedoch ein, dass die junge Frau seine Aufmerksamkeit möglicherweise falsch interpretiert haben könnte. Ich werde nie wirklich begreifen, was an jenem Tag im Kopf meines Ehemanns vorging.« Allein – ihre Version der Geschichte nehmen ihr nur wenige ab. Ihr Berater Dick Morris vertritt ganz offen die Meinung, dass Hillary Clinton hier an der Legende der ahnungslosen Ehefrau strickt. »Natürlich hat Hillary alles gewusst«, sagt er in einem ZDF-Interview. »Sie wäre doch eine Idiotin gewesen, wenn sie es nicht gewusst hätte. Ihr Mann war Hunderte Male des Ehebruchs bezichtigt worden, und in diesem Fall gab es dazu noch nächtliche Telefonate, Geschenke. Aber sie konnte es einfach nicht zugeben. Wenn sie es zugegeben hätte, hätte sie ihn nicht mehr verteidigen können. Wenn sie gesagt hätte: ›Ja, er hat es getan, aber behaltet ihn trotzdem im Amt‹, hätte das bedeutet: Mir bedeutet die Macht mehr als meine Ehe.«Wie dem auch sei: Hillary nahm den Kampf auf.
Ich hatte es bislang lediglich für töricht gehalten, dass er der jungen Frau Aufmerksamkeit geschenkt hatte, und war überzeugt gewesen, dass er das Opfer einer Verleumdungskampagne war. ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Am Morgen des 27. Januar trat sie in der Fernsehsendung »Todayshow« auf. Ein dunkles, dezentes Kostüm, perfekte Frisur, perfektes Make-up – ein perfekter Auftritt. »Ich hätte eine Wurzelbehandlung vorgezogen, doch eine Absage des seit langem festgesetzten Termins hätte eine Welle von Spekulationen ausgelöst«, erinnert sich Hillary Clinton heute schaudernd an den Kraftakt, den ihr dieser Tag abverlangte. Die Fernsehzuschauer merkten davon nichts. Lediglich verräterische Schatten unter den Augen ließen darauf schließen, dass die vergangene Woche an den Nerven der First Lady gezerrt hatte. Kerzengerade stellte sie sich den Fragen des Interviewers, und wie Gewehrkugeln flogen ihre Antworten zurück: »Ich bin der festen Überzeugung, dass hier eine Schlacht geführt wird! Sehen Sie sich nur die Personen an, die daran beteiligt sind«, so Hillary. Und weiter die dunkle Vermutung: »Es ist eine umfassende Verschwörung der extremen Rechten, die seit dem Tag gegen meinen Ehemann kämpft, an dem er seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bekannt gegeben hat.« Wenig später drohte sie unverhohlen: »Wenn das alles im Zusammenhang erkannt wird ... dann werden einige Leute sich für vieles zu verantworten haben.« Wie eine Löwin für ihr Junges kämpft, so verteidigte sie den Mann, den sie nach Ansicht vieler Geschlechtsgenossinnen am besten mit einem gezielten Fußtritt vor die Tür des Weißen Hauses befördert hätte. War das alles nur Show? War Hillary tatsächlich in der Lage, einen derartigen Feuereifer für einen Mann zu entwickeln, von dem sie wusste, dass er sie auf übelste Art und Weise belogen und betrogen hatte? Kati Marton sieht das etwas anders. »Man kann die Fähigkeit der Menschen, Dinge zu verdrängen, gar nicht hoch genug einschätzen. Wenn man etwas nicht wahrhaben will, sieht man es nicht. Sie hat ihm geglaubt, weil sie wusste, dass sie ihm glauben muss. Sein Fehltritt war so gigantisch, so jenseits von allem, dass er rational überhaupt nicht nachvollziehbar war.« Ob abgesprochen oder spontan, Bill Clinton fühlte sich grauenhaft, als er den Auftritt seiner Frau sah. Nur er allein wusste um das ganze Ausmaß der Peinlichkeit. Und mit jedem Satz, den Hillary Clinton sprach, zog sie sich tiefer in den Strudel aus Blamage und Verschleierung. »Obwohl sie die Natur unserer Gegner richtig eingeschätzt hatte, erhöhte Hillarys Einsatz für mich nur noch meine Scham«, schreibt Clinton in »Mein Leben«. Eine dezente Umschreibung für das, was in einem Mann vorgehen muss, der zusieht, wie seine Frau für ihn in aller Öffentlichkeit ihre gesamte Reputation, ihre Karriere und ihr Lebenswerk aufs Spiel setzt. Warum hat Clinton so gelogen? Die Frage ist wohl tausendmal gestellt worden und kann nur von ihm selbst beantwortet werden. In seinen Memoiren benutzt er die Formulierung »paralleler Leben«, wenn er von den dunklen Seiten seiner Seele spricht. »Ich schämte mich für meinen Fehltritt«, schreibt er, »und wollte ihn vor meiner Frau und meiner Tochter verbergen. Ich wollte Ken Starr nicht helfen, mein Privatleben zu kriminalisieren, und ich wollte nicht, dass das amerikanische Volk erfuhr, dass ich es getäuscht hatte. Ich war in einen Albtraum geraten. Meine parallelen Leben hatten sich meiner wieder vollkommen bemächtigt.« Dennoch bleibt sein Verhalten rätselhaft. Clinton hatte alles, wirklich alles Vorstellbare im Leben erreicht. Er hatte das mächtigste Amt der Welt, er hatte eine Frau, die bedingungslos zu ihm stand, eine Tochter, die er über alles liebte. Er schien der lebende Beweis dafür zu sein, dass die Götter nicht jeden, den sie lieben, früh zu sich holen. Clinton hat auf die Frage, warum er sich mit Monica Lewinsky einließ, einmal geantwortet: »Einfach weil ich es konnte.« Eine schlichte, aber wahrscheinlich die einzig zutreffende Erklärung. Doch warum verstrickte sich der fraglos hochintelligente Mann immer tiefer im eigenen Lügengespinst? Warum war ihm nicht klar, dass er diese Geschichte, die er zu einem früheren Zeitpunkt mit Sicherheit hätte klein halten können, zu einem gigantischen Monster aufblähte, das ihn Kopf und Kragen kosten konnte? Sein langjähriger Berater Dick Morris sieht das ganz nüchtern. »Ich glaube, er hat nur gelogen, weil er Angst vor Hillary hatte. Er fürchtete, dass die Wahrheit das Aus für seine Ehe bedeutete und damit auch das Aus für seine politische Karriere. Er war immer damit durchgekommen, indem er Sachen einfach geleugnet hat.« Zumindest Letzteres ist unbestritten, und so leugnete Clinton weiter. Dabei lag offenbar hinter den Toren des Weißen Hauses alles längst auf dem Tisch. Joe Klein, Redakteur des New Yorker und langjähriger enger Beobachter des Geschehens im Weißen Haus, berichtet in seinem Buch »Das Naturtalent«: »Fast alle Details, die sich erstaunlicherweise später als wahr herausstellten – das spermabefleckte Kleid, die banalen Geschenke, die leidenschaftlichen nächtlichen Telefonate, die Überlegung, dass Oralverkehr nicht als Geschlechtsverkehr zählt – all das wurde bereits in diesen ersten Tagen ruchbar.« Unterdessen lief die Politmaschine wie geschmiert – und das zunächst durchaus erfolgreich. Der Unverwundbare schien also gute Chancen zu haben, auch dieses Mal den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Am 27. Januar 1998 stand vor dem Repräsentantenhaus die »Rede zur Lage der Nation« an, und er hielt sie so gut wie selten zuvor. Tatsächlich waren viele Ergebnisse seiner Regierungszeit bestechend. Das gigantische Haushaltsdefizit, das der Präsident von seinem republikanischen Amtsvorgänger George Bush übernommen hatte, war dahingeschmolzen, die Arbeitslosigkeit im Rekordtempo geschrumpft. Die stehenden Ovationen, die Clinton nach seinem Schlusswort entgegendonnerten, waren Balsam auf seiner Seele. Die Sache beruhigte sich, er schöpfte Hoffnung. Zwar liefen die Ermittlungen weiter, aber irgendwie schienen sie »Slick Willy«, wie Bill Clinton hinter vorgehaltener Hand längst tituliert wurde, nicht greifen zu können.
Wenn er die Wahrheit gesagt hätte, wären die Ermittlungen schnell vorbei gewesen. Es wäre ein wenig wegen Lewinskys Meineid ermittelt worden. Aber die wirklich große Sache war einfach, dass der Präsident unter Eid log. ■ Bob Bittmann, Mitarbeiter von Sonderermittler Kenneth Starr
»Das ganze Frühjahr über traten wir auf der Stelle«, gibt Ermittler Bob Bittmann zu. »Der Präsident weigerte sich, mit uns zu sprechen, und auch Lewinsky sprach nicht mit uns.« Das verliebte Mädchen erwies sich als zäher Brocken. »Sie war in vielerlei Hinsicht sehr naiv«, so Bittmann. »Sie verstand nicht, dass es für sie wirklich ernst war. Dass sie – sollte sie das Gespräch mit uns verweigern – ins Gefängnis gehen konnte.« Lewinsky hegte offenbar noch immer die romantische Vorstellung, den ehemaligen Geliebten selbst gegen stärkste Anfeindungen verteidigen zu müssen. Wohl allerdings schien sie Clintons vehementes Dementi, in dem ausdrücklich ihr Name gefallen war, verletzt zu haben. »Wir unternahmen einen letzten Versuch, Lewinsky zur Kooperation zu überreden«, berichtet Bittmann, »und schließlich machte sie es. Wir gaben ihr für einen Tag Immunität, das bedeutete, ihre Aussagen von diesem Tag konnten nicht gegen sie verwendet werden.«
Kaum war die Tinte auf den entsprechenden Dokumenten getrocknet, bekannte Lewinsky die Affäre mit dem Präsidenten und bestätigte die Existenz des peinlichsten aller Beweisstücke: Das Mädchen hatte tatsächlich ein Kleid ungewaschen aufbewahrt, das es bei einem Treffen mit Clinton getragen hatte. Ein spermastarrer Beweis für die Lüge des Präsidenten. Binnen kürzester Frist lag das pikante Textil dem FBI vor. »Das FBI brachte schnell das Ergebnis«, erzählt Bob Bittmann weiter, »die Flecken waren wirklich menschliches Sperma. Nun ja, es hätte ja auch Dreck oder so was sein können.« Die Beweislage der Sonderermittler war damit sicher genug, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu einer DNA-Analyse aufzufordern.
Mehr als 20 Jahre lang war Bill mein Ehemann, mein bester Freund, mein Partner in allen Höhen und Tiefen des Lebens gewesen. Chelsea war er ein liebender Vater. Nun hatte er mein Vertrauen missbraucht und mich zutiefst verletzt ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Am Samstagmorgen, dem 15. August 1998, war für das Ehepaar Clinton schließlich der Moment der Wahrheit gekommen. Bill habe sie wieder geweckt, erinnert sich Hillary Clinton in ihren Memoiren, wie schon an jenem Morgen im Januar. »Diesmal saß er nicht auf der Bettkante, sondern lief im Raum auf und ab, während er mir zum ersten Mal erklärte, dass die Lage sehr viel ernster sei, als er bisher zugegeben habe. Ihm sei klar geworden, dass er in seiner Aussage würde zugeben müssen, dass es zu einer unangemessenen Intimität gekommen war. Was zwischen ihm und Lewinsky war, sei kurz und flüchtig gewesen. Er sagte, er habe es mir vor sieben Monaten nicht sagen können, weil er sich zu sehr dafür geschämt habe.« Auch Bill Clinton hat sich in seinen Erinnerungen dem prekären Moment gewidmet: »Ich versicherte ihr, dass es mir Leid tat und dass ich das Gefühl gehabt hatte, niemandem erzählen zu können, was geschehen war – nicht einmal ihr. Ich sagte ihr, dass ich sie liebte und sie und Chelsea nicht verletzen wollte, dass ich mich für mein Verhalten schämte und dass ich alles für mich behalten hatte, um meiner Familie Kummer zu ersparen und die Präsidentschaft nicht zu untergraben.« Für Hillary Rodham Clinton war nach 23 Jahren Ehe offenbar endgültig der Punkt erreicht, an dem das Maß voll war. Indiskreten Hausbediensteten zufolge sei ihre Reaktion nicht zu überhören gewesen. »Ich bekam keine Luft«, schreibt Hillary Clinton selbst. »Ich rang um Atem, begann zu weinen und schrie ihn an: ›Was soll das heißen?! Was redest du da? Warum hast du mich belogen?‹ Ich wurde jeden Augenblick zorniger. Bill stand einfach nur da und sagte wieder und wieder: ›Es tut mir Leid. Es tut mir so Leid. Ich wollte dich und Chelsea schützen.‹ Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte ... Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass er unsere Ehe und unsere Familie aufs Spiel setzen würde. Nun war ich wie vom Donner gerührt. Ich war wütend und verzweifelt, weil ich ihm geglaubt hatte.« Doch durchaus typisch für ihre zupackende Art, konfrontierte sie ihren Mann sofort mit der Aufgabe, Tochter Chelsea persönlich darüber zu informieren, dass ihr Vater sie belogen hatte – ein Schritt, von dem sie wusste, dass er Bill vermutlich noch schwerer fallen würde als das Gespräch mit ihr. »Als ich Bill nach einer Weile sagte, dass er mit Chelsea reden musste, füllten sich seine Augen mit Tränen«, schreibt sie in »Gelebte Geschichte«. »Wir wussten beide, dass dieser Bruch vielleicht nicht mehr zu kitten war ... Es waren schreckliche Momente, die wir alle durchmachten. Ich wusste nicht, ob unsere Ehe diesen Betrug überstehen konnte oder sollte. Es war die verheerendste, schockierendste und schmerzlichste Erfahrung in meinem Leben.«
Ich musste auch mit Chelsea sprechen – und das war in mancherlei Hinsicht noch schwieriger. Früher oder später finden alle Kinder heraus, dass ihre Eltern nicht vollkommen sind, aber Chelsea wurde mit etwas konfrontiert, das den Rahmen des Üblichen sprengte. Chelsea hatte in der High School und in ihrem ersten Jahr an der Universität bereite unter den unablässigen persönlichen Angriffen auf ihre Eltern gelitten. Nun musste sie erfahren, dass ihr Vater nicht nur einen schweren Fehler begangen hatte, sondern obendrein ihre Mutter und sie darüber belogen hatte. Ich fürchtete mich davor, nicht nur meine Ehe, sondern auch die Liebe und den Respekt meiner Tochter zu verlieren. ■ Bill Clinton, »Mein Leben«
Für die Clintons galt es, ein Wochenende zu überstehen, bis der Präsident an die Öffentlichkeit treten würde. Was macht eine Familie in einer solchen Situation? Die Frau stellt ihrem Ehemann die Koffer vor die Tür? Er sucht sich einen verlässlichen Kumpel und trinkt Unmengen Bier? Sie fährt zu einer engen Freundin und weint sich die Augen aus und schimpft auf den untreuen Verräter? All das kam für die Clintons nicht infrage. Jeder ihrer Schritte wurde mit Argusaugen überwacht. Berater, Juristen, Journalisten – sie alle warteten auf ein Zeichen, wie es weitergehen würde, doch das wussten die Beteiligten wohl am allerwenigsten. Sie wandten sich Hilfe suchend an eine Person, deren Beistand wohl die wenigsten erwartet hatten. Fast unbemerkt traf der bekannte Bürgerrechtler Jesse Jackson im Weißen Haus ein. Beide Clintons kannten ihn seit Jahren und hatten eine enge Beziehung zum Reverend aufgebaut. »Ich wollte ihnen durch die Krise helfen«, sagt Jesse Jackson in einem ZDF-Interview. »Es war mir vor allem ein Anliegen, Chelsea beizustehen.« Jackson suchte das Gespräch mit allen dreien und, was wohl noch wichtiger war: Er betete mit der Familie. »Wir haben einzeln und zusammen gebetet«, sagt der Reverend. »Ich hatte das Gefühl, es ist wichtig für sie, einen Freund zur Seite zu haben.«
Bill hätte diese Krise ohne Hillarys Unterstützung nicht überlebt. Sie stützte ihn politisch und privat. Und Chelsea, obwohl sie ein Kind war, hat ihnen Halt gegeben. Sie hat die Stärke ihrer Mutter. ■ Jesse Jackson, Bürgerrechtler und Freund der Familie
Am Montag, dem 17. August, musste Clinton vor der Grand Jury antreten und machte eine vierstündige Aussage. Auf einen Satz wie »Ja, ich hatte eine Affäre mit Monica Lewinsky« warteten die Ermittler vergeblich. Ganz gewiefter Anwalt, wählte der Präsident auch dieses Mal Formulierungen, die ihm noch Schlupflöcher ließen, keine Falschaussage gemacht zu haben. So lieferte Clinton eine Neudefinition, was denn eigentlich »Geschlechtsverkehr« sei, und schickte sich sogar an, das Wort »ist« neu zu definieren – wenig überzeugend: »Es hängt davon ab, was Sie unter dem Wort ›ist‹ verstehen. Wenn das ... wenn er ... wenn ›ist‹ bedeutet: ist und ist nie gewesen, dass nicht ist – dann ist das eine Sache. Wenn es bedeutet, da ist nichts, dann war es eine vollkommen zutreffende Aussage.« Doch mit dem Aussagemarathon vor der Grand Jury war der Tag für Clinton noch nicht ausgestanden. Am Abend musste er vor die Fernsehnation treten und Farbe bekennen.
Nach einem knappen »Guten Abend« kam er schnell zum Wesentlichen. Sein Blick war starr in die Kamera gerichtet, der Bildhintergrund karg. Nur ein Blumenstrauß, der hinter Clintons linker Schulter hervorlugte, bildete eine etwas klägliche Dekoration. Dass die Blüten in verschiedenen Violetttönen changierten, der Farbe der Buße, mag Zufall gewesen sein, doch wenn, dann war es ein passender. Denn Bill Clinton hatte einen Bußgang vor sich, wie es ihn seit jener sprichwörtlichen Abbitte Heinrichs IV. in Canossa kaum mehr gegeben hatte. Und hätte Clinton die Wahl gehabt, hätte er sicherlich den eisigen Schnee und das härene Büßergewand dem starren Auge der Kamera vorgezogen.
»Heute Nachmittag in diesem Raum habe ich vor dem unabhängigen Ermittler und der Anklagejury ausgesagt«, fuhr der Präsident fort. »Ich habe ihre Fragen wahrheitsgemäß beantwortet. Auch Fragen über mein Privatleben. Ich weiß, dass meine öffentlichen Äußerungen und mein Schweigen in dieser Angelegenheit einen falschen Eindruck erweckt haben. Ich habe Menschen getäuscht, auch meine Frau. Jetzt ist es eine Sache zwischen mir und den beiden Menschen, die ich am meisten liebe, meiner Frau und unserer Tochter – und unserem Gott.«
Seine Berater waren sich schnell einig, dass sich der Präsident mit seiner Performance keinen Gefallen getan hatte. Arrogant, trotzig und irgendwie beleidigt hatte er die Worte herausgestoßen. Es war das rotzige Verhalten eines bei einem Unfug ertappten Jungen, nicht der souveräne Auftritt eines Staatsmanns, der einen Fehler eingesteht. Viele Beobachter sind sich einig, dass eine emotionalere, aufrichtigere Rede Clintons an diesem Abend die noch monatelang weitergehenden Untersuchungen, inklusive der Veröffentlichung des schlüpfrigen Starr-Reports, hätte verhindern können. Doch offenbar hatte das Gespür des Mannes, der sonst instinktiv auf Stimmungen reagieren konnte, der erschnüffelte und erfühlte, was das Publikum von ihm wollte, zu diesem Zeitpunkt völlig versagt. Der Skandal hatte ein Ausmaß erreicht, das Clinton nicht mehr handhaben konnte. Das Nachrichtenbild, mit dem sich die Clintons am folgenden Tag zunächst einmal von der Washingtoner Bühne verabschiedeten, sprach Bände. Das Pärchen, das sich bis dahin in der Öffentlichkeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den Armen gelegen hatte, ging auf Abstand. Beim Abflug ins Urlaubsdomizil Martha’s Vineyard konnten sie die Fassade nicht mehr aufrecht erhalten. Die verständige Chelsea rettete den Moment, indem sie beide Eltern an die Hand nahm und sie zum wartenden Hubschrauber führte. Aber auch ihr Lächeln wirkte gequält. Allein First Dog Buddy, der fröhlich an Clintons rechter Seite sprang, schien den Chef nicht zu ächten.
Der Urlaub in Martha’s Vineyard wurde eine Katastrophe. Hillary war über das Verhalten ihres Mannes in den vergangenen Monaten einfach zu tief verletzt. »Er versuchte immer wieder, mir die ganze Sache zu erklären, und beteuerte, wie Leid ihm alles täte. Doch ich war noch nicht einmal so weit, dass ich mich im selben Raum wie er aufhalten konnte, geschweige denn, dass ich ihm hätte verzeihen können«, erinnert sie sich. Der Sünder wurde aus dem gemeinsamen Schlafzimmer auf die Wohnzimmercouch verbannt und durch ausgedehnte Strandspaziergänge gemieden. Für Hillary Clinton stand mehr auf dem Spiel als ihre Liebesbeziehung. »Die Tage waren leichter als die Nächte. Ich fragte mich, an wen ich mich wenden sollte, jetzt, da mein bester Freund, der mir in schwierigen Zeiten immer zur Seite gestanden hatte, der Mensch war, der mir so viel Leid zugefügt hat. Ich fühlte mich vollkommen allein, und für Bill galt wohl dasselbe.«
Ich fühlte nichts außer tiefer Traurigkeit, Enttäuschung und aufgestautem Ärger. Ich kam mir vor wie ein Trottel. Mein Herz war gebrochen. Ich war wütend, dass ich ihm überhaupt geglaubt hatte. Ich konnte kaum mit Bill sprechen. Und wenn, dann waren es Beschimpfungen. Ich las. Ich ging am Strand spazieren. Er schlief unten, ich schlief oben. Buddy, der Hund, leistete Bill Gesellschaft. Er war das einzige Mitglied unserer Familie, das dazu überhaupt noch willens war. ■ Hillary Clinton, »Gelebte Geschichte«
Irgendwann in dieser Zeit muss für beide Clintons die Entscheidung gefallen sein, den Kampf um ihre Ehe nicht verloren zu geben. »Als Ehefrau wollte ich Bill den Hals umdrehen. Doch er war nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein Präsident, und er führte Amerika in einer Art, die ich nach wie vor befürwortete. Was auch immer er getan hatte: Ich war der Meinung, dass kein Mensch eine derart grausame Behandlung verdient hatte, wie sie ihm zuteil wurde«, so Hillary Clinton in ihren Memoiren. Doch die Wunden verheilten nicht so schnell. Bill Clinton seinerseits versuchte sich ohne weitere persönliche und politische Fehler durch den Washingtoner Alltag zu manövrieren. Auch ihm war mittlerweile klar geworden, dass seine Fernsehansprache nicht ausgereicht hatte, die Herzen des Volkes wieder zurückzugewinnen. Wie ein Flagellant, der sich selbst die Peitsche gibt, zog Clinton nun von Veranstaltung zu Veranstaltung. Er entschuldigte sich öffentlich wieder und wieder bei seiner Frau, seiner Tochter, ja sogar bei Monica Lewinsky und deren Familie. Tatsächlich machte er damit in Umfragen erhebliche Punkte gut. Nun gut – Bill Clinton hatte gelogen. Nun gut – er hatte eine Affäre gehabt. Die Öffentlichkeit war die schäbige Schlammschlacht zunehmend leid. Als der Starr-Bericht veröffentlicht wurde, war die Empörung darüber, dass man so etwas ins Internet stellte, größer als die Abscheu gegenüber den zu lesenden Verfehlungen des Präsidenten. Um Hillary zurückzugewinnen aber, bedurfte es mehr als einer Endloslitanei von Entschuldigungen. Woher sie die Kraft und auch den Willen nahm, weiterhin zu ihrem Mann zu stehen, ist die große Frage der Geschichte dieses Paares. Ihr Jugendpfarrer Don Jones hat dafür eine einfache und wahrscheinlich auch die einzig zutreffende Erklärung: »Hillary hat jeden Sonntag ihres Lebens einen Gottesdienst in der methodistischen Kirche besucht und dort gebetet: Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern«, sagt Jones. »Und ich erinnere die Leute immer daran, dass das für sie nicht nur eine Phrase ist. Es ist ein aufrichtiger Akt der Frömmigkeit. Sie spürt eine Verpflichtung, zu vergeben. Sie trägt ihren Glauben nicht auf die Stirn geschrieben, sie lebt ihn.«
Sie haben ganz unterschiedliche Temperamente. Er kann unglaublich sauer werden, läuft rot an im Gesicht, schreit herum, flucht – eine Minute später ist alles vorbei und er ist wieder dein bester Freund. Hillary hat eine ganz andere Art, eine viel weiblichere. Wenn sie sauer ist, schweigt sie. Diese Methode wendet sie gegenüber Bill an. Und nichts ist für einen Mann schwerer, als mit diesem Schweigen umzugehen. ■ Robert Boorstin, Redenschreiber von Clinton
Ihre ehrliche Religiosität und ihr unerschütterliches Vertrauen in die Unauflöslichkeit der Ehe waren die Rettungsanker, an die sich Hillary in diesen schwierigen Monaten klammerte. Und auch ihr Mann suchte geistlichen Beistand. Er bat drei Seelsorger, sich mindestens einmal im Monat Zeit für ihn zu nehmen. »Wir beteten miteinander, lasen in der Bibel und unterhielten uns über einige Dinge, über die ich bis dahin nie wirklich gesprochen hatte«, berichtet er in »Mein Leben«. Ein Jahr lang unterzogen sich die beiden Clintons einer Ehetherapie. Erste zaghafte Erfolge wurden spürbar. »Bis dahin schlief ich auf einer Couch in dem kleinen Wohnraum neben unserem Schlafzimmer. So hatte ich viel Zeit, zu lesen, nachzudenken und zu arbeiten. Die Couch war ziemlich ungemütlich, aber ich hoffte, nicht den Rest meiner Tage dort verbringen zu müssen.«
Ein Drittel der Amerikaner war der Meinung, dass Bill einfach ein unmoralischer Mensch war mit seinen Frauengeschichten. Und ein anderes Drittel sagte: Er hat schon Moral, ist aber einfach zu schwach. Und sie gingen so weit zu sagen, dass Bill so schwach war, weil Hillary so stark war. ■ Dick Morris, Berater Clintons
Als sich die Ereignisse beruhigten, und der Sturm der Entrüstung sich gelegt hatte, registrierte die staunende Öffentlichkeit, dass das Ehepaar Clinton noch immer zusammen war. Und sie machte sich ein neues Bild von den Clintons, das sich gravierend von dem unterschied, das man seit nunmehr zwei Jahrzehnten gewohnt gewesen war. War es bislang fast immer Bill gewesen, dem die Sympathien gegolten hatten, hatte seine Frau plötzlich erheblich Punkte gutgemacht. »Der Skandal hat die öffentliche Wahrnehmung von Hillary geändert«, sagt Robert Boorstin, »sie war nicht länger die Schlange – sie war plötzlich das Opfer.« Die größtmögliche Demütigung hatte ihrem Image nicht geschadet – ganz im Gegenteil. Die in ihrer Perfektion für viele Menschen Furcht einflößende »Frau an seiner Seite« war auf ein Normalmaß geschrumpft und plötzlich Identifikationsfigur nicht nur für betrogene Ehefrauen geworden. Dass sie die Geschichte ausgestanden hat, ohne die Beleidigte zu spielen, ohne ihrer Wut und ihren Verletzungen nachzugeben, ist bemerkens- und wahrscheinlich auch bewundernswert.
In den langen Sitzungen bei der Eheberatung und in unseren anschließenden Gesprächen lernten Hillary und ich einander von neuem kennen – unabhängig von verbindenden Elementen wie unserer Arbeit, unseren gemeinsamen Vorstellungen und unserem gemeinsamen Kind, das wir beide vergötterten. ■ Bill Clinton, »Mein Leben«
Hillary Clinton zitiert oft einen Spruch Eleanor Roosevelts: »Frauen sind wie Teebeutel. Du weißt nicht, wie stark sie sind – bis du sie in heißes Wasser tauchst.« Sie hatte bewiesen, wie stark sie sein konnte, und entschied sich zu einem Schritt, den vor ihr keine First Lady gegangen war. Im Sommer 1999 begann Hillary ihren eigenen Wahlkampf. »Sechzehn Monate, drei Debatten, zwei Gegner und sechs schwarze Hosenanzüge später«, wie sie in ihrer Dankesrede scherzte, hatte sie ihn gewonnen. Am 8. November 2000, in jener dramatischen Wahlnacht, in der die Demokraten das Weiße Haus verloren, eroberte Hillary Clinton ein eigenständiges politisches Mandat: einen Senatorensitz des Staates New York. Um 23.06 Uhr traf sie im Grand Hyatt Hotel ein, um sich von ihren Anhängern angemessen feiern zu lassen. In einem himmelblauen Hosenanzug stand sie allein vor einer Phalanx von Männern in schwarzen Anzügen und hielt eine ruhige, fast bescheiden anmutende Rede. Und nicht wenige blickten in diesem Moment nicht auf sie, sondern auf den Mann im Hintergrund. Ganz still stand er da, hielt die Hand von Tochter Chelsea und lächelte – ein Lächeln voller Stolz auf seine Frau, die Senatorin Hillary Clinton. Die Frage, wie die Zukunft der Clintons aussehen wird, ist zum beliebten Augurenspiel der politisch Interessierten geworden. Nach der Wahlniederlage von John F. Kerry sehen nicht wenige in Hillary Clinton die demokratische Präsidentschaftskandidatin für das Jahr 2008. Sie selbst hält sich vornehm zurück, will sich nicht allzu früh aus der Deckung wagen. Doch umso freudiger stürzen sich Journalisten und Politiker in Spekulationen. Die meisten trauen ihr zu, das Ruder für die gebeutelten Demokraten herumzureißen. Die Zeit scheint reif zu sein für die erste Frau im mächtigsten Amt der Welt. »Ich bin mir sicher, dass sie 2008 antritt«, sagt Präsidentenberater Dick Morris, »und Bill wird wie ein Löwe für sie kämpfen.« Es wäre eine ganz neue Rolle für den Mann, der immer im Vordergrund stand. Hollywood-Regisseur und Clinton-Freund Wolfgang Petersen freut sich schon jetzt auf die Vorstellung: »Es wäre ja wirklich zum Piepen, wenn der Clinton zum, ja wie nennt man das eigentlich, zum ›First Man‹ werden würde in Amerika.« Die meisten sind sich einig, dass Bill Clinton auch an dieser Position Spaß finden würde. Carolyn Yeldell Staley, die Bill Clinton von Kindesbeinen an kennt, ist sich sicher: »Er würde die Rolle des First Gentleman mit großer Würde ausfüllen. Sie würde weiterhin auf seinen Rat hören und darum bitten. Sie kennt seine Fähigkeiten und sein großes Herz und würde beides einsetzen. Es wäre eine großartige Sache.«
Es gibt drei Frauen in Bills Leben, die wirklich wichtig sind – vergessen Sie seine Freundinnen und seine vermeintlichen Freundinnen –, Virginia, Hillary und Chelsea. ■ Kati Marton, Biographin Hillarys
Und die private Seite der Geschichte? Die Clintons haben sich ein Haus in Chappaqua, New York, gekauft, führen eine Ehe, in der sich die Senatorin und der aktive Frühpensionär seltener sehen, aber ständig Kontakt halten. »Sie hören nie auf, miteinander zu reden«, sagt Hillary-Biographin Kati Marion in einem Interview. »Viele alte Ehepaare sehen sich plötzlich an und haben sich nichts mehr zu sagen. Hillary und Bill haben eine Sprache, die ansonsten niemand spricht. Es ist nicht nur so, dass der eine den Satz des anderen beenden kann, es ist noch mehr zwischen ihnen. Eine Art Energie und ganz viel gegenseitige Bewunderung. Und das nach drei Jahrzehnten.« Jugendfreund Joe Purvis meint: »Sie lieben sich noch immer. Sie sind noch immer verliebt ineinander. Und ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben.«
Sie hat in New York wegen ihrer Persönlichkeit gewonnen, wegen ihrer Intelligenz und ihrer Bereitschaft, Gutes für die Menschen zu tun. Es ist nicht unbedingt wie beim Präsidenten – »Wenn man ihn trifft, liebt man ihn« –, aber Leute, die Hillary treffen, sind sehr beeindruckt von ihr. Selbst wenn sie sie nicht lieben, sind sie von ihrer Intelligenz gefesselt, von ihrer Stärke und von ihrer Fähigkeit, das Wichtige zu erkennen. ■ Robert Boorstin, Redenschreiber von Clinton