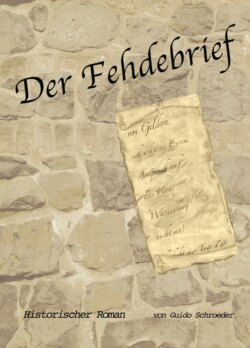Читать книгу Der Fehdebrief - Guido Schroeder - Страница 5
Kapitel 2 - Entführt
ОглавлениеAls Stephan erwachte, schien ihm der Kopf zu platzen. Solch hämmernde Kopfschmerzen waren ihm bis zum heutigen Tage fremd gewesen. Er betastete vorsichtig sein Gesicht, die Augen immer noch geschlossen. Eine böse Schwellung hatte sich über seine rechte Gesichtshälfte gezogen. Was war passiert? Was waren das für seltsame Geräusche? Und warum bewegte sich seine Schlafstatt? Langsam erinnerte er sich an die Geschehnisse der vergangenen Nacht. Oder war seither die Sonne bereits ein zweites Mal aufgegangen?
Mit einer Welle der Angst, Verzweiflung und Übelkeit wurde ihm bewusst, welch schreckliches Schicksal seiner Familie, ja seinem ganzen Dorf widerfahren war. Mutter! Was war mit ihr geschehen? Er war nun ihr Beschützer. Er dachte über die letzten Augenblicke des Erlebten nach. Sein Angriff auf den Soldaten war anscheinend nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Er gestand sich ein, nachdem was er im Dorf gesehen hatte, dass nicht viel Hoffnung für ihn bestand. Doch an diesen Funken wollte er sich klammern.
Stephan öffnete vorsichtig die Augen, nur um von einer neuen Welle Kopfschmerz überwältigt zu werden. Zuerst konnte er seine Umgebung nur schemenhaft erkennen. Er saß in einem Wagen, welcher von zwei Arbeitspferden gezogen wurde, was die Geräusche und die Bewegungen erklärte. Um ihn herum saßen drei Jungen und zwei Mädchen aus seinem Dorf und starrten ihn an. Ihren Mienen zufolge hatten sie bei dem Überfall auf ihr Dorf ähnlich harte Schicksalsschläge hinnehmen müssen wie er. Er selbst war der älteste von ihnen. Nur selten hatte er mit den Mitgliedern seiner unfreiwilligen Reise-gemeinschaft gespielt. Der Jüngste dürfte höchstens vier Jahre alt sein, während Magdalena wohl schon sechs sein müsste. Er wusste nicht, wie er sich ihnen gegenüber verhalten sollte. War er nun auch ihr Beschützer? Als Beschützer gäbe er wohl ein schlechtes Bild ab, vor allem wenn ihm die Tränen die Wangen herunterliefen so wie in diesem Moment. Aber er konnte nichts dagegen machen.
Er schloss die Augen wieder und klammerte sich an den Hoffnungs-schimmer, dass seine Mutter noch leben würde. Da fiel ihm ein, dass sie in diesem Fall wohl auch in der Begleitung des Wagens sein müsste. Er zwang sich, nochmals die Augen zu öffnen und erhob sich halb, um über den Rand des Fuhrwerks blicken zu können.
Eine Schar von etwa 20 bis 30 Soldaten, teils auf einem Pferd, teils zu Fuß, konnte er vor und hinter dem Wagen ausmachen, jedoch keine andere Person. Selbst der Kutscher hatte die Kluft eines Soldaten an. Er wollte sich gerade der Umgebung widmen, um ein ungefähres Bild von ihrer Reiseroute zu bekommen, als einer der berittenen Soldaten neben ihm auftauchte, ihm einen Stoß vor den Kopf verpasste und ihn anherrschte, er solle gefälligst unten bleiben.
Nicht, dass er je genug gereist wäre, um ihre Position richtig einschätzen zu können. Er hatte dennoch das Gefühl, dass man so etwas in solch einer Situation machen sollte. Mutlos und verzweifelt sank Stephan in seine ursprüngliche Position zurück. Er schloss wiederum die Augen, um seinem gewaltigen Kopfschmerz ein wenig Linderung zu verschaffen. Zum Glück, dachte er, bestürmten ihn die Jüngeren nicht mit Fragen, wahrscheinlich hatten sie ebensolche Angst wie er. Was passiert mit mir?, fragte er sich. Werden die Soldaten uns auch töten? Nein, das würde wenig Sinn ergeben, dann hätten sie es schon bei dem Überfall auf das Dorf machen können, so wie sie mit all den anderen verfahren sind. Vielleicht würden sie an einem anderen Ort für ihren neuen Herrn harte Arbeit verrichten müssen. Eigentlich gefiel ihm die erste Alternative am besten. Was hatte er noch vom Leben? Sein Vater war tot, seine Schwester auch, er würde diesen grausamen Anblick niemals vergessen. Seine Mutter, ja seine Mutter. Er wollte bei der nächsten Gelegenheit abhauen und sie suchen. Darin bestand für den Moment seine Lebensaufgabe.
Da war aber noch etwas, was ihm immens wichtig erschien. Die traurige Besatzung des Fuhrwerks zu beschützen? Nein, ja doch, aber das war es nicht. Der Gedanke, etwas Wichtiges außer Acht gelassen zu haben, war immer noch da.
Und dann fiel es ihm wieder ein. Die letzten Worte seines Vaters, ausgesprochen mit einer Dringlichkeit, wie er es von seinem ansonsten schon strengen Vorbild nicht gewohnt war. Der Name ..., Gerard de Miletto, er hatte ihn behalten und nahm sich vor, ihn sich jeden Tag mindestens einmal ins Gedächtnis zu rufen, um ihn nicht zu vergessen. Jetzt hatte er schon zwei Gründe, um am Leben zu bleiben, eigentlich drei, das sollte für den Anfang genügen.
Nun fasste er ein wenig Mut und öffnete erneut seine Augen mit dem Vorsatz, seine Leidensgenossen durch einen aufmunternden Blick ein wenig zu trösten. Ob es ihm gelang, konnte er im Nachhinein nicht genau sagen, jedoch hatte er das Gefühl, dass zumindest in Magdalenas Gesicht ein wenig Dankbarkeit zu erkennen war. Etwas zu sprechen, getrauten sie sich immer noch nicht. Und so schliefen sie nach und nach wieder ein.
Als Stephan erwachte, ging es einem Kopf schon wieder wesentlich besser. Die Schwellung in seinem Gesicht begann allerdings noch nicht abzuklingen. Er fragte sich, wie er wohl aussehen möge. Er hatte in seinem Leben schon das eine oder andere Veilchen gehabt und es endete meistens mit einem schillernden Farbenwirrwarr. Er mochte sich gar nicht ausmalen, wie er nun aussah. Wahrscheinlich war dies auch der Grund, warum er vorhin so angestarrt worden war. Aber das war nun wirklich sein geringstes Problem.
Das Fuhrwerk bewegte sich nicht mehr, und es war tiefe Nacht. Die Mitinsassen des Fuhrwerks schliefen alle. Stephan richtete sich nochmals halb auf und spähte über den Rand. Offenbar hatte man hier ein Lager für die Nacht errichtet. Die Soldaten schliefen alle in der Nähe des Feuers, das fast herunter gebrannt war, bis auf zwei Gestalten, die sich abseits des Feuers knapp außerhalb des Lichtkreises befanden. Er konnte nur noch ihre Umrisse erkennen. Allerdings ließ deren Haltung darauf schließen, dass auch sie während ihrer Wache eingeschlafen waren. Ist das die Gelegenheit zur Flucht?, dachte Stephan mit einem Mal, und Adrenalin schoss ihm durch den Körper. Er war hellwach. Eine seiner Aufgaben verlangte nach Erfüllung. Er dachte darüber nach, wie er es am besten anstellen sollte, als ihm bewusst wurde, dass er nicht die geringste Ahnung davon hatte, wo sie sich befanden. Wahrscheinlich würde er sich verlaufen und wilden Tieren zum Opfer fallen oder verhungern. Außerdem könnte er in diesem Falle der Aufgabe des Beschützers der Kinder nicht mehr nachkommen. Somit war es für diesen Moment klar, er würde eine bessere Gelegenheit abwarten. Sobald er alles in seiner Macht Stehende für die fünf Jungen und Mädchen getan hatte und sich besser in der Umgebung auskannte, wollte er einen Versuch starten.
Als er nochmals über die Verpflegung nachdachte, die für eine Flucht von Nöten war, merkte er, dass er kurz vor dem Verhungern stand. Er hatte schon ewig nichts mehr gegessen. Stephan inspizierte seine Umgebung und bemerkte zwei Laibe Brot, die die Soldaten ihren Gefangenen, oder wie sie sich auch immer bezeichnen sollten, in den Wagen geworfen hatten. Zwei Laibe Brot für vier Jungen und zwei Mädchen, das war nicht sonderlich viel. Doch zum Überleben reichte es, zumal alle den vorletzten Winter miterlebt hatten, der aufgrund der missratenen Ernte fast das Ausmaß einer Hungersnot angenommen hatte. Er brach sich ein kleines Stück ab, kleiner als es ihm eigentlich zustand. Es war ziemlich hart, dennoch war es ein Hochgenuss für seinen ausgehungerten Körper. Nachdem er noch einen Schluck Wasser aus der Schale zu sich genommen hatte, verfiel er in Gedanken über die Dinge, die für ihn unwiederbringlich verloren waren.
Stephan konnte sich nur dunkel an seine ersten Lebensjahre erinnern. Aber er wusste, dass er nicht immer in seinem Dorf gelebt hatte. Er konnte sich erinnern, dass ganz am Anfang alles anders gewesen war. Er hatte in einem großen Gebäude gelebt, die Wände waren nicht aus Holz gewesen, der Boden hatte nicht aus fest getrampeltem Lehm bestanden, und es war immer warm gewesen. Hunger war ihm unbekannt gewesen, und die schrecklichen Gerüche von altem Stroh hatte es wohl damals auch nicht gegeben. Aber vor allem konnte er sich daran erinnern, dass sein Vater dauernd bei ihnen gewesen war. Auch war die Kleidung seiner Eltern viel bunter gewesen.
Er hatte sich in den vergangenen Jahren oft gefragt, was wohl geschehen war. Er hatte den Eindruck, dass er ein glückliches, wohl behütetes Leben gegen eines mit harter Arbeit, der ständigen Bedrohung von Hunger und Kälte und ohne eine richtige Familie eingetauscht hatte. Eines Nachts war er mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern von diesem Paradies aufgebrochen und in ein kleines Dorf gekommen, das von diesem Zeitpunkt an ihr zu Hause gewesen war. Stephan konnte nicht genau sagen, ob das seine eigenen Erinnerungen waren oder sie lediglich aus den kargen Erzählungen seiner Mutter stammten. Jedenfalls wusste er, dass eines seiner drei Geschwister die Reise nicht überlebt hatte. Sein zweiter kleiner Bruder war im ersten Winter nach ihrer Ankunft gestorben. Auch an ihn konnte er sich nur ganz vage erinnern. Viel deutlicher war das Bild seiner verzweifelten Mutter vor seinem geistigen Auge. Er konnte es damals noch nicht richtig verstehen, wusste nur, dass etwas Schreckliches geschehen war.
Sein Vater war seit ihrer Ankunft im Dorf nur noch sehr selten zu Hause, und wenn er einmal da war, hatte er viel im Dorf zu erledigen, besprach sich lange mit seiner Mutter und hatte nur sehr wenig Zeit für Stephan und seine Schwester. Das Lachen seines Vaters, dass ihm in seinen ersten Lebensjahren das Gefühl absoluter Glückseligkeit gegeben hatte, hatte er kein einziges Mal mehr zu hören bekommen. In den wenigen Gesprächen, die sie geführt hatten, ging es immer nur um eines. Stephan solle hart für seine Mutter und seine Schwester bei einem benachbarten Bauern arbeiten, damit sie wenigstens etwas in den Magen bekamen. Abends übten sie dann mit Mutter gemeinsam lesen, wobei sie ihr schwören mussten, niemandem etwas davon zu erzählen.
Stephan war das ganz recht gewesen, er hätte sich wohl den Spott der anderen Jungen zugezogen. Sein Vater erklärte ihm, dass er wichtige Angelegenheiten zu erledigen hätte und ihm nicht mehr sagen könne. Er würde aber alles dafür tun, dass es ihnen bald wieder besser gehen würde. Nun fiel ihm auch wieder ein, wie verändert Vater war, als er kurz vor der Katastrophe von einer seiner Reisen zurückkam. Das war das erste Mal seit langem, dass eine Art Lächeln in Vaters Gesicht zu sehen war. Er schien nicht mehr so angespannt und umarmte alle Familienmitglieder ungewöhnlich intensiv. Das war einen Tag vor dem Überfall. Auch seine Mutter beantwortete Stephans brennenden Fragen nach seinem Vater nicht. Es sei sicherer für ihn, wenn er von all dem nichts erfahre, hieß es immer. So arbeitete er tagein, tagaus auf dem Feld. Seine Mutter und seine Schwester arbeiteten ebenso hart, dennoch merkte er, dass sie eine Außenseiterrolle in dieser Dorfgemeinschaft innehatten. Sie wurden zwar mit Respekt behandelt, doch entgingen ihnen die verstohlenen Blicke und die Gespräche hinter vorgehaltener Hand der anderen Dorfbewohner nicht.
Sie waren allerdings auch die einzigen, die keinen erwachsenen Mann im Haus hatten. Jede der anderen Familien hatte einen Hausherren, der ständig zugegen war. Starb ein Familienoberhaupt, so zog die Familie unmittelbar nach der Beerdigung fort, wahrscheinlich zu Verwandten, oder ordnete sich einem anderen Haushalt unter. Dabei gingen die spärlichen Besitztümer immer an das neue Familienoberhaupt über. Ihre Situation, zwar mit einem Mann im Haus, der jedoch nie da war, war außergewöhnlich.
Es war zwar ihr Zuhause, und einige schöne Tage hatte auch Stephan erlebt, aber er hatte ständig das Gefühl, fehl am Platze zu sein.
Zum Glück für Stephan war den gleichaltrigen Jungen ihr Status egal. Vielleicht lag es auch an seiner körperlichen Überlegenheit den meisten Jungen gegenüber, jedenfalls fühlte er sich in deren Umgebung immer wohl, auch wenn sie nur wenige Stunden in der Woche zur Verfügung hatten, gemeinsam zu spielen. Wenn sie am heiligen Sonntag nach der Kirche die Gelegenheit hatten, weil sie mal nicht den Haushalt in Ordnung zu bringen hatten, spielten sie im Wald Räuber und Ritter. Stephan zog es vor, auf der Seite der Schurken mitzumischen. Der Ehrenkodex der Ritter schien ihm unlogisch. Warum sollte er jemandem Gnade gewähren, der kurz zuvor versucht hatte, ihm den Schädel einzuschlagen? Einmal waren sie beim Raufen erwischt worden. Da hatten sie alle zusätzlich so arge Prügel bezogen, dass sie sich am nächsten Tag kaum wieder erkannt hatten. Nachdem die Schmerzen allerdings verflogen waren, sahen sie es als eine Art Härteprüfung an und verabredeten sich gleich für einen neuen „Raubzug“, sobald es die Zeit erlaubte.
Als er so darüber nachdachte, vermisste er seine Freunde schmerzlich. Alle waren etwas älter als er gewesen, und da von ihnen niemand mit in diesem Fuhrwerk unterwegs war, musste Stephan davon ausgehen, dass ihnen ähnliche oder gar schlimmere Dinge als Michael widerfahren waren.
Langsam erhellte sich der Horizont, und es kam wieder Leben in das Lager. Auch die anderen Kinder wachten auf, und die Soldaten gaben ihnen sogar etwas kaltes Fleisch, das vom Abend und nach deren Frühstück übrig geblieben war. Danach ging ihre Reise weiter. Es war ein regnerischer Tag, und trotz ihrer Schwermut begann Stephan, so unauffällig wie möglich mit den anderen Kinder zu kommunizieren. Aufgrund der Kälte schmiegten sich alle eng aneinander, wobei es Magdalena irgendwie schaffte, mit einem Mal einen Platz neben Stephan zu ergattern. Er genoss den Umstand, ihnen Trost spenden zu können. Das lenkte ihn von seinem eigenen Kummer etwas ab.
So fuhren sie über einen matschigen Weg. Zweimal mussten sie sogar absteigen und dabei helfen, den Karren aus dem Dreck zu schieben. Gegen Mittag kamen sie verdreckt und durchgefroren an einem riesigen Gebäude aus Stein an. So etwas hatte von ihnen noch niemand zuvor gesehen. Angst davor was nun mit ihnen geschehen würde, überfiel sie ,als sie das schwere Tor passierten. Stephan entschloss sich, vom schlimmsten Fall auszugehen. So konnte er wenigstens seine Angst etwas im Zaum halten, und er schwor sich, es seinen Häschern nicht allzu leicht zu machen. Aber wie so oft kam alles anders.