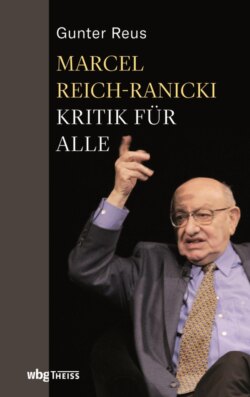Читать книгу Marcel Reich-Ranicki - Gunter Reus - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hass und Sympathien: die Schriftsteller
ОглавлениеDirektheit und Entschiedenheit in der Auseinandersetzung, Entpathetisierung der Sprache und Demokratisierung der Literatur durch Journalismus – damit sind wesentliche Töne im Lebenswerk Marcel Reich-Ranickis angeschlagen, um die es in diesem Buch gehen wird. Sie hätten ihn nach der Jahrhundertwende gewiss zu einem Opfer giftigster Kraus’scher Polemik werden lassen. Doch auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts trieben Reich-Ranicki, der von Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit ebenfalls wahrhaftig nicht frei war, seine Grundsätze Gegner und Feinde zu.
Er hat dies in Interviews mehrfach beklagt, und er litt daran, auch wenn er meinte, Angriffe auf einen Kritiker lägen in der Natur der Sache. Er litt daran, dass ihn Peter Handke (dem er in Rezensionen schwer zugesetzt hat) in Die Lehre der Sainte-Victoire zum mordlustigen Wachhund machte, wie er in seiner Autobiografie gesteht. Er litt an heftigen Anwürfen von Rolf Dieter Brinkmann und Christa Reinig. Er litt daran, dass Martin Walser ihn in seinem Roman Tod eines Kritikers zum Zerrbild des jüdischen Kritikers missgestaltete und in einer Kurzgeschichte über ihn schrieb: „Meine Erfahrungen haben aus mir jemanden gemacht, der diesem Inspektor irgendwann einmal die Pfeife aus der Schnauze schlagen muß.“4 Erich Fried, der Freund, nannte ihn „erbarmungslos selbstgerecht lehrhaft“ und einen seiner Aufsätze „die abstoßendste Arbeit, die ich bisher von Dir kenne“; Rolf Hochhuth schrieb, Reich-Ranicki sei „entweder ein barbarischer Ignorant“ oder „ein bösartiger Heuchler“, weil er keines seiner Gedichte in der FAZ besprechen lasse; Stephan Hermlin verweigerte sich einer Umfrage und verwies auf den „unqualifizierbare[n] Blödsinn“5, den der Kritiker über ihn geschrieben habe. Mit nur noch wegwerfender Geste meinte Eckard Henscheid am 17. Februar 1977 in einem Leserbrief an die FAZ, nachdem dort ein Essay Reich-Ranickis über Karl Kraus erschienen war: „Ein alter, von Bosheit beseelter Literaturkritiker wollte seine eigene Parodie schreiben.“ Weitere abschätzige Schriftsteller-Urteile hat Uwe Wittstock in seiner Reich-Ranicki-Biografie zusammengetragen.
Es ist keine Frage, dass Marcel Reich-Ranicki mit seinen Rezensionen zahllose Autoren in ihrem Selbstwertgefühl verletzt, gekränkt und so gereizt hat, dass sie mitunter die Contenance verloren. Dieter E. Zimmer schrieb in einer Erinnerung an Reich-Ranickis Jahre bei der Wochenzeitung Die Zeit, der Kritiker sei damals bei jüngeren Autoren so verhasst gewesen, wie man es sich heute nicht mehr vorstellen könne. Aber er schrieb auch: „Es war ein Hass, der aus der Furcht kam, und hinter der stand auch eine Menge Respekt.“6 Das ist bemerkenswert. Denn durch die vielen Dokumente von Aversionen, Zerwürfnissen und zerbrochenen Freundschaften klingen doch immer auch Anerkennung und Respekt vor seiner Entschiedenheit durch. Man hasste diesen Marcel Reich-Ranicki nicht einfach, der da 1958 plötzlich auf den Treffen der Gruppe 47 aufgetaucht war und das Wort ergriffen hatte; man bewunderte durchaus auch – wenngleich gelegentlich mit Gänsehaut – sein feuilletonistisches Talent, seine Wortgewalt und seine journalistische Professionalität. Man wusste und erkannte: Seine Aufgabe ist die Kritik, und Kritik kann nun einmal verletzen. Und so changieren auch manche Schriftsteller-Urteile über ihn nicht selten auf engstem Raum zwischen Anerkennung und Furcht, zwischen Lob und Fluch: Eine „brillante Dampfwalze“ nannte ihn Urs Widmer, und Günter Herburger meinte: „Marcel Reich-Ranicki schwadroniert vortrefflich, was ich schätze.“ Mit ehrfürchtigem Schaudern vor der öffentlichen Hinrichter- und Aufrichterstätte wog der österreichische Schriftsteller Gerhard Roth Reich-Ranickis Aufgabe und massenmediale Kompetenz mit den nicht zu leugnenden Schattenseiten des Journalismus und des Kritikers ab:
„Das Publikum, unterschiedlich an Literatur interessiert, will sehen, hören – und lesen –, wie er hinrichtet, aufrichtet, zu Grunde richtet, abrichtet, einrichtet, verrichtet, berichtet. Es will den Daumen sehen, der hinauf oder hinunter weist, es ergötzt sich am inquisitorischen Schauspiel, an der eitlen Selbstdarstellung der Kritiker, die aus Ruhmsucht den elektronischen Jahrmarkt bedienen. Reich-Ranickis hohe Kompetenz, sein Selbstglaube, sein sarkastischer, gelegentlich selbstironischer Witz, seine ungehemmte Bereitschaft zur Vernichtung kontrastieren auffällig mit seiner ebenso hohen Inkompetenz, Lustlosigkeit, Verachtung, Bereitschaft zu Adorierung und Spott. Analyse schlägt um in Polemik oder Beweihräucherung, alles rhetorisch brillant […]. “7
Hatte Marcel Reich-Ranicki unter den Schriftstellern mehr Feinde als Freunde? Er empfand es so, und sein Schüler Frank Schirrmacher in der Literaturredaktion der FAZ sah es ähnlich. Die Klage dürfte, was emotionale Vertrautheit und menschliche Bindung an andere angeht, auch zutreffen. Aber zu glauben, er wäre von Schriftstellern nicht auch gebraucht, wertgeschätzt, gemocht – also in Ausübung seiner Profession durchaus geliebt worden, wäre ein Irrglaube. Die Zahl positiver oder zumindest dankbarer Autorenzeugnisse, von Walter Jens oder Hilde Domin, Hilde Spiel oder Horst Krüger, Sarah Kirsch oder Wolfgang Koeppen, Peter Rühmkorf oder Eva Demski und vielen anderen, ist trotz all der Reibereien und Brüche eindrucksvoll. Davon zeugen etliche Anthologien, wie der von Hubert Spiegel herausgegebene Band Begegnungen mit Marcel Reich-Ranicki. Der Literaturchef der FAZ hat eine große Zahl von Autorinnen und Autoren wenn nicht freundschaftlich, dann doch väterlich gefördert, wie etwa Jurek Becker, Ulla Hahn oder Hermann Burger. Am engsten war ein Leben lang sein Verhältnis zu Siegfried Lenz, der seine Verlässlichkeit als Redakteur hervorhob und damit die journalistische Rolle Reich-Ranickis ausdrücklich lobte. Das tat auch der Lyriker und damalige Hanser-Verleger Michael Krüger, als er die existentielle Notwendigkeit literarischer Kritik für Literatur und Publikum und zugleich das Vorbild Reich-Ranicki hervorhob. Eine literarische Kultur, so Krüger, brauche „eigentlich zehn oder fünfzehn Reich-Ranickis, dann natürlich mit verschiedenen Ansichten und verschiedenen Präferenzen, um sozusagen einen Chor zu finden, der die verschiedenen literarischen Äußerungsmöglichkeiten in irgendeiner Weise zu einer Literatur zusammenzwingt“. Deshalb wünsche er sich, der Kritiker „würde jetzt sich zu seinem Geburtstag eine Klasse an der Universität aufbauen, wo er 30 bis 40 junge Reich-Ranickis heranzieht“.8