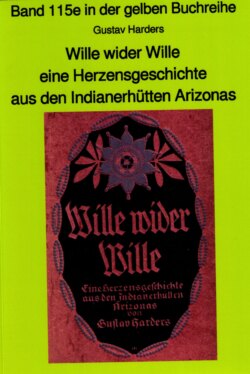Читать книгу Wille wider Wille - aus den Indianerhütten Arizonas - Band 115 in der gelben Buchreihe bei Jürgen Ruszkowski - Gustav Haders - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die verlassene Missionsstation
ОглавлениеDie Erlebnisse des Tages folgen dem Menschen gar oft in der Ruhe der Nacht. Man muss sie noch einmal wieder durchmachen, aber selten in einer verbesserten Auflage. Ich schlief sehr unruhig, wachte oft auf und hatte immer geträumt. Band war ich mit Dohaschtida zusammen, bald mit dem davongelaufenen Mädchen, bald mit beiden zusammen. Sobald ich wieder einschlief, träumte ich auch wieder, und immer wieder waren diese beiden Gegenstand meiner Traumgebilde. Im Moment des Erwachens wusste ich, was ich geträumt hatte, aber sofort verschwanden alle Einzelheiten aus meinem Gedächtnis, nur dass es die beiden wieder gewesen waren, blieb haften. Sonderbar, Dohaschtida und das durchgebrannte Mädchen. Die beiden hatten doch gar nichts miteinander zu tun.
Beim Frühstück, das wie alle Mahlzeiten von sämtlichen Angestellten der Schule gemeinschaftlich eingenommen wurde, war das Gesprächsthema das während der Nacht fortgelaufene Mädchen. Ich beteiligte mich natürlich nicht an der Unterhaltung, hörte aber sehr aufmerksam zu. Der Schulname der Entlaufenen war Nona Kerston, mit ihrem Indianernamen hieß sie Najodikahi. Sie galt für eine hochbegabte Schülerin und war etwa siebzehn Jahre alt. Alle Lehrer und Lehrerinnen waren davon überzeugt, dass sie sehr viel gelernt hatte und beständig sehr viel dazu lerne. Sie zeigte aber und nur, wenn sie dazu gezwungen war, wie viel sie sich auf allen Gebieten des Wissens angeeignet hatte.
Najodikahi war schon wiederholt fortgelaufen und zurückgebracht worden. Die Matrone, die die Aufsicht im Schlafsaal der großen Mädchen hatte, erklärte, sie werde Nona Kerston zur Strafe ihre Haare kurz schneiden. Najodikahi würde dann nicht eher wieder weglaufen und unter die Indianer zurückkehren, als bis die Haare wieder gewachsen seien. „Man kann den Indianermädchen kein größeres Herzeleid antun“, sagte die Dame, „als wenn man ihnen die langen, dicken, glänzenden, schwarzen Haare, auf die sie so stolz sind, abschneidet. Ich tue das drum nicht gerade gern, aber ich muss mal wieder ein Exempel statuieren. Das Fortlaufen nimmt in letzter Zeit zu sehr überhand.“
Najodikahis Eltern lebten sieben Meilen nördlich von der Schule. Man hoffte, das Mädchen noch im Laufe des Vormittags wieder eingebracht zu haben. Zwei berittene Polizisten waren bereits unterwegs, um Najodikahi zurückzuholen.
Es ist meine Gewohnheit, wenn ich zu zeitweiligem Aufenthalt an einen fremden Platz komme, mich sofort um die Himmelsrichtungen zu kümmern, mir sieselben klar zu legen. Ich wusste nun, dass Najodikahi sich in der vergangenen Nacht nicht in nördlicher, sondern in südlicher Richtung von der Schule entfernt hatte. Ich hatte darum meine Bedenken, ob sie so schnell und bald, wie die Herren und Damen erwarteten, wieder in der Schule sein werde. Dachte ich an die bereitliegende große Schere der würdigen Matrone und die schönen, langen, schwarzen Haare des Mädchens, so stieg der Wunsch in mir auf, den ich freilich nicht laut werden lassen durfte, dass die Polizisten das Mädchen überhaupt nicht finden möchten, und dass Najodikahi niemals würde zurückgebracht werden.
Nachdem wir unser Frühstück verzehrt hatten, sagte ich zu Sims, dass ich Lust hätte, an diesem Morgen der verlassenen Missionsstation einen Besuch abzustatten. Sims erklärte, er habe freie Zeit und werde mich begleiten. Er gab Auftrag, zwei Pferde zu satteln. „Die Missionsstation ist nur etliche Meilen südlich von hier gelegen“, sage er, „in einer guten Stunde können wir dort sein.“
Die Pferde waren frisch, die Hitze war erträglich. Unsere Unterhaltung war sehr lebhaft, und ehe wir uns dessen versahen, waren wir bei der Missionsstation angelangt. Eine schmucke, aus weißem Sandstein aufgeführte Kapelle mit schlankem Turm, dessen Spitze ein weithin sichtbares vergoldetes Kreuz zierte, ein großes, aus Adobes errichtetes Schulhaus und ein halbes Dutzend Wohnhäuser für Lehrer und Missionare, samt den nötigen Stallungen lagen vor uns. Das ganze Anwesen war mitten in der Wüste erbaut worden. Kein Baum noch Strauch weit und breit, nur Kaktusstauden und niedriges Gestrüpp zwischen den Steinen und Felsblöcken. In weitem Umkreise lagen viele Indianerhütten.
„Also hier in der Wüste, mitten unter den Indianern hatten sich die Missionare niedergelassen?“ fragte ich.
„Die Indianer begannen erst hier ihre Hütten aufzuschlagen, nachdem die Missionare etliche Brunnen gegraben hatten. Die Indianer sind viel zu faul, so etwas zu tun. Das Wasser war ihnen willkommen, und noch heute hohlen sie sich ihren ganzen Wasserbedarf aus den Brunnen der Missionsstation. Sieh dort hinüber. Siehst du die beiden Indianerfrauen dort kommen, die auf ihren Köpfen die hohen Krüge tragen? Sie wollen zu den Brunnen der Missionare, um Wasser zu holen.“
Ich sah die Indianerinnen. Es war ein hübsches Bild, diese in leuchtenden Farben gekleideten Frauengestalten durch die so farblose Wüste dahingehen zu sehen.
Jetzt waren die beiden Frauen am Brunnen angelangt und lösten den Eimer, um ihn in die Tiefe hinabzulassen. Ich musste an die Samariterin am Jakobsbrunnen denken und an den Heiland, der am Brunnen saß, als die Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Ich konnte es mir nicht anders denken, als dass zu der Zeit, da die Missionare hier noch weilten, diese sich zu den Frauen gesellten, wenn sie zum Brunnen kamen. Aus diesem Gedanken heraus sagte ich zu Sims: „Es sitzt niemand mehr da und kommt auch niemand zu den Frauen, der ihnen lebendiges Wasser des Lebens anböte und reichte.“ Sims verstand mich und antwortete: „Nein, nicht mehr, die Zeiten sind vorüber.“
„Seit wie lange sind die Missionare und Lehrer fort?“ fragte ich.
„Es ist schon reichlich ein Jahr verflossen, seit der letzte Gottesdienst hier gehalten wurde.“
„Und niemand wohnt hier und bewacht das Eigentum?“
„Nein, niemand!“ sagte Sims und setzte hinzu: „Warum fragst du danach?“
„Ich sehe lauter unzerbrochene Fensterscheiben in den Häusern. In meinem zivilisierten Osten wären sicherlich alle die Fensterscheiben zu Zielscheiben für Steinwürfe geworden und bis auf die letzte von bösen Buben zertrümmert worden. Es wundert mich, dass dies hier nicht geschehen ist, wo doch nur Indianer wohnen, ‚Wilde‘, wie man sie zu nennen pflegt.“
„Mich wundert das gar nicht!“ sagte Sims. Wären diese Gebäude Eigentum der Regierung, alle Fenster und Türen wären zertrümmert worden. Die Indianer hassen uns. Aber die Missionare hatten die Zuneigung und das Vertrauen der Indianer. Ihnen würden sie so etwas nicht zu leide tun. Sie hoffen auch, dass die Männer und Frauen eines Tages zu ihnen zurückkommen. Möchtest du in die Gebäude eintreten? Ich habe die Schlüssel mitgebracht. Sie wurden mir zur Aufbewahrung übergeben.“
„Ja gern!“ sagte ich, uns so stiegen wir von unseren Pferden, banden dieselben an einen Zaunpfosten und näherten uns einem der Gebäude.
„In diesem Hause wohnte der Missionar, der als letzter die Missionsstation verließ!“ sagte Sims und schloss die Tür auf. Wir traten ein. Alles war in schönster Ordnung. Das Haus war möbliert. Die Möbel waren, wie Sims erklärte, zumeist Geschenke von Frauenvereinen und Eigentum der Synode.
Wir gingen durch mehrere Räume und gelangten zuletzt in das Arbeitszimmer des Missionars. Die Möbel stammten nicht aus einer Fabrik, sondern waren augenscheinlich von dem Missionar eigenhändig hergestellt worden: ein großer Schreibtisch, etliche Stühle und Bänke und Bücherregale. Ich näherte mich dem Schreibtisch. Dieser war nach der alten Mode gemacht, die Tischplatte war zugleich Deckel eines darunter sich befindenden Kastens, der Zur Aufnahme vom Schreibmaterialien, Heften, Schriftstücken und dergleichen diente. Ich schaute auf die Tischplatte und sah, dass in dieselbe zwei Reihen griechischer Worte eingeschnitzt waren. Das Schnitzwerk war eine sehr sorgfältige und saubere Arbeit. Ich nahm meine Gläser aus der Tasche, setzte sie auf und las:
Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
Ich hatte laut gelesen.
„Sind dir die Worte bekannt? fragte Sims.
„Nein“, sagte dieser, ich kann mich nicht erinnern, diese Worte je gehört zu haben.“
Ich wiederholte die Worte in deutscher Sprache: „Fremdling, meld‘ es zu Sparta, dass seinen Gesetzen gehorsam wir erschlagen hier liegen… Es ist die Grabschrift, die die Spartaner dem Lionidas und seinen 300 Getreuen auf das Löwendenkmal in den Thermopylen setzten.
Es ist dies nach meiner Meinung eine der sinnreichsten und vielsagendsten Gedenkschriften, die je in Stein gemeißelt wurden.“
„Ich verstehe das Wort nicht so recht!“ sagte Sims. Ich kann wenigstens nichts besonders Schönes in ihm entdecken.“
„Das Schöne liegt in dem Wort ‚Fremdling‘“, sagte ich. „Der Spartanerkönig Leonidas war im Jahre 480 vor Christi Geburt von seinem Volke mit 300 Spartanern nach den Thermopylen gesandt worden, um diesen Engpass, die Eingangspforte zu Griechenland, gegen die herannahenden Perser zu verteidigen. Sie konnten den Befehl nicht ausrichten, denn der Feind war ihnen an Zahl weit überlegen, aber sie hielten aus und kämpften, bis der letzte Mann gefallen war. Niemand blieb übrig, um Kunde nach Sparta zu bringen. Die Toten müssen den vorüberziehenden Fremdling bitten, das, was geschehen war, in Sparta zu melden.“
„Was mag die alte heidnische Grabschrift hier auf dem Schreibtisch in der Studierstube eines christlichen Missionars zu bedeuten haben?“ fragte Sims.
„Ich weiß nicht“, entgegnete ich, „die Frage bewegt auch mich. Du, der du den Mann gekannt hast, solltest leichter eine Erklärung finden und Antwort auf die Frage geben können als ich.“
Sims suchte zwischen den mitgebrachten Schlüsseln.
„Dieser hier wird’s sein!“ sagte er und steckte den Schlüssel, den er herausgesucht hatte, in das Schlüsselloch unter der Tischplatte. Der Schlüssel passte, er drehte sich im Schloss, und Sims hob die Tischplatte auf.
Wir beide schauten zugleich in den geöffneten Tischkasten. Und was sahen wir? Mitten in der geräumigen Lade lag … eine Bibel …eine Bibel … weiter nichts.
Tief erschüttert blickten wir einander an.
Wir verstanden die Grabschrift.
Lange sagte keiner von uns ein Wort. Schließlich brach ich das Schweigen. „Sims, sagte ich, „Fremdling, sag es zu Sparta… Sims, das gilt dir und das gilt mir. Melden sollen wir’s, sagen, kundtun, rufen, hineinschreien unter das Volk, unter die Christen, dass auf Befehl derer, die unter ihnen die Gesetze geben, die regieren und anordnen, dass durch diese das Evangelium vom Sündenheiland hier zum Schweigen gebracht ist, dass die Bibel geschlossen, verschlossen, begraben wurde, – wir sollen es den Christen klarmachen, dass sie sich von blinden Leitern leiten ließen, wenn sie ihren Zustimmung dazu gaben, die Missionsarbeit hier einzustellen. Sie hätten mehr tun sollen, anstatt aufzuhören. Sie hätten mehr Arbeiter anstellen sollen, als die Arbeit hier einzustellen. Sie haben dem Satan das Feld gelassen, weil er ihnen zu stark schien. Sie haben die Indianer in Satans Händen gelassen, weil sie kein Geld mehr opfern mochten. Sie haben die Arbeit für nutzlos und vergeblich erklärt, weil sie vergaßen, dass geschrieben stehet, dass Gottes Wort ausrichten soll und wird, wozu es gesandt ist.“
Wir vernahmen laute und eilige Schritte im Nebenzimmer. Sims schloss schnell den Tischkasten. Ein Indianerjunge, an seiner Kleidung als Schüler der Regierungsschule erkenntlich, trat ein und übergab Sims einen Brief. Sims öffnete und las.
„Dumm!“ sagte er in ärgerlichem Tone, „ich muss zurück. Es sind schon wieder ein paar Kinder fortgelaufen. Meine Leute scheinen sich nicht zu helfen zu wissen.“
„Wir reiten ein anderes Mal wieder hierher!“ sagte ich.
„Nein“, meinte er, „du kannst hierbleiben, wenn du willst. Der Indianer, der uns das Mittagessen nachbringen sollte, wird schon unterwegs sein. Der kann bei dir bleiben und dich zurückbringen. Ich werde ihn auf dem Heimwege treffen und ihm Bescheid sagen. Dieser Indianer brennt sowieso schon vor Begierde, dich kennen zu lernen. Latrupp heißt er. Wir nennen ihn unter uns das, die ‚Indian Newspaper‘, die Indianerzeitung. Die Indianer lesen keine Zeitungen. Latrupp ist ihr Mann, der überall Neuigkeiten sammelt und dieselben unter seinen Brüdern und Schwestern verbreitet. Er will ihnen doch auch von dir erzählen. Du bist noch eine Neuigkeit für die Indianer.“
Mir war’s recht, noch zu bleiben. Sims ritt fort, nachdem er mit die Schlüssel übergeben hatte. Ich blieb allein zurück. Ich mochte aber nicht in dem Hause bleiben. Da war es mir zu eng geworden. Ich ging hinaus und verschloss das Gebäude.
Von der Veranda aus blickte ich zu einer Gruppe von Indianerhütten hinüber, die in einiger Entfernung von der Missionsstation lagen, aber nicht so weit, dass man nicht unterscheiden konnte, was da bei den Hütten herum vor sich ging.
Vor einer der Hütten stand ein hochgewachsenes Indianermädchen, das aber, sobald mein Blick sich dahin wandte, in der Hütte verschwand.
Najodikahi! Flog es mir durch den Sinn. Das Mädchen, das ich am gestrigen Abend gesehen hatte, war von demselben hohen Wuchs, und die Missionsstation lag in der Himmelsrichtung zu der Schule, in der das Mädchen davongelaufen war. Sollte sie es sein? Auffallend war es, dass sie sich zeigte, wenn sie Najodikahi war. Hatte sie das Fortreiten des Schulsuperintendenten beobachtet, so doch sicherlich auch, dass ich nicht mit ihm fortgeritten war und noch in der Nähe sein musste. Freilich, sie hatte keine Ursache, zu fürchten, dass ich sie kannte, und konnte sich darum getrost zeigen. Die Tracht der Schulmädchen hatte sie abgelegt, wenn sie wirklich Najodikahi war.
Doch was kümmerte mich das Mädchen! Meine Augen und Gedanken wurden durch das Bild gefesselt, das vor mir lag. Wüste, große, öde, unabsehbare Wüste, wenn ich meinen Blick nach rechts oder nach links wandte. Vor mir in weiter Ferne hohe Berge, die Gipfel von etlichen mit Schnee bedeckten, dessen blendend weiße Farbe grell vom tiefblauen Himmel abstach. Schnee im Monat Juli in Arizona! Das musste „ewiger Schnee“ sein, wie wir als Schulknaben den Schnee solcher Berge zu nennen gelehrt worden waren. Am Fuße der Berge schlängelte sich ein schmaler grüner Streifen durch den hellen Wüstensand. Das konnte nur das Grün von Bäumen sein. Dort musste Wasser sein. Der Himmel war unbewölkt, das gleiche satte, tiefe Blau, soweit das Auge reichte. Nichts regte sich, es war so still, so friedevoll. Da meinte ich zu meiner Rechten am fernen Horizonte eine sich lang hinstreckende Staubwolke zu sehen. Nachdem ich eine Weile scharf hingeschaut hatte, merkte ich, dass die Staubwolke sich näherte. Wer mochte das sein? Ob das einer von den Wüstenstürmen ist, von denen ich gehört und gelesen hatte? Nein, ein herannahender Sturm konnte das nicht sein, dazu bewegte sich die Wolke nicht schnell genug vorwärts. Aber sie kam näher und näher.
Jetzt meinte ich vor der Staubwolke, ihrer ganzen Länge nach, dunkle und hellere Punkte zu sehen. Bald sah ich die Punkte deutlicher. Sie wurden größer und größer. Meine Augen nahmen wahr, dass sie sich nicht nur vorwärts, sondern zugleich auch bald nach der einen, bald nach der anderen Seite hin bewegen. Die Punkte vergrößern sich zu Flecken, sie kommen näher und näher, werden größer und größer. So auch die ihnen folgende Staubwolke. Jetzt sehe ich, was es ist. Es sind Pferde, wilde Pferde. Eine Herde wilder Pferde kommt daher gestürmt.
Es müssen hundert sein, nein, zweihundert, nein, mehr noch sein. Nun höre ich auch den Schall der aufschlagenden Hufe. Wie leiser, fern rollender Donner klingt es. Und näher und näher kommen sie, und lauter und lauter wird das Rollen. Jetzt sind sie da. Gerade vor mir. Mit fliegenden Mähnen, mit hoch erhobenen Schweifen im vollen Galopp, in wilden Sprüngen, schwarze, braune, gelbe, weiße, bunte Pferde, schreiend, wiehernd, pustend, keuchend jagen sie an mir vorbei. Und nun sind sie schon wieder meinen Augen entschwunden. Die folgende Staubwolke verbirgt sie meinen ihnen folgenden Blicken.
Aber siehe, da kommt noch etwas. Reiter, Pferdejungen, ein paar Dutzend. Weithin über die Ebene zerstreut kommen sie daher. Nur ein Indianer kann so reiten, so, wie im Sattel aufgewachsen, sitzen, wie diese Männer hier. Sie juchen, schreien und schwingen ihre Lassos. Schnell sind auch sie meinen Augen entschwunden, die ihnen nachfolgende Staubwolke verdeckt sie mir.
Ich stand stumm. Ich hatte etwas gesehen. Mein Auge hatte Leben in der toten Wüste erschaut. Zum ersten Male in meinem Leben hatte ich Pferde gesehen. Denselben Gedanken hatte ich schon mehrere Male gehabt. Einmal in Deutschland, als ich bei einem Kaisermanöver ein Regiment Husaren über das Feld dahinsprengen sah. Ein andermal in Russland, als ich Gelegenheit hatte, durchziehende Kosaken zu sehen. Ein drittes Mal auf der Weltausstellung in St. Louis, als ich einer Vorstellung Buffalo Bills „Wird West Show“ beiwohnte.
Ich musste lachen, wenn ich jetzt daran dachte. Das war ja alles nur Zirkus gewesen, nichts Wahres, nichts Wirkliches.
Aber heute, jetzt eben, hatte ich Pferde gesehen. Ich hatte gesehen, was so ein Tier ist und vermag, als die wilde Herde, freie Kinder der freien Wüste, in ihrer Freiheit um ihre Freiheit kämpfend, an mir vorbeijagte.
Ich zog mein Skizzenbuch und Bleifeder aus der Tasche, setzte mich auf einen Steinblock und begann zur Erinnerung an diese Stunde eine Skizze von den vor mir liegenden Bergen zu entwerfen.
Ich mochte wohl eine kleine Viertelstunde gezeichnet haben, als ich das Gefühl bekam, es stände jemand in meiner Nähe und schaue mir auf die Finger. Ich blickte auf und schaute mich um. Richtig, es stand jemand dicht hinter mir.
Ein Indianer, Dohaschtida!
Ich zuckte zusammen. „Was willst du? fragte ich.
„Das musst du nicht tun“, sagte er und wies mit dem Zeigefinger auf meine Zeichnung, du musst kein Bild von unseren Bergen und Bäumen malen.“
„Du redest töricht.“
„Das tue ich nicht. Was ich rede, das ist der Glaube unserer Väter!“ entgegnete er ärgerlich.
Büffeljagd der Vorväter
„Und du teilst den Glauben deiner Väter, der kein Glaube, sondern ein Aberglaube ist?“ fragte ich und lachte ihn an.
„Ja!“ erwiderte er bestimmt und sehr ernst.
„Du, der so viel gelernt hat, glaubt solche Märchen?“
„Ich habe dir gesagt, dass ich glaube, was meine Väter glauben!“ erwiderte er, stolz seinen Kopf in den Nacken werfend.
„Aber wie ist das möglich, dass du so etwas glaubst! Ein Baum sollte vertrocknen, ein Berg zerfallen, wenn man ein Bild davon macht! Dohaschtida, du hältst an diesem Aberglauben fest wider besseres Wissen und Verstehen. Warum lässt du diesen Glauben nicht fahren? Es ist deiner unwürdig, daran festzuhalten.“
„Weil ich nicht will!“ sagte der Indianer und sah mich sehr böse an. Er wandte sich ab und ging langsam davon. Ich folgte ihm mit meinen Blicken und sah ihn in eine der Hütten eintreten, die im Kreise derjenigen lag, vor deren einer ich zuvor das junge Mädchen hatte stehen sehen.
* * *